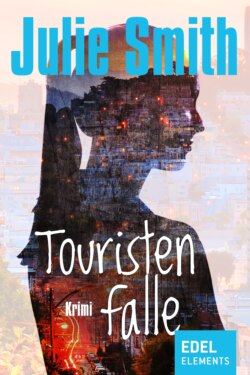Читать книгу Touristenfalle - Julie Smith - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4
ОглавлениеUnd so wurden Terry Yannarelli jene fünfzehn Minuten Ruhm zuteil, die laut Andy Warhol uns allen zustehen. Rob schickte einen Fotografen, und Terry kam auf Seite eins. Ich natürlich auch, allerdings ohne Foto, als Begleiterin des unerschrockenen Reporters Rob Burns bei seinem jüngsten Leichenfund.
Es hatte an diesem Sonntag keine tragischen Flugzeugabstürze gegeben, keine Korruptionsskandale, keine rätselhaften Krankheiten des Präsidenten, und außer einer vorgezogenen Quarantäne für einheimische Muscheln war überhaupt nichts Interessantes zu vermelden. Titelgeschichte im ›Chronicle‹ war somit der Tote am Kreuz. Erwähnt wurden weder Reverend Ovid Robinson noch Miranda Warning, was mich kurioserweise enttäuschte. Als ich den Artikel las, wurde mir allerdings klar, daß Rob sie weggelassen hatte, damit die Geschichte nicht ausuferte. Die Story war dicht und gut erzählt, nur wünschte ich mir, ich käme nicht darin vor.
Im Büro begrüßte mich die Stimme meiner Mutter – beziehungsweise ein erstklassiges Imitat. »Rebecca, dein Vater mußte sich hinlegen. Der Arzt sagt, es würde wieder werden, aber du hast nicht gerade dazu beigetragen.«
»Alan, ich zähle jetzt bis fünf –«
»Ich verstehe nicht, warum du dir nicht wie Mickey einfach einen netten Jungen suchst, statt dauernd über Leichen zu stolpern.«
»Hervorragend, Alan. Du bekommst einen Oscar. Aber halt jetzt die Klappe.«
»Du bist beinahe dreißig, wie du weißt, und deine Oberschenkel werden schon schlaff.«
»Meine Oberschenkel sind verdammt noch mal okay!«
»Mit drei Meilen am Tag wäre das noch zu beheben.« Er hörte auf im Falsett zu sprechen: »Du begleitest Mickey beim Jogging. Dann siehst du zu ihrer Hochzeit blendend aus.«
»Ich werde dich als Schwager an dem Tag akzeptieren, an dem sie Charles Manson freilassen – aber nur wenn Charlie nicht raus will.«
»Du bist mir eine schöne Tante. Soll dein Neffe namenlos bleiben?«
»Wieso – Schwartz wär doch super. Oder Yannarelli. Solange es nicht Kruzick ist.«
Ich stapfte hinter ihm her in mein Büro. Ich mußte meine Haltung zu Alan überprüfen. Die Wahrscheinlichkeit, daß Mr. Wonderful mein Schwager würde, betrug immerhin fünfzig Prozent. Bisher war Mickeys Urteilsfähigkeit in bezug auf Männer stets kümmerlich. Kaum zu hoffen, daß ihr ausgerechnet jetzt die Augen aufgingen.
»Warum erfahre ich immer alles erst aus der Zeitung? Du findest einen toten Mann ans Kreuz genagelt und erzählst es nicht mal deinen Lieben.« Wieder Moms Stimme, diesmal kam sie aus dem Mund von Chris. Sie stand in meiner Tür.
»Mich deucht, hier gibt es ein Echo.«
»Ein Echo?«
»Wir müssen Kruzick rausschmeißen, Chris, du klingst schon wie er. Was wird, wenn du auch noch aussiehst wie er?«
»Meine Nase wird schon länger.« Ich lachte. Kruzick hat ein kräftiges Riechorgan, aber Chris ist ein Meter dreiundachtzig groß und ihre Nase paßt. »Wer hat den armen Mann umgebracht?«
»In der Castro Street glauben sie, es war ein Schwulenhasser.«
»Aber du bist nicht davon überzeugt.«
Ich schüttelte den Kopf. »Ich bin mir nicht mal sicher, ob auch nur einer der beiden schwul war. Der Mörder – Lee oder wer auch immer – hatte dem schönen Terry Yannarelli den angejahrten Jack Sanchez vorgezogen. Vielleicht kannte er Sanchez schon. Wenn Lee nicht schwul war und den Gelben Papagei nur als Treffpunkt vorgeschlagen hatte, dabei vielleicht nicht mal wußte, daß das eine Schwulenbar ist – dann wäre alles klar, nicht?«
»Du meinst, sie waren verabredet, und Terry drängelte sich zwischen sie? Das wäre auch bei zwei Schwulen denkbar.«
»Ja, aber Terry hält Lee für heterosexuell, und auf dem Mount Davidson lief eine Frau herum, die behauptete, Sanchez sei ihr Liebhaber gewesen.«
Ich erzählte von Miranda. Chris ließ mich mit einem Stapel Memos allein: Lauter Anrufe von Konkurrenzblättern des ›Chronicle‹. Aus Loyalität zu meinem Liebsten meldete ich mich bei keinem von ihnen, rief statt dessen Rob an und lobte mich überschwenglich für diese edle Haltung. Und fragte ihn natürlich nach Neuigkeiten.
»Sanchez war eindeutig schwul. Absolut kein Zweifel. Beweis Nummer eins – er wohnte im Oscar Wilde Hotel. Was sagt dir das? Beweis Nummer zwei – ich habe heute morgen mit seiner Familie in Gallup telefoniert: Er hat niemals, nicht mal in der Junior High School auch nur das geringste Interesse an Frauen gezeigt. Nicht mal an einer Stute. Beweis Nummer drei – seine Schwester hat die ganze Familie gefragt, und niemand hat je etwas von einer Miranda gehört.«
»Wer ist also Miranda?«
»Das dürfte eine der zwei entscheidenden Fragen sein. Sehen wir uns morgen abend zum Dinner?«
»Natürlich.«
Ich widmete mich wieder meiner blühenden Kanzlei. Ich hatte einige Erfahrung mit Mordfällen und wußte, daß sie meine Arbeit immer schrecklich behinderten. Gott sei Dank, daß mich diese Geschichte nur am Rande betraf. Aber am Abend drauf, als wir beim Chinesen saßen und ich die superscharfe Hunan-Küche mit Bier runterspülte, spukte mir immer noch Miranda im Kopf herum.
Wir waren auf dem Nachhauseweg, als mir die rettende Idee kam:
»Und wenn sie gar nicht Sanchez’ Geliebte war?«
»Das hatte ich mir auch schon überlegt. Du nicht?«
»Zu irgendwem muß sie aber gehören. Vielleicht war Lee ihr Liebhaber.«
Rob blieb stehen. »Miss Schwartz – Sie könnten recht haben.«
»Vielleicht hat Miranda Lee mit Sanchez überrascht und ihn aus Eifersucht getötet.«
»Unwahrscheinlich. Sie war viel zu betrunken, wie du weißt, und außerdem nicht stark genug, um ihn ans Kreuz zu nageln.«
»Außerdem hätte sie natürlich Lee getötet und nicht Sanchez. Das hätte ich jedenfalls getan. Dich getötet, meine ich.«
Er küßte mein Ohr. »Hm. Hättest du? Mit einem Messer oder einem Leuchter?«
»Messer natürlich. Es könnte doch sein, daß sie uns über den Tathergang beschwindelt hat.«
»Brillant, Miss Schwartz! Aber wie gesagt – ich äußere nur Vermutungen.«
»Angenommen, sie wäre Lees Freundin und aus irgendeinem Grund glaubte Lee, daß Sanchez eine Affäre mit ihr hatte, was nicht stimmte, weil er ja schwul war. Aber Lee tötete ihn dennoch.«
»Du bist betrunken.«
»Nach alter Südstaaten-Tradition zählt es nicht, wenn du betrunken bist und dich dann ein Mann verführt. Das sagt Chris, und sie sagt auch, daß demzufolge Tausende von Südstaaten-Frauen, die mit der Hälfte aller Männer des County im Bett waren, immer noch als Jungfrauen gelten.«
»Wenn wir jetzt miteinander schlafen, zählt das demnach nicht?«
»Nein. Wir werden so unschuldig aufwachen wie Mormonen-Missionare.«
»Mir fällt da gerade eine frühere Affäre ein.« Manchmal fand Rob es furchtbar, wenn ich mich albern verhielt, andererseits war er entzückt, wenn ich mit einigen Drinks im Bauch mitten in der Woche spät nachts plötzlich Lust bekam, mit ihm ins Bett zu gehen. So endete auch dieser Abend, weshalb wir beschlossen, uns die kommenden Nächte getrennt voneinander zu erholen. Als Rob Freitagmorgen anrief, dachte ich natürlich, er hätte Sehnsucht nach mir und wollte mich an unsere Schlammbad-Verabredung erinnern. Aber dazu klang er viel zu aufgeregt. »Ich muß dir was vorlesen.«
»Okay.«
»Ein Brief. Er kam heute mit der Post. Ich glaube, der Mörder hat ihn geschrieben.«
»Lies vor!«
»›Lieber Mr. Burns: Ich bin sehr froh, daß Sie die Leiche entdeckt haben. Sie waren schon immer mein Lieblingsreporter beim ›Chronicle‹, und ich gebe Ihnen einen Tip. Achten Sie auf Pier 39, da passiert was‹. Unterzeichnet mit ›Der Trapper‹.«
»Der Trapper! Sanchez war ein Tourist.«
»Und Pier 39 ist eine Touristenattraktion. Ich mag gar nicht daran denken, was das bedeuten könnte.«
»Hältst du den Brief für echt?«
»Ich fürchte ja. Die Polizei bekommt immer wieder Bekennerbriefe von Verrückten. Reportern passiert das selten. Ich kann mich an solch einen Fall erinnern, das war in den sechziger Jahren.«
»Der Zodiac-Killer?«
»Ja. Paul Avery hieß der Reporter, der über die Morde berichtete – Zodiac schätzte ihn als ›lieben Brieffreund‹.«
»Die Briefe wurden in der Zeitung abgedruckt. Das weiß ich noch.«
»Aber erst nach langwierigen Diskussionen mit den Bullen. Es wurde beschlossen, daß –«
»Ich weiß schon – daß die Öffentlichkeit das Recht hat informiert zu werden.«
»Hältst du das für falsch?«
»Hm. Vielleicht ist es diesmal ein Verrückter.«
»Das wollen wir hoffen. Ansonsten werde ich wohl oder übel den ganzen Tag mit Bullen und Zeitungsleuten konferieren. Hast du heute schon was vor?«
»Nein. Wollen wir nicht zur Pier 39 gehen? Das wäre für mich ein Traum-Date.«
»Ich hole dich um sieben ab. Aber es wird kein langer Abend, wir wollen doch morgen nach Calistoga.«
Bornierte Typen von der Ostküste mit ihren Vorurteilen gegen »Exzentriker und Schwule«, die sie gerne in einen Topf schmeißen, sollten mal Pier 39 kennenlernen, San Franciscos Krebsgeschwür. Bis 1976 war die Pier ein Schiffsanlegeplatz; knapp dreizehn Monate später hatte sie sich in ein städtebauliches Ungeheuer verwandelt – ein Shoppingcenter im New England-Stil. Wir Einheimischen finden die Pier scheußlich, zumindest diejenigen unter uns, die keine Läden oder Restaurants in dieser Schicki-Micki-Umgebung betreiben.
Einer der ersten Geschäftsleute auf Pier 39 war Dan White, der frühere City Supervisor, der hier gebackene Kartoffeln an die hungrigen Horden aus dem Mittleren Westen verkaufen ließ. Dan White, ein fanatischer Schwulenhasser, erschoß eines Tages San Franciscos Stadtoberhaupt George Moscone und seinen Kollegen aus dem Stadtparlament, Harvey Milk (den »Bürgermeister von Castro Street«).
Ich will ja nicht verbittert klingen, aber mit einer Scheußlichkeit wie Pier 39 in der eigenen Stadt darf man sich auch mal wie die ›Rebecca von der Sunnybrook Farm‹ anhören, Es gibt in San Francisco allerdings noch andere Einkaufszentren, die von unseren Brüdern und Schwestern aus Paris/Tennessee und Cairo/Illinois bevorzugt werden. Die Cannery zum Beispiel, wo früher Konservenbüchsen gefüllt wurden, oder den Ghiradelli Square, der Geburtsstätte des Schokoladenriegels. Sie mit Pier 39 zu vergleichen, hieße das Tivoli mit Coney Island auf eine Stufe zu stellen. Der ganze Ort läßt meine Haut jucken, als wäre sie in Kunststoff eingepackt.
Als Rob und ich aufkreuzten, waren fast mehr Bullen da als Touristen – grob geschätzt drei Millionen von jeder Sorte.
»Der Polizeichef scheint von deinem Brief zu wissen.«
Rob nickte. »Er nimmt ihn offenbar ernst.«
»Werdet ihr ihn drucken?«
»Jetzt noch nicht. Warum die Leute erschrecken?«
Normalerweise wäre das auch mein Standpunkt, aber ich war in Diskussionslaune. »Warum auch? Man sollte die Touristen nicht daran hindern, ihr Geld auszugeben – auch wenn es der Gesundheit schadet.«
»Das wissen wir noch nicht. Du meinst, wir sollten die Flucht nach vorne antreten und ihn veröffentlichen?«
Ich überlegte. »Nein. Aber ich verstehe langsam, welches Für und Wider solche Entscheidungen beeinflußt.«
»Aha! Du gibst zu, daß es nicht nur Sensationsmache ist.«
»Ich behalte mir ein Urteil vor. Wenn etwas passiert, kannst du den Brief veröffentlichen und bist immer noch exklusiv.«
»Aber auch dann wäre es falsch ihn zu drucken?«
»Nicht direkt.«
»Wahrscheinlich hast du nur Hunger. Laß uns erst ein bißchen herumschnuppern, und dann gehen wir irgendwo was essen.«
»Okay. Fantasia oder Only in San Francisco Memorabilia?«
»Ich sage es ja nur ungern, aber –«
»Oh nein!«
»Richtig. Alle beide!«
Er schob mich in den Only-in-San-Francisco-Laden. Hier war es so voll wie in einem Viehtransporter. Die Leute rissen sich um bedruckte T-Shirts (Motiv Golden Gate Bridge) und unförmige Krüge mit der Aufschrift: ›Ich zerbrach in San Francisco‹. Ein Ellenbogen bohrte sich in meine Leibesmitte, und ich schrie auf.
»Was ist?«
Ich zeigte auf einen der Krüge.
»Gut«, sagte Rob. »Gehen wir.«
Für die zehn Schritte zum Ausgang brauchten wir etwa dreieinhalb Stunden; aber wir amüsierten uns: wenn der Trapper hier zuschlagen wollte, säße er selbst in der Falle. Also auf zu Fantasia mit seinen Videospielen, Skeeballs, Boomballs, Auto Scooters, den vielen Spiegeln, die alles doppelt so groß erscheinen ließen, und der typischen Spielcasinobeleuchtung, die vergessen machte, ob es draußen Tag oder Nacht war; außerdem 93000 Kinder. Eine grobe Schätzung, aber nicht ganz aus der Luft gegriffen. Ein echter Alptraum, wenn man den Trapper hier vermutete, aber soweit wir sehen konnten, war alles normal.
Die Ship’s Galley, wo Hunderte von Touristen ihre Bay-burgers, Bagels und Kabuki Yakitori futterten, war schlecht beleuchtet und laut wie immer. So ging es weiter. Der Trapper schien weder in der Art Fair Outside Gallery (Verkauf von gerahmten San-Francisco-Plakaten und niedlichen Tierbildern) noch im Chocolate Heaven oder im Music Box Store zu lauern. Wir sahen uns überall oberflächlich um, wußten aber nicht recht, worauf wir achten sollten. Dann zog der Palace Of Magic Rob in seinen Bann.
Hier konnte das kindliche Gemüt faszinierende Dinge erwerben – Glatzenperücken und Giftzähne; mit schaumigem Blut gefüllte Kapseln, fluoreszierende Schminke und Kämme, die wie Klappmesser aussahen, oder Rauch, der auf das Kommando »Abrakadabra« aus den Fingern quoll. Wir waren so versunken, daß wir dem Trapper ohne weiteres in die Falle gegangen wären. Und wir haben all diese Wunderdinge gekauft. (Natürlich auf Robs Veranlassung. Allein hätte ich der Versuchung zweifellos widerstanden.)
In der Mitte von Pier 39 war eine Art Bühne, auf der ein Jongleur drei Kettensägen gleichzeitig durch die Luft wirbelte. Hätte ihn jemand nur leicht angestupst, wäre Blut geflossen. Aber keiner wagte es. Wir gingen an der Menschenmenge vorbei, die sich um ihn gebildet hatte. Alles schien ruhig.
Es blieb noch die zweite Ebene der Pier zu erforschen – wo sich Restaurants mit Seeblick und Souvenirläden drängelten. Ich war jetzt so hungrig, daß ich auch einen Stock gegessen hätte. Wir gingen ins Eagle Cafe, Juwel der Pier und im Umkreis das einzige authentische Stück ›Old San Francisco‹. Auf den grünen Formica-Tischen standen Ketchupflaschen; das Restaurant, das aus dem Jahre 1927 stammte, war 1978 en bloc von seinem ehemaligen Standort auf die Pier 39 verlegt worden. Wir fühlten uns wie zu Hause.
Während ich meinen Hamburger verspeiste, dachte ich nach. »Nichts ist passiert«, sagte ich endlich. »Warum gehen wir nicht nach Hause?«
»Ich ruf dir ein Taxi, wenn du magst – ich habe das Gefühl, ich sollte bleiben. Und warten, ob der Tod zuschlägt.«
Mich schauerte.
»So ist das nun mal im Nachrichtenbusiness. Angenommen, der Präsident kommt in die Stadt, um eine Rede zu halten; theoretisch ist das die Nachricht. Aber was passiert, wenn er plötzlich einen Herzanfall erleidet oder jemand auf ihn schießt? Das wäre dann die wirkliche Nachricht. Also muß man einen Reporter in sein Hotel schicken, der – für alle Fälle – in der Bar hockt und trinkt und wartet.«
»Wie langweilig.«
»Mitnichten. Es wimmelt da von Kollegen, die auch darauf warten, daß was passiert.«
»Und heiße Diskussionen führen, nehme ich an.«
»Und jeder versucht die Kriegserlebnisse der anderen zu überbieten.«
»Der Trapper – falls er überhaupt existiert – hat aber nicht gesagt, daß er gerade heute abend zuschlägt. Das kann genausogut morgen sein oder erst in sechs Monaten. Willst du hier dein Bett aufstellen?«
»Hör mal! Was ist das?«
Ich lauschte. Klar, das waren Sirenen, die rasch näher kamen. Rob schmiß seinen Stuhl um und stürzte hinaus.