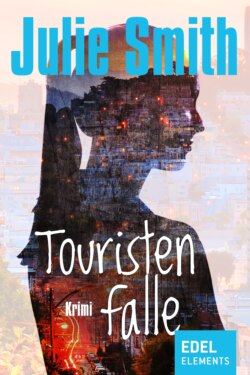Читать книгу Touristenfalle - Julie Smith - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5
ОглавлениеKrankenwagen rasten zur Pier, einer hinter dem anderen, wie bei einer Katastrophe. Nun erlebte ich hautnah, was Rob mir gerade beschrieben hatte: das Warten auf den Tod.
Rob war nirgends zu sehen, aber ich würde ihn bestimmt am Unglücksort finden. Dort war eine Menge los: Sanitäter rannten die Treppen hinauf, Feuerwehrmänner direkt hinterdrein. Wenn ich mich nicht beeilte, würde ich durch das drohende Verkehrschaos von den Ereignissen abgeschnitten. Es mußte eine Katastrophe gewesen sein – bis jetzt hatte ich sechs Krankenwagen gezählt.
Die Menge – und ich mittendrin – schob sich zu einem Fischrestaurant, dem Full Fathom Five. Warum hatten die Besitzer ihrem Lokal nur diesen Unglücksnamen verpaßt? Die Bullen hatten den Eingang versperrt; sie ließen nur die Sanitäter durch, die auf Bahren Menschen aus dem Restaurant trugen. Sie waren festgebunden; einige rangen mühsam nach Luft; ein junger Mann schrie. Ein älterer Mann sah leichenblaß aus und war auffallend still.
Es kamen noch mehr Krankenwagen. Ich verlor langsam die Übersicht und fühlte mich selbst nicht gerade wohl. Im aufgeregten Gebrabbel der Menschenmenge war ein Wort wiederholt zu hören, schrill, dumpf, laut und leise: »Fischvergiftung! Fischvergiftung! Fischvergiftung!«
Aber ich glaubte nicht eine Sekunde daran. Selbst ein Restaurant, das dumm genug war, sich nach einer tödlichen Untiefe zu nennen, würde nicht einen so tragischen Fehler begehen. Außerdem stellten sich meines Wissens die schlimmeren Folgen einer Lebensmittelvergiftung sowieso erst Stunden nach dem Essen ein. Und ich wußte, was hier niemand ahnte – ein Unbekannter, der sich selbst der ›Trapper‹ nannte, hatte Rob geschrieben: »Achten Sie auf Pier 39, da passiert was.«
Die Gegend um die Castro Street – unser Schwulenghetto – war die stärkste Attraktion für schwule Touristen; und für das Full Fathom Five galt das gleiche; es war unwahrscheinlich, daß außer den Angestellten oder dem Vertreter der Gesundheitsbehörde je ein Einheimischer durch seine Schwingtüren geschritten war. Wenn dieses Unglück die Arbeit des ›Trappers‹ war, gab es über seine Absichten keinen Zweifel. Aber warum? Ich konnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, was er gegen Touristen haben könnte.
Ich erblickte Rob und winkte ihn zu mir. »Meinst du, das war der Trapper?«
»Bestimmt. Nur die Bullen kann ich nicht überzeugen. Ich kriege kein Wort aus ihnen heraus. Sie verraten lediglich, daß elf Personen schlecht geworden ist, als sie im Full Fathom Five zu Abend aßen.«
»Elf!«
Rob nickte, mit ungewöhnlich ernstem Gesicht. »Ich hatte gedacht, daß sie mit mir zusammenarbeiten würden. Schließlich habe ich sie über den Drohbrief informiert. Jetzt heißt es plötzlich, ›Vergiß es, Charlie; wer braucht dich schon?‹ Beim nächsten Mal behalte ich alles für mich.«
»Du mußtest sie aber informieren.«
»Ich weiß. Aber man sollte doch annehmen –«
»Man sollte doch annehmen, daß es eine Gerechtigkeit auf dieser Welt gibt. Schön wär’s!«
Er grinste. »Das ist ein schöner Satz für eine Rechtsanwältin. Komm, hilf mir mal, meinen Artikel durchzutelefonieren.«
Rob gehört zu den wenigen Reportern, die aus dem Stegreif einen Artikel diktieren können. Mir erzählt er immer, daß die Nachrichtenjäger der Ben-Hecht-Ära dies auch konnten – es gehörte zu ihrem Job –, aber heute ist es eine aussterbende Kunst, die von der Technologie ersetzt wird. Vor Jahren wollte Rob mal in einem Strafprozeß seiner Redaktion das Urteil durchtelefonieren. In der Telefonzelle neben ihm stand ein Reporter von AP. Die Redaktion ließ Rob ein oder zwei Minuten warten; als er endlich verbunden wurde, war das Urteil bereits per Telex von AP eingetroffen, durchgegeben von dem Typen neben ihm. Man mußte sich nicht mehr beeilen, um die Konkurrenz zu schlagen – die Maschinen erledigten das. Aber mein Freund Rob ist stolz auf sein handwerkliches Können. In den alten Tagen der ›Front Page‹ wäre er sicher glücklicher gewesen.
Er wurde mit einem »rewrite man« namens Kathy verbunden und legte los.
»Elf Personen mußten heute abend ins Krankenhaus eingeliefert werden, nachdem sie im Full Fathom Five, Pier 39, zu Abend gegessen hatten. Captain Michael (›Slim‹) McGarrity von der San Francisco Police bezeichnete das Ereignis als ›das schlimmste Unglück in der Geschichte der Pier‹. McGarrity berichtete, daß die Gäste kurz nach 21.00 Uhr erkrankten; einen Kommentar über die möglichen Ursachen der mysteriösen Krankheit lehnte er ab. Befragt, ob Gift die Ursache war, antwortete er: ›Das weiß ich nicht – ich habe vergessen meine Approbation zu erneuern ...‹«
Der letzte Satz würde bestimmt zensiert. Rob versuchte immer wieder Witze in ernste Artikel zu schmuggeln, und beklagte sich, wenn der Redakteur sie wieder rausstrich. Er könne gar nicht anders, sagte er – er zitiere ja nur. Aber sein verantwortlicher Redakteur schien eine gewisse Form von Zensur für richtig zu halten – aus Gründen des »guten Geschmacks«.
Ich hörte Rob weiter zu. »Wißt ihr, was McGarrity noch sagte? Man hätte keine Approbation gebraucht, um zu erkennen, daß es sich um eine Vergiftung handelte – aber druckt das bitte nicht. Eins steht fest, es muß der Trapper gewesen sein. Die Bullen werden das morgen früh bekanntgeben, gerade noch rechtzeitig für den ›Examiner‹. Wenn wir nicht auch ... oh, okay. Ich glaube nicht.«
Er legte auf. »Du glaubst was nicht?«
»Es sähe ganz schön blöd aus, wenn wir die Trapper-Botschaft drucken, und dann stellt sich raus, daß der Küchenchef versehentlich Seifenpulver oder so was in die Suppe geschüttet hat. Deswegen können wir sie nicht bringen.«
»Ich verstehe.«
»Die Polizei hat das Lokal versiegelt, aber ich will versuchen, mit den Leuten zu reden, sobald sie rauskommen. Bleibst du hier, oder ist es dir zu langweilig?«
»Ich brauche Bewegung. Ich gehe erst mal spazieren. Später komme ich wieder hierher zurück.«
»Okay.« Er gab mir einen Abschiedskuß.
Ohne nachzudenken, wanderte ich in Richtung Fisherman’s Wharf – ich sage ohne nachzudenken, weil niemand auf die Idee kommen würde, sich diesen von Menschen überquellenden Teil des Embarcadero für einen nächtlichen Spazierweg auszusuchen. Ich mußte mir mit den Ellenbogen einen Weg durch die potentiell gefährdeten Touristen bahnen, die sich sorglos im grellen Neonlicht amüsierten. Normalerweise wären sie mir auf den Geist gegangen – wie kamen die dazu, einer waschechten Einheimischen den Weg zu versperren? –, aber jetzt hatte ich Angst um sie. Ich beobachtete ihre Gesichter, wie sie einander anschauten, und ich registrierte das Vergnügen, mit dem sie sich gegenseitig auf Sehenswürdigkeiten hinwiesen. Besonders ältere Paare, Menschen, die die meiste Zeit ihres Lebens miteinander verbracht hatten und die sich jetzt aneinander festhielten. Ich dachte an den alten Mann, den sie aus dem Full Fathom Five herausgetragen hatten, der so leichenblaß und starr ausgesehen hatte. Ob er eine Frau hatte und Kinder und Enkel?
Zum erstenmal in meinem Leben als Einwohnerin von San Francisco (ich komme aus dem Marin County, aber das ist praktisch dasselbe) machte ich mir Sorgen wegen der Fremden, anstatt sie für ein wirtschaftlich notwendiges Übel zu halten. Ich fragte mich, wer sie waren, woher sie kamen, was sie taten, und wer sie töten wollte, und warum. Meine Gedanken kreisten um diese Menschen, die so unschuldig, ohne Argwohn, auf dem scheinbar harmlosen Embarcadero herumspazierten, hier und da stehenblieben, um Jugendliche in Punk-Klamotten anzustarren oder einem Trommler zu lauschen und alles Exotische aufzusaugen, was es daheim in Illinois nicht gab. Und noch etwas – konnte der Trapper nicht auch Einheimische treffen, die er für Touristen hielt?
»Mal langsam«, hätte Rob gesagt. »Guck nur auf ihre Kleidung.«
Beim Gedanken an Rob mußte ich lächeln. Ich machte kehrt. Ich mußte mir wieder einen Weg durch die Menschenmassen bahnen, aber jetzt hatte ich ein Ziel. Ein deutlich erkennbares Ziel – es standen immer noch Polizeiautos vor Pier 39. Ich schob mich an der Balclutha vorbei, dem Museums-Segelschiff, das in der Bay ankerte und an den Punks und den Polizeiautos. Der Polizist im dritten Wagen sprach laut in sein Funkgerät, und was er sagte, schien interessant. Er war ein Machotyp, der jede Chance nutzen mußte, sich wichtig zu tun; er dröhnte so deutlich wie ein Nebelhorn: »Zu Zimbardo noch nichts Neues«.
In der Hoffnung auf mehr, blieb ich stehen, aber der Bulle sprach jetzt leiser. Wahrscheinlich hatte er seine Unvorsichtigkeit bemerkt.
Vor dem Restaurant stieß ich auf Rob, der gerade ein Paar aus Oregon interviewt hatte. »Wie war der Spaziergang?«
»Produktiv. Und bei dir?«
Er schauerte zusammen. »Da drinnen muß es grauenvoll gewesen sein. Was meinst du mit ›produktiv‹?«
»Sagt dir der Name Zimbardo was?«
»Nein, warum?«
»Er oder sie könnte ein Verdächtiger sein.«
Ich erzählte, was ich belauscht hatte.
»Besorgen wir uns ein Telefonbuch.« Seine blauen Augen leuchteten sensationslüstern. Manchmal macht mir diese Seite an Rob zu schaffen, aber wenn er so elektrisiert ist, wirkt er unwiderstehlich. Ich ließ mich – nicht zum erstenmal – von seiner Begeisterung anstecken. Einmal hatte sie uns in eine rasante Auto-Verfolgungsjagd verwickelt, Unfall inklusive, wobei einer von uns im Knast landete – aber nicht der Herr mit den leuchtend blauen Augen.
»Zimbardo, Zimbardo –« Rob suchte im Telefonbuch. »Art Zimbardo, Bush Street. Gehen wir!«
Zimbardo wohnte am Rande von Tenderloin, in der Nähe vom Stockton Tunnel. Absolut keine Parkplätze, aber Rob hielt vor einem Hydranten und klemmte seinen Presseausweis hinter die Windschutzscheibe. Er sprang aus dem Wagen, und ich holte ihn erst ein, als er auf die Klingel eines Apartments im dritten Stock drückte. Es dauerte eine ganze Weile, bis eine verschlafene Stimme antwortete. »Wer ist da?«
Rob holte tief Luft. Ich wußte, was er dachte: Der Trapper kannte seinen Namen. »Rob«, sagte er schließlich so herzlich, als besuchte er seine Mutter.
»Rob?« Die Stimme klang ehrlich verblüfft. »Sie haben wohl die falsche Wohnung erwischt.«
»Nein«, sagte Rob sehr eindringlich. »Sie sind doch Art Zimbardo? Es ist sehr wichtig.«
»Wichtig? Geht es um Lou?«
»Ich fürchte ja.«
Zimbardo ließ uns ohne ein weiteres Wort ein. Das Foyer war schlecht beleuchtet; der Teppich auf der Treppe stank nach Schweißfußen. Beim Hinaufsteigen sagte Rob: »Du wirst sehen, das war richtig. Natürlich habe ich gelogen, aber es hat schon was für sich vom ›Chronicle‹ zu sein. Sag jetzt nichts, okay?«
Er kannte mich gut genug, um zu wissen, daß mir die Lüge nicht gefiel. Ich merkte, daß es ihm selbst unangenehm war. Er muß wissen, was er tut, dachte ich und sagte nichts.
Der junge Mann an der Tür hatte nur Unterhosen an und riß entsetzt die Augen auf, als er mich erblickte. »Verzeihung. Eine Sekunde. Oh, Mann.« Und machte die Tür wieder zu.
Ich entspannte mich. Es sah nicht so aus, als kämen wir in den Salon eines Massenmörders.
Der junge Mann trat wieder an die Tür, angezogen und immer noch peinlich berührt: »Ich wußte ja nicht, daß Sie eine Lady mitbringen.« Seine schwarzbraunen Augen blitzten Rob an. Der Junge war ärgerlich und erbost, vielleicht meinetwegen, vielleicht auch nicht.
Er führte uns ins Wohnzimmer, das offenbar vom Vermieter möbliert worden war. Der schwarze Plastikbezug des Sofas war eingerissen und der beigefarbene Teppich voller Flecken. Auf einem Tisch im skandinavischen Stil der fünfziger Jahre stand eine billige Tiffany-Glaslampe, der Papierschirm noch in Zellophan verpackt.
»Ich bin vom ›Chronicle‹«, sagte Rob und stellte uns vor.
»Vom ›Chronicle‹?«
Rob feuerte seine Fragen ab und ließ Zimbardo keine Zeit zum Nachdenken.
»Arbeiten Sie in einem Restaurant auf Pier 39?«
»Ja. Im Full Fathom Five. Als Kellner.«
»Waren Sie heute abend dort?«
»Nein, ich habe frei. Was soll das, ich denke es geht um Lou?«
Rob erzählte ihm, was passiert war. Ich sah mir Zimbardo genau an: Er war jung, höchstens neunzehn oder zwanzig und würde nie Probleme mit seinem Gewicht haben. Eher klein, muskulös und schlank wie ein Fisch. Lockiges Haar, volle Lippen und vorwurfsvolle, traurige, flehende suppentassengroße Augen. Ein Blick wie der eines Kindes, das sein Pausenbrot vergessen hat. Als Rob wiederholte, was ich bei dem Bullen mitgehört hatte, ließ Art sich aufs Sofa fallen und schlug die Hände vors Gesicht. »Oh, Mann, Lou war da. Er war da.«
»Ist Lou Ihr Bruder?« fragte ich.
Zimbardo nickte, schwieg einen Augenblick. »Ich muß zu ihm. Haben Sie ein Auto?«
»Ja. Aber warum rufen Sie ihn nicht an?«
»Er hat kein Telefon. Nur ein Zimmer in der Jones Street. Ich sagte, er kann hier wohnen, aber er lehnte ab – er wollte seine eigenen vier Wände nach dem Knast.«
»Ihr Bruder war im Gefängnis?«
Er nickte. »Hey, Rob, er hat es nicht getan, bestimmt nicht. Können Sie das im ›Chronicle‹ schreiben?«
Rob sagte: »Sollten wir ihn nicht erst mal suchen?«
»Wahrscheinlich braucht er einen Anwalt. Ich muß ihm einen Anwalt besorgen.« Er zog eine billige Jacke an, die sowenig nach Leder aussah wie das Sofa.
»Rebecca ist Anwältin.«
»Yeah? Sie sind Anwalt?«
»Hm.«
Wir rasten die Treppe runter und zum Auto. Lous Absteige war nur ein paar Blocks entfernt, aber Laufen war nicht drin.
»Warum«, fragte ich, als wir im Auto saßen, »braucht Lou einen Anwalt? Sie sind es doch, der im Restaurant arbeitet – warum sollte Lou denn dort gewesen sein?«
Art blickte trübe. »Ich hab’ ihm einen Job in der Küche besorgt. Heute war seine dritte Nacht.«
»Vielleicht ist er noch da. Wir sollten ihn anrufen.«
»Nein, Mann. Der ist bestimmt nicht da. Wo Bullen sind, ist Lou garantiert nicht zu finden.«
Seine Stimme zitterte und seine Schultern wahrscheinlich auch. Beim Anblick von Lous Zimmer dachte ich, er hätte doch lieber bei Art einziehen sollen. Seine Zelle im Knast konnte nicht viel kleiner gewesen sein. Diese hier enthielt ein Bett samt durchgelegener Matratze, ein Nachttischchen, eine Kommode und einen Stuhl. Kein persönlicher Gegenstand – nur ein angejahrter Fernseher. Ich öffnete eine Schublade und sah überrascht auf etliche Socken. Lou war nicht ausgezogen, nur abwesend. Art verlor langsam die Kontrolle über seine Gesichtsmuskeln. Er konnte natürlich nicht vor uns losheulen, aber das Bemühen sich zu beherrschen, machte aus seinem hübschen Gesicht eine verzweifelte Maske.
Draußen stoppte ein Auto mit quietschenden Reifen. »Dieses Haus!« brüllte jemand. Ein Jemand, den Rob und ich gut kannten. Martinez war der letzte, dem ich begegnen wollte oder dem Art begegnen sollte. Rob und ich sahen uns an. Wir waren einer Meinung.
»Die Bullen sind draußen. Gibt es hier eine Hintertreppe?«
Art schüttelte den Kopf, er war leichenblaß.
»Gehen wir eine Treppe höher«, sagte ich.
Es klappte wunderbar. Wir lauschten wie Martinez und Curry Lous Zimmer betraten, schlichen hinunter und ungesehen hinaus.
Schweigend fuhren wir zu Arts Wohnung.
»Ich muß mich bei der Redaktion melden«, sagte Rob. »Kann ich Ihr Telefon benutzen?«
»Sie sagen doch nichts über Lou?«
»Natürlich nicht!«
»Das Telefon ist im Schlafzimmer«, sagte Art mit einem Anflug von Stolz. Ich sah, was Rob mit dem ›Chronicle‹Effekt gemeint hatte. Obwohl sein Bruder soviel Ärger hatte wie General Custer am Little Big Horn, freute sich Art, in einer aktuellen Zeitungsstory aufzutauchen. Er behandelte Rob so respektvoll, als hätte er einen Yeti gefangen und gezähmt; als säße das legendäre Monster in Arts Wohnzimmer, bereit ihm aus der Hand zu essen und auf Befehl Kunststückchen zu machen oder ihn in Stücke zu reißen.
Yeti Rob ging ins Schlafzimmer. »Wenn die Bullen kommen, müssen Sie nicht mit ihnen reden«, sagte ich zu Art. Arts Augen wurden tellergroß. »Ich muß nicht?« »Auf keinen Fall. Rufen Sie mich an, wenn es Ärger gibt.« Ich gab ihm meine Karte. Es war idiotisch – als wollte ich mir Kunden angeln –, aber Art wußte so wenig über Anwälte, daß er die Geste nicht mißverstehen würde. Er gefiel mir; um die Wahrheit zu sagen, er weckte in mir wilde Muttergefühle. Ich wollte nicht, daß Martinez und Curry ihn benutzten. Art sollte wissen, daß er Freunde hatte.