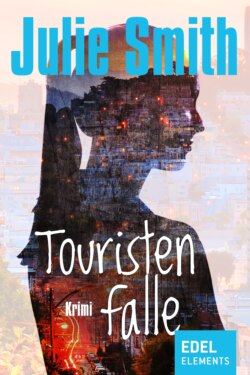Читать книгу Touristenfalle - Julie Smith - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6
Оглавление»Kann ich Rob Burns sprechen?« Um acht Uhr in aller Herrgottsfrühe mir am Telefon diese Frage zu stellen, war ziemlich kühn. Es ging um die Pressekonferenz in der Hall of Justice, die auf neun Uhr angesetzt war. Martinez hatte an diesem Samstag Dienst – also würde auch Rob arbeiten, aber nicht den ganzen Tag. Sonntags erscheint der ›Chronicle‹ nicht, und die Pressekonferenz konnte er sich eigentlich sparen. (Die Nachrichtenseiten für das sonntägliche Gemeinschaftsprodukt aus ›Chronicle‹ und ›Examiner‹ lieferte der ›Examiner‹.) Natürlich wollte Rob trotzdem hin.
»Komm doch mit«, sagte er. »Wir fahren dann direkt weiter nach Calistoga.«
Ich hatte sowenig Lust zu dieser Pressekonferenz wie Appetit auf Kohlrüben zum Frühstück; aber natürlich wäre es sinnvoll hinzugehen – sofern Martinez zu ertragen, zu welcher Tageszeit auch immer, überhaupt sinnvoll genannt werden kann. Das Ganze fand im unordentlichen papierübersäten Presseraum in der zweiten Etage statt. Eine Reporterin vom ›Examiner‹, vier verschlafen blickende Rundfunktypen sowie Rob und ich waren gekommen.
»Eine toxische Substanz«, sagte Martinez, »verursachte heute abend Krankheitserscheinungen bei elf Personen, die von Pier 39 ins Krankenhaus gebracht werden mußten. Die Substanz ...«
»Um welche Substanz handelt es sich?«
»Die Substanz wurde offenbar von jenen Personen im Full Fathom Five geschluckt in Folge ...«
»Halt, Inspektor – wie können elf Leute ...?«
»... in Folge der Aufnahme von vergifteten Nahrungsmitteln.«
»Was steckte in diesen Nahrungsmitteln?«
»Das ist zur Zeit noch nicht bekannt.«
»Wie ist die Wirkung?«
»Auch das kann ich im Augenblick noch nicht sagen.«
»Und wie geht es den Leuten jetzt?«
»Sechs Personen geht es den Umständen entsprechend gut; vier sind in kritischem Zustand,...«
»Halt, das sind doch erst zehn.«
»... und ein Mann ist verstorben.«
Der Tote war Brewster Baskett, siebenundsiebzig, aus Winnemucca, Nevada. Brewster und seine Frau Hallie hatten ihren Sohn und ihre Schwiegertochter besucht. Brewster hatte sich gleich am ersten Wochenende eine Grippe geholt und ein paar Tage im Bett verbracht. Der Ausflug zum Full Fathom Five war seine erste Unternehmung nach der Krankheit. Hallie meinte, es gehe ihm noch nicht gut genug, aber er wollte unbedingt mal raus. Ein Arzt des Krankenhauses glaubte, Brewster hätte die Vergiftung wohl überlebt, wäre er nicht durch die Grippe geschwächt gewesen.
»Wie konnte so etwas passieren, Inspector?«
»Das ist Gegenstand der Untersuchungen.«
»Glaubt die Polizei, daß eine absichtliche Vergiftung vorliegt?«
»Auch das ist Gegenstand der Untersuchungen.«
Ich war froh, daß ich mitgekommen war. Falls ich Rob je für ungeduldig oder aufdringlich gehalten hatte: im Vergleich mit seinen Reporterkollegen, insbesondere den Vertretern der elektronischen Medien, war er ein Ausbund an Höflichkeit. Wir hatten uns bei einer Pressekonferenz kennengelernt – eine, die ich veranstaltete –, und er war der einzige Reporter gewesen, der sich nicht wie eine Wespe am Kaffeetisch benahm. In diesem Augenblick war er ganz still, während seine Brüder und Schwestern ihre Stimmbänder strapazierten. Still wie eine Mausefalle.
Als alle, auch Martinez, den Raum verlassen hatten, schlenderte er mit mir in den Flur und wartete neben dem netten Inspector auf den Fahrstuhl. Kaum waren wir drei im Lift, sagte Rob: »Na, haben Sie Lou Zimbardo schon erwischt?«
Martinez war so entsetzt, daß er nur: »Was wissen Sie über Zimbardo?« stammeln konnte.
»Glauben Sie, daß er der Trapper ist?«
»Ich weiß ja nicht mal, ob es den Trapper gibt.«
»Er könnte es sein. Und wenn er’s ist, dann wissen Sie es, weil ich es Ihnen erzählt habe. Also, wie ist es mit einer kleinen Gefälligkeit für mich?«
»Okay, okay. Als die Polizei kam, war er verschwunden. Durch die Hintertür wahrscheinlich. Keiner hat ihn abhauen sehen, er war einfach weg. Noch was?«
»Hm. Was Neues über Miranda Warning?«
»Über wen?« Martinez stieg im ersten Stock aus.
Wir fuhren ins Erdgeschoß und gingen zum Auto. Ich zurrte den Gurt fest und räkelte mich gemütlich bei der Vorstellung, jetzt nach Calistoga zu fahren. »Ich glaube, ich fahre besser nicht«, sagte Rob plötzlich.
»Nicht nach Calistoga? Warum nicht? Ist dir nicht gut?«
»Nein, nein, so ist es nicht. Ich muß mal allein sein.«
»Allein sein!«
»Was ist denn schlecht daran? Das sagst du doch auch dauernd.«
»Aber ich sage es, bevor ich eine Einladung ablehne, und nicht, wenn ich schon irgendwohin unterwegs bin.«
Er zuckte die Achseln. »Tut mir leid. Ich habe nicht vorausgeahnt, daß ich mich jetzt so fühlen würde.«
Er fuhr mich nach Hause. Wir bogen in die Green Street ein; er war wirklich fest entschlossen. Ich war so tief gekränkt, daß mir die Worte fehlten.
Er streichelte besänftigend mein Bein. »Bist du sehr sauer?«
»Ich glaube schon. Regelrecht vor den Kopf gestoßen.«
»Du nimmst das doch nicht persönlich, Rebecca? Es hat nichts mit dir zu tun.«
»Wirklich nicht?«
»Natürlich nicht! Ich kann einfach nicht. Wie wär’s mit nächster Woche?« Er hielt vor meiner Haustür.
Ich nickte und stieg aus, ohne ihm einen Abschiedskuß zu geben. Oben, in meiner Wohnung, ließ ich mich aufs Sofa fallen und betrachtete das Aquarium wie einen Film im Kino. Ich hatte gerade ein paar tolle Fische erstanden, Feenbuntbarsche, die sich hoffentlich halten würden. Sie bewegten sich zwischen den Wasserpflanzen graziös wie russische Ballettänzer, das heißt, noch viel graziöser. Die Einsiedlerkrebse konnten mich heute nicht zum Lachen bringen. Die Seeanemonen, meine Lieblinge, streckten sich wie stets nach Dingen außerhalb ihrer Reichweite und erinnerten mich unfroh an das menschliche Streben. Ich sah ihnen zu, um nicht daran zu denken, wie Rob mich gekränkt hatte. Aber es funktionierte nicht. Er sagte, sein plötzliches Bedürfnis nach Alleinsein habe nichts mit mir zu tun, aber es blieb eine Tatsache, daß er mit mir im Moment nicht Zusammensein wollte.
Natürlich will jeder mal allein sein. Aber diese beiläufige Art, in der er mich abwies, als habe er erst in dem Moment die Entscheidung getroffen, deutete darauf hin, daß die Sache tiefer ging. Wahrscheinlich hatte er das nächste Wochenende nur vorgeschlagen, um mir nicht offen sagen zu müssen, daß es aus war zwischen uns. Was hatte ich falsch gemacht? Das herauszufinden wäre kein Vergnügen. Selbstmitleid war da schon besser, und ich suhlte mich genüßlich darin. Dann fiel mir ein, daß wir abends mit Chris und Bob und einem Freund von ihnen verabredet waren – das machte den Schmerz noch ekliger.
Hatte Rob das Treffen vergessen, oder würde er kommen? Eine gute Ausrede, ihn anzurufen. Aber es meldete sich nur sein Anrufbeantworter: »Hier ist Rob Burns. Ich bin das ganze Wochenende außer Haus. Wenn Sie mir eine Nachricht hinterlassen wollen, sprechen Sie nach dem Pfeifton.« Lange vor dem Pfeifton legte ich unsanft auf, schmiß mich in meine graue Wildlederjacke und fuhr mit meinem alten grauen Volvo zu Loehmann’s.
Ein Einkaufsbummel heilt zwar keinen Liebeskummer, lenkt aber ab. Nach einer bittersüßen Dreiviertelstunde fand ich ein Sommerkleid aus Leinen, von zweihundert auf einhundertfünfundzwanzig Dollar heruntergesetzt. Ein hübsches Kleid: grau wie meine Jacke, mein Auto und meine Stimmung.
Also gut; wenn neue Klamotten nicht halfen, dann vielleicht ein Gespräch von Frau zu Frau. Leider stand zwischen mir und meiner mitfühlenden Schwester ein lästiger Mann. Alan saß auf ihrer winzigen Terrasse in der Sonne und trank Tee.
»Hi, Chef. Willst du dem Bräutigam gratulieren?«
»Hast du sie rumgekriegt?«
»Sie konnte mir noch nie widerstehen.«
»Mach keine Witze? Sie will dich heiraten?« Mir sackte das Blut aus dem Kopf.
»He, Schwägerin, was ist los? Du scheinst nicht so glücklich, wie ich erwartete.«
Ich lehnte mich an die Wand, ganz weich in den Knien.
»Mickey! Mickey! Komm mal – deiner Schwester ist schlecht!«
Nur schnell die Fassung wiedergewinnen und Freude heucheln. Eines Tages würde ich Kruzick umbringen.
»Rebecca!« Mickey kam herausgestürmt. »Was ist los?«
Ich richtete mich auf, ließ die Wand los und versuchte mir ein Lächeln abzuringen. »Ich war nur so überrascht, weißt du. Aber, Liebes, ich find’s wunderbar, ehrlich. Ich könnte mich nicht heftiger freuen ...«
Sie wirkte total verblüfft. »Freuen? Worüber?«
»Ich dachte ... Das heißt, Alan hat gesagt ...«
»Ich gehe Milch holen.« Alan sauste davon.
»Was hat Alan gesagt?«
»Er hat gewissermaßen angedeutet, daß ihr zwei geheiratet habt.«
»Oh – haben wir aber nicht – willst du nicht reinkommen?«
Ich wollte. Drinnen ließ ich mich auf das Korbsofa fallen und hielt Lulu, die Katze, davon ab, es zu Spänen zu verarbeiten. Mickey machte Tee und setzte sich zu mir. Sie sah gut aus. Sie war immer die Schlankere und Geschmeidigere von uns beiden gewesen – zugegebenermaßen auch die Hübschere; sie sah rosig und gesund aus. Schwangersein bekam ihr gut.
»Ich jogge jeden Tag drei Meilen«, erklärte sie. »Eine unverheiratete Mutter muß auf alles gefaßt sein.«
»Du heiratest ihn also nicht?«
»Warum sollte ich? Unsere Beziehung ist gut, warum soll ich sie zerstören?«
»Vielleicht möchte Alan ein paar Rechte in bezug auf sein Kind haben. Außerdem schneidet Mom sich die Pulsadern auf, wenn ihr nicht heiratet.«
»Aber was ist, wenn ich einfach nicht heiraten will?«
»Offen gesagt, Mickey, verstehe ich dich nicht. Du lebst mit dem Typen zusammen. Aus mir unerfindlichen Gründen liebst du ihn, das stimmt doch?«
»Ja.«
»Und du bekommst von ihm ein Kind. Warum ihn dann nicht heiraten?«
»Was hast du denn, Rebecca? Von dir hätte ich am allerwenigsten erwartet, daß du mich zum Heiraten zu überreden versuchst. Du bist ja fast in Ohnmacht gefallen, als er dich damit aufzog. Ich habe dein Gesicht gesehen – du warst so bleich wie Lulu.«
In dieser Sekunde sprang die schneeweiße, bildschöne Lulu auf meinen Schoß. »Ich will dich nicht überreden. Ich versuche nur durchzublicken.«
»Okay, ich bin mir eben nicht ganz sicher.«
»Nicht sicher, ob du ihn liebst?«
»Aber hör mal – keine Frau könnte mit ihm zusammenleben, wenn sie ihn nicht liebte. Das ist es nicht gerade ...«
»Aber du weißt nicht, ob du ihn heftig genug liebst?«
»Genau, das ist es. Ich liebe ihn, aber ...«
Alan kam zur Tür rein: »›... aber wirst du mich noch lieben, wenn ich vierundsechzig bin‹? Sicher wirst du das, Baby. Schau auf dieses Gesicht – wer würde es nicht lieben? Rebecca antworte nicht.« Er stellte die Milch in den Kühlschrank. »Ich gehe Basketball spielen.«
»Er hat einen gewissen jungenhaften Charme«, sagte ich und kraulte Lulus Ohren, »wenn man auf Sechsjährige steht.«
Mickey nickte. »Der könnte sich in zwanzig, dreißig Jahren ganz schön abnutzen.«
»Eher nach zwanzig, dreißig Minuten, würde ich sagen. Bei über einer Stunde kannst du ihn auch heiraten.«
Mickey lachte. »Wie steht’s mit Rob und dir?«
»Wer das Thema wechselt, kriegt keine Schwierigkeiten.«
»Habt ihr euch gezankt?«
»Ich glaube eher, er hat mit mir Schluß gemacht.«
»Wow. Erzähl mal, der Reihe nach.«
Ich erzählte, vom Trapper, von den Vergiftungen, von der Pressekonferenz, und es dauerte erstaunlich lange, bis ich zur Abschiedsszene kam. »Er hat nicht Schluß gemacht, auf gar keinen Fall«, sagte Mickey.
Ihre Theorie war ganz einfach. Rob, eigentlich der netteste aller Menschen, verwandelte sich, wenn er an einer brandheißen Geschichte dran war, in einen Werwolf – unter Mißachtung von Freundschaft, Liebe, sozialen Pflichten, Verabredungen und Versprechen. Er hatte mich nicht ausrangiert, sondern würde bald zurückkommen und nicht einmal merken, daß er mir gefehlt hatte. Kurz und gut – ich machte mir Sorgen wegen nichts.
Schon ging es mir besser. »Du hast wahrscheinlich recht«, sagte ich. »Ich sollte dankbar sein, daß er nicht Alan ist.«
»Oh, laß Alan in Frieden. Er könnte immer noch dein Schwager werden.«
»Bist du dir sicher, was das Baby angeht?«
»Hundert Prozent.«
»Die Welt ist schon verrückt, nicht? Kein Wunder, daß Mom Anpassungsschwierigkeiten hat.«
Mickey drohte mir spielerisch. »Sie wäre sehr viel glücklicher, wenn du dieses blauäugige Halbblut aufgäbest.«
Ich fuhr lachend nach Hause. Arme Mom. Sie hatte in der Tat Anpassungsschwierigkeiten. Es stimmte – Rob war Halbjude und deshalb in ihren Augen auch nur halb tauglich. Sie nannte ihn in einem Atemzug mit dem Ku-Klux-Klan. Sogar vor sich selbst. Mom war mitfühlend, fürsorglich, politisch liberal, mit einem ewig blutenden Herzen ausgestattet, woran die acht oder zehn schlimmen Vorurteile schuld waren, von deren Vorhandensein in ihrer Seele sie nichts ahnte. Sie wußte allerdings ganz genau, daß sie den Freund ihrer älteren Tochter nicht leiden konnte; als ich daran dachte, wallten in mir Beschützergefühle auf, und ich verzieh Rob.
Bis ich dann wieder zu Hause war und merkte, daß der Schweinehund nicht mal angerufen hatte. Bei ihm meldete sich wie gehabt der Anrufbeantworter: Rob sei übers Wochenende nicht da. Ich mußte mich darauf einstellen, allein zu der Verabredung zu gehen.