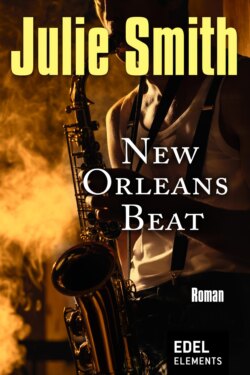Читать книгу New Orleans Beat - Julie Smith - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6
ОглавлениеSkip mußte sich also noch einmal an Eileen wenden. Sie fragte sie nach Randolph. Es stellte sich heraus, daß er schon lange nicht mehr bei der Zeitung war. Also sahen sie wieder im Archiv nach und fanden nur einen einzigen Bericht, der etwas hergab – über seine Hochzeit mit Honey Diefenthal. Aus dem Artikel ging deutlich hervor, daß die Braut eine Dame der Gesellschaft war. Was einen weiteren Anruf bei Alison bedeutete.
»Honey Diefenthal! Aber natürlich – die Marguerite-Connection!«
»Warte mal, jetzt komme ich nicht mehr mit.«
»Honey würde dir gefallen. Wirklich. Sie hat Haare auf den Zähnen, einen ganzen Pelz. Sie ist eine gute Freundin von Mom – sie haben bei Wohltätigkeitsaktionen zusammengearbeitet. Eines Tages haben sie bei einem Sherry zusammengesessen – oder vermutlich war es eher Gin Tonic – und sich über die guten alten Zeiten unterhalten. Honey hat geschworen, sie sei mal ein Hippie gewesen, und Mutter meinte, sie habe nie welche gekannt, es sei denn, man zählte Marguerite Julian mit, die sie nicht wirklich kannte, und Honey gestand, daß sie Marguerite damals regelrecht angebetet habe – ihr überallhin gefolgt sei wie eine kleine Schwester.« Alison holte Luft. »Faszinierend, findest du nicht? Und jetzt wissen wir, daß sie den Mann geheiratet hat, der über den Mord an Marguerites Mann berichtete. Glaubst du, Marguerite hat die beiden miteinander bekannt gemacht?«
»Das fragst du mich?«
»Selbst Alison die Allergrößte ist nicht allwissend. Und jetzt erteile ich dir einen Auftrag: Zieh los und finde es für mich heraus.«
»Versprochen. Sind sie noch verheiratet?«
»O Gott, nein. Das gehört einem anderen Erdzeitalter an. Ich bin nicht mal sicher, ob Honey im Augenblick überhaupt verheiratet ist, und ich hab nicht die geringste Ahnung, was Pearce angeht, über den ich, nebenbei bemerkt, sowieso nichts weiß.«
»Das bedeutet ja wohl, daß er ein Niemand ist.«
»Das nehme ich ernstlich übel, Skip Langdon. Du hast es hier mit einem Profi zu tun, vergiß das nicht. Ich tratsche rund um die Uhr und ebenso begeistert über Leute, die, wie du schäbigerweise behauptest, niemand sind, wie über Di und Fergie. Honey auch, falls ich das noch anmerken darf. An deiner Stelle würde ich sie mal anrufen.«
Als nächstes überprüfte Skip, ob Akten über Pearce, Marguerite und Honey vorlagen, und dann informierte sie Sylvia Cappello über das Neueste. Ihre Vorgesetzte runzelte die Stirn, als glaubte sie kein Wort von dem, was Skip da erzählte. »Jetzt mal ganz langsam: Dieser Pearce Randolph ist Bigeasy, ja?«
»Genau. Was ist daran so wichtig?«
»Arbeitet er immer noch als Journalist?«
»Schon lange im Ruhestand. Wieso?«
»Weil er mich gerade angerufen hat – er hat behauptet, er schreibt einen Bericht über den Mord an Geoff Kavanagh.«
»Huch! Ich werde wohl am besten gleich mal mit ihm reden.«
Aber nicht sofort, meinte sie. Zuerst hielt sie sich an Alisons Rat und versuchte, Honey zu erreichen. Aber Honey war nicht zu Hause, und es ging auf Mittag zu. Also rief sie ihre Freundin Cindy Lou Wootten an, die berühmt-berüchtigte Psychologin, und lud sie zum Mittagessen ein.
Cindy Lou war einer der Menschen, mit denen Skip am liebsten zusammen war. Zum einen schaute sie sie einfach gern an – die Frau sah hinreißend aus. Und zum anderen konnte sie viel von ihr lernen, denn Cindy Lou hatte vor nichts und niemandem Angst. Das schloß selbst Frank O’Rourke ein, Skips Kollegen aus dem Morddezernat, der Frauen im allgemeinen und Skip im besonderen haßte.
Cindy Lou war beinahe vollkommen, und es hätte vielleicht die Gefahr bestanden, daß Skip sie mehr beneidet hätte, als einer Freundschaft zuträglich war, wenn Cindy Lou nicht einen allzumenschlichen Fehler gehabt hätte: Was Männer anging, war sie hoffnungslos. Sie hatte vermutlich viermal so viele Freunde gehabt wie Skip und zehnmal so viele Verehrer, aber jedesmal erwischte sie wieder mit traumwandlerischer Sicherheit den absolut falschen, und es schien ihr nicht mal was auszumachen: »Ich weiß, ich bin Psychologin«, sagte sie dann immer, »aber ich kann nicht dagegen an, ich hab einfach einen schlechten Geschmack.«
Sie trafen sich in einem kleinen Restaurant in der Dante Street, wo man in jeder Art Kleidung eingelassen wurde, aber Skip wurde sich doch ihrer langweiligen Blazer-Rock-Kombination unangenehm bewußt, als Cindy Lou in einem goldfarbenen, taillierten Kostüm erschien. Wie immer sah sie aus, als wäre sie soeben den Seiten der Vogue entsprungen. Sie war schwarz und trug gern Farben, die ihren Hautton unterstrichen. Und es störte auch nicht gerade, daß sie Größe 36 hatte, weiches, schulterlanges Haar und feingemeißelte Gesichtszüge.
Skip kam sich in ihrer Gegenwart immer wie ein Elch vor, obwohl Cindy Lou von weitem erstaunlich groß wirkte. Als Skip sie zum erstenmal gesehen hatte, vor einem ganzen Zimmer voller Cops, hatte sie wie eins fünfundsiebzig gewirkt.
Heute machte Cindy Lou trotz ihrer eleganten Aufmachung den Eindruck eines Teenagers, der auf Schabernack aus ist. »Rate mal, mit wem ich mich heute treffe.«
»O Gott. Vermutlich mit dem Gouverneur.«
»Falsch.« Sie nannte einen Namen, den Skip nicht kannte. »Bist du etwa kein Fan der Saints?«
»Oje, bloß keinen Sportler! So einer zerquetscht dich doch schon aus Versehen beim ersten Kuß.«
»Ich mag starke Männer. Du nicht?«
»Für mich ist das mit der Größe eine ganz andere Sache, das weißt du genau.«
»Du hast doch bestimmt schon Fotos von ihm gesehen, oder?«
»Ich weiß nicht, ich hab keine Ahnung von Sport – ich würde nicht mal ein Foto von Joe Montana erkennen.«
»Versprich, daß du dir eins ansiehst. Du mußt unbedingt wissen, wie süß er ist.«
Skip seufzte. »Cindy Lou, du benimmst dich wie ein Teenager. Du bist so hinreißend, so brillant, du könntest doch jeden kriegen.«
»Das hat nichts mit Berühmtheit und so zu tun, aber du ziehst mich doch immer wegen meines schlechten Geschmacks auf, also will ich, daß du siehst, daß diesmal wenigstens das Äußere stimmt.«
»Er ist verheiratet, nehme ich an?«
»O ja. Und ich bin sicher, sie weiß ganz genau, was für ein Schlawiner er ist.«
Skip verdrehte die Augen. »Ich kann nur hoffen, daß du wenigstens Safe Sex praktizierst.«
»Hallo«, sagte Cindy Lou zu der Kellnerin, die gerade an den Tisch getreten war. Sie und Skip warfen einen kurzen Blick auf die Speisekarte und bestellten Salate.
»Also, was Sex angeht«, meinte Cindy Lou anschließend, »hatte ich nicht vor, es überhaupt so weit kommen zu lassen. Nur diese eine Verabredung – nur zum Spaß –, und das war’s.«
»Weil er verheiratet ist? Solche Skrupel hattest du doch früher nie?«
»Hab ich jetzt auch nicht. Schau mal aus dem Fenster. Siehst du das Auto, das aussieht wie eine Tüte aus Packpapier? Und den kleinen Kerl, der drin hockt? Mrs. Saint läßt mich überwachen.«
Skip sah nach draußen und bemerkte nicht, daß die Kellnerin wieder zurückgekommen war. »Äh – entschuldigen Sie...«, sagte die Frau.
»Ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch Hunger habe.«
Die Kellnerin schaute verwirrt drein.
»Schon gut – ich bin nur durcheinander. Cindy Lou, spinnst du?« Die Kellnerin ging wieder.
»Ich bin Psychologin, Mädchen. Wie könnte ich verrückt sein?«
Irgendwie, das mußte Skip zugeben, genoß sie ja diese Ansammlung von Flaschen, die ihre Freundin hinter sich herzog – es war, wie wenn man ein Buch von Dick Francis las, nur um zu sehen, wie er es immer wieder schaffte, Pferde ins Spiel zu bringen. Jeder neue Kandidat eröffnete weitere, nie gekannte Dimensionen des Unerträglichen. Skip sorgte sich um ihre Freundin, aber sie mußte auch zugeben, daß Cindy Lou von allen Frauen, die sie kannte, am besten auf sich selbst aufpassen konnte.
Sie goß sich Dressing auf ihren Salat. »Darf ich mal was fragen? Wieso triffst du dich überhaupt mit ihm? Es könnte übel ausgehen, und die ganze Sache hat eh keine Zukunft, also was soll’s?«
»Du vergißt, daß ich aus Detroit komme. Gefahr gehört für mich zum Leben. Und außerdem wird es Spaß machen, ihn über den Tisch hinweg anzusehen, und vielleicht läßt er sich ja eines Tages scheiden.«
»Und dann erinnert er sich an dieses reizende Geschöpf, das sich ihm aus moralischen Gründen verweigert hat – so wirst du es doch sicher begründen.«
»Aber selbstverständlich. Doch genug von mir – da du zahlst, nehme ich an, daß du meinen fachlichen Rat brauchst.«
Skip gab ihr einen kurzen Abriß des Falles. Als sie damit fertig war, hatten sie auch die Salate verputzt. Sie bestellten Kaffee.
Cindy Lou schaute verträumt drein. »Mann, ich wünschte, ich hätte mal mit dem Jungen reden können. Mit Geoff.«
»Er war kein Junge mehr, er war Anfang Dreißig.«
»Ja, aber eigentlich war er noch ein Kind. Das ist doch auch dein Eindruck, oder?«
»Wahrscheinlich. In vielem war er der typische Außenseiter, aber ich kann einfach nicht herausfinden, was darüber hinaus seine Persönlichkeit ausmachte.«
»Vielleicht konnte er sich nicht weiterentwickeln, ehe er mit dieser Erinnerung zurechtgekommen war. Ein ewiger Vierjähriger, der Angst vor der Welt hatte wegen dem, was sie seinem Daddy angetan hat.«
»Du glaubst also, er könnte etwas gesehen haben?«
»Aber sicher. So ist das, wenn Erinnerungen sich wieder einstellen – immer ein bißchen auf einmal. Das hat er doch auch gesagt, oder?«
»Er hat es im Netzwerk breitgetreten.«
»Er war so isoliert, daß er nicht mal darüber reden konnte, sondern nur schreiben.«
»Das wissen wir nicht genau. Er hat vielleicht mit Lenore und Layne darüber gesprochen – oder mit anderen.«
»Wenn er sich also an ein Gesicht erinnert hat, könnte es sein, daß er es jemandem gegenüber erwähnt hat.«
»Immerhin hatte er Stimmbänder.«
»Ach, hör doch auf. Männer haben auch Herzen, und trotzdem sind viele völlig herzlos.«
»Dafür bist du die Expertin. Natürlich könnte er es jemandem gesagt haben – er hat vielleicht sogar versucht, den Mörder zu erpressen.«
»Irgendwie hab ich da meine Zweifel, so wie du den Typ beschrieben hast. Ob er wohl Tagebuch geführt hat?«
»Was?« Skip horchte auf.
»Das tun Leute oft, wenn sie sich etwas wieder ins Bewußtsein bringen wollen. Besonders, wenn sie Träume haben – und bei seinem ersten Bericht in der TOWN ging es doch um einen Traum.«
»Warte mal – diese Sache mit dem Tagebuch. Das wußte ich nicht. Würde denn ein normaler Mensch so was tun?«
»Sicher, falls er jemals in Therapie gewesen ist. Aber ich denke, viele andere machen es auch – es hilft ihnen, ihre Gedanken zu ordnen. Vielleicht hat ihm sogar jemand aus der TOWN dazu geraten.«
»Möglich. Sie sind ja alle so hilfsbereit! Aber ich habe nicht gesehen, daß es in einer Konferenz erwähnt worden wäre.«
»Und wie sieht es mit E-Mail aus?«
»Da bin ich nicht sicher; der Sysop ist nicht besonders hilfreich. Weißt du, was ein Sysop ist?«
»Klar doch. Ich hänge am Internet.«
»Wobei mir gerade einfällt, daß er ein paar Bücher über Selbsthypnose hatte.«
»Tatsächlich? Interessant. Vielleicht hat er versucht, auf diese Weise dranzukommen.«
»Die Sache ist die – falls er Tagebuch geführt hat...«
»Was?«
»Na ja, dann hat er das vermutlich im Computer getan, vielleicht sogar in einer privaten TOWN-Datei, eher als in einem Buch.«
»Dann weißt du ja schon, was du zu tun hast.« Cindy Lou griff nach ihrer Handtasche.
»Sag mir Bescheid, wenn du einem netten Mann vorgestellt werden willst.« Wo Skip einen finden sollte, wußte sie selbst nicht, aber das war auch gleich; dieser Satz gehörte einfach zu ihren üblichen Abschiedsfloskeln.
Cindy Lou zog die Nase kraus. »Erzähl mir nichts von netten Männern.« Das war die obligatorische Antwort. »Ach, übrigens, wie geht’s denn dem deinen?«
»Gut, nehme ich an. Aber er klang neulich ein bißchen komisch.«
»Komisch? Wieso denn?«
»Ich weiß nicht. Er hat eine Bemerkung gemacht, die ich nicht verstanden habe.«
»Was sind wir wieder empfindlich! Du solltest mehr ausgehen, weißt du das?«
»Sprichst du als Psychologin?«
»Als Freundin – vor allem als Freundin, die sich die Boucree Brothers anhören will. Bist du dabei?«
»Wann?«
»Sie spielen am Donnerstag im Blue Guitar.«
»Ich weiß nicht... dieser Fall...«
»Betrachte dich als verabredet.«
Skip dachte darüber nach. »Also gut. Komme was wolle.«
Es stimmte, daß sie beinahe gar nicht mehr ausging. So, wie sie sich ihren Fällen widmete, dachte sie auch kaum mehr daran – und jetzt, wo Sheila und Kenny da waren, schien es mehr Spaß zu machen, zu Hause zu bleiben.
Aber sie sind nicht meine Familie.
Das sagte sie sich oft; sie fühlte sich dazu verpflichtet, sich in dieser Hinsicht nichts vorzumachen, um nicht enttäuscht zu werden.
Sie beschloß, Honey Diefenthal persönlich aufzusuchen, statt sie anzurufen. Honey wohnte ganz in der Nähe, in einem wunderbar renovierten Camelback-Haus, das in einem zarten Pfirsichton gestrichen war.
Irgendwie mag ich sie jetzt schon, dachte Skip.
Honey – eindeutig gerade von einem Mittagessen zurück – trug Hosen aus schwarzem Wollkrepp und eine gestärkte rosafarbene Hemdbluse: elegante, aber lässige Kleidung, für die man keine große Phantasie aufwenden mußte und mit der man trotzdem immer großartig aussah.
Immer vorausgesetzt, man war Honey Diefenthal.
Sie war klein und zierlich, eine Eigenschaft, der Skip bestenfalls ambivalent gegenüberstand. Manchmal gab ihr ihre eigene Größe das Gefühl von Macht, aber manchmal kam sie sich auch einfach nur ungelenk vor, wie ein Strauß unter Kanarienvögeln.
Honey war nicht nur klein und zierlich, sondern auch so blond, wie ihr Name andeutete, mit einer Haut wie Seide, eine Südstaatlerin mit großem S. Sie trug ihr Haar fast militärisch kurz geschnitten, was bei anderen hart gewirkt hätte, bei ihr aber nur zart und kappenähnlich aussah. Skip beneidete sie um die Selbstsicherheit, eine solche Frisur zu tragen.
Sie stellte sich vor.
»Ach ja. Pearce meinte, Sie würden vielleicht vorbeikommen.«
»Pearce? Aber wir kennen uns nicht mal.« Skip spürte, wie Ärger in ihr aufflackerte – derselbe Ärger, den die TOWN und ihre »Bewohner« schon mehrmals geweckt hatten.
»Aber er kennt Sie. Er sagte, ich solle schon mal Tee und Gebäck für Sie bereitstellen. Kommen Sie doch rein.«
Skip betrat ein Zimmer voller Chintz und Licht; nicht unbedingt originell, aber das war nun mal die Art von Einrichtung, die zu einem solchen Haus paßte.
»Setzen Sie sich doch. Möchten Sie tatsächlich Tee?«
»Nein, danke, ich komme gerade vom Mittagessen. Wieso glaubt Pearce denn, daß ich Sie aufsuchen würde?«
»Um sich über ihn zu erkundigen, denke ich. Er gehört zu den Leuten, die sich immer ein bißchen zu wichtig nehmen.«
»Na ja, diesmal hat er sogar recht. Aber ich bin vor allem hier, weil Alison Gaillard meinte, ich solle Sie mir nicht entgehen lassen.«
»Alison! Woher um alles in der Welt kennen Sie sie?«
»Wir waren Verbindungsschwestern in Newcomb.«
»Ach, Sie sind die Kappa-Polizistin. Sie sind berüchtigt.« Sie hielt inne, bis der Groschen gefallen war. »Jetzt verstehe ich. Sie sind Elizabeth Langdons Mädel.«
Skip grinste.
»Ich kenne sie... sagen wir mal, vom Freundeskreis der Oper, und vielleicht auch vom Beirat der Kunsthochschule. Wir begegnen uns dauernd. Wir sind sozusagen in derselben Sparte tätig.«
»Berufsfreiwillige.«
Sie lachte. »Wir nennen uns lieber ›Aktivisten fürs Gemeinwohl‹.«
An solche Dinge war Skip gewöhnt. Sie war auf zwanzig Minuten »Wen-kennen-wir-denn-noch« gefaßt, und nachdem sie das hinter sich gebracht hatte, fragte sie nach Pearce. »Er muß ein netter Mensch sein, wenn Sie immer noch mit ihm befreundet sind.«
»Er ist ein ausgesprochen schrecklicher Mensch, und wir sind überhaupt nicht befreundet – er ruft mich nur an, um mich anzupumpen und mir seine Manuskripte vorzulesen. Wobei die erstere Art von Anrufen erheblich häufiger erfolgt als die letztere.«
Skip lachte.
»Und seien Sie bloß dankbar, ich könnte Ihnen ja jetzt von seinen Manuskripten erzählen, aber Sie haben vorhin erwähnt, daß Sie gerade gegessen haben.«
»Blutrünstig?«
Sie wurde ernst. »Einfach nur deprimierend. Er ist nicht unbegabt, er wird nur mit nichts so recht fertig.«
»So was ist vielleicht manchmal auch ziemlich zäh.«
»In gewissem Sinn ja. Wissen Sie, wie lang ein Drehbuch im Durchschnitt ist?«
»Ein paar hundert Seiten, nehme ich an.«
»Etwa hundertzwanzig. Überlegen Sie mal: Wenn man eine Seite pro Tag schriebe, könnte man eins in vier Monaten fertig haben.«
»Immer vorausgesetzt, man hat sich den Plot schon vorher überlegt.
»Also gut, sagen wir mal, dafür brauchen Sie noch sechs Monate. Und einen oder zwei für Recherchen. Dann könnte man es in einem Jahr machen. Dann will man es vielleicht noch umschreiben – schlagen wir noch mal sechs Monate drauf, oder seien wir großzügig: ein Jahr. Das macht dann zwei Jahre, eine ziemlich lange Zeit, wenn man kein Geld dafür bekommt. Einfach so für zwei Jahre freinehmen – meinen Sie nicht?«
Skip nickte, unsicher, um was es eigentlich ging.
»Aber Pearce sitzt seit siebzehn Jahren an einem. Das sind beinahe zwanzig Jahre für hundertzwanzig Seiten – für ein Projekt, das niemand je gewollt hat und auch niemand wollen wird. Und wenn doch, könnten sie es nicht kriegen, weil es nicht fertig ist. Und wenn es fertig wäre, wäre es eine andere Geschichte als die, die sie gekauft haben. Weil er es ununterbrochen ändert.« Sie seufzte. »Jede Woche hat er eine andere geniale Idee.«
»Kein Wunder, daß er Sie anpumpen muß.«
»Ach, der Mann ist einfach erbärmlich. Ein verbitterter alter Mann.«
»Alt? Ich dachte, er sei in Ihrem Alter?« So um die Fünfzig, nahm sie an.
»Er ist alt, alt, alt – vorzeitig gealtert, wissen Sie. Ein Mensch, der seine Möglichkeiten nie verwirklicht hat – er hätte tatsächlich Schriftsteller sein können. Oder Anwalt, um Himmels willen, oder Kautionsagent. Aber er ist gar nichts. Nichts ist ihm je gelungen. Und trotzdem möchte er anerkannt werden – das ist das Problem. Er erzählt allen, er sei Schriftsteller, und da er tatsächlich schreibt, glaubt er das sogar selbst, und er kann einfach nicht verstehen, daß er nicht anerkannt und bewundert wird. Was er unbedingt will. Ich glaube nicht mal, daß es ihm was ausmacht, kein Geld zu haben – er möchte einfach nur, daß sein Talent anerkannt wird.«
Sie hielt inne, um Luft zu holen. »Also schreibt er hier und da einen lumpigen Artikel wie den, an dem er gerade arbeitet, über den Mord an diesem jungen Mann. Und natürlich schreibt er in der TOWN. Ich nehme an, das ist auch eine Form von Schriftstellerei. Soweit ich weiß, sind die Leute da ganz begeistert von ihm.« Sie grinste boshaft. »Das ist auch viel einfacher, wenn man ihm nie begegnet ist. Man könnte ihn glatt für einen umwerfenden, geistreichen, welterfahrenen Mann halten und nicht für einen runtergekommenen alten Säufer.«
»Ist er denn Alkoholiker?«
»Ach, hatte ich das nicht erwähnt? Das ist vermutlich das Hauptproblem.«
»Das kann ich mir vorstellen.«
»Deshalb hab ich ihn auch rausgeschmissen.« Wieder zog sie die Nase kraus. »Deshalb und weil ich ihn nicht mehr ertragen konnte, nachdem ich rausgefunden hatte, was mit ihm los war. Sie wissen ja, wie manche Leute sich verstellen können?«
Skip nickte.
»Männer zum Beispiel – wenn sie versuchen, auf sich aufmerksam zu machen.«
»Was hat er denn behauptet zu sein?«
»Ach, ein netter Kerl. Liebenswert und großzügig. Rücksichtsvoll. Wer hätte sich da nicht in ihn verliebt?«
»Hört sich wirklich gut an.«
Hört sich an wie Steve, nur daß Steve echt ist.
Hoffe ich jedenfalls.
Honey zuckte die Achseln. »Er hat mich natürlich wegen meines Geldes geheiratet. Marguerite hat er immer viel mehr Aufmerksamkeit geschenkt – das hätte mir eigentlich auffallen müssen.«
»Marguerite? Geoffs Mutter?«
»Ich dachte einfach, er sei einer von diesen Männern, die immer mit den Freundinnen ihrer Frau flirten müssen – wissen Sie, was ich meine? New Orleans ist voll davon. Aber wenn ich es mir genau überlege, glaube ich eigentlich, daß er halbwegs in Marguerite verliebt war.«
Wieso erzählt sie mir das?
»Ich habe die letzte Zeit oft an sie gedacht und mich gefragt, was aus ihr geworden ist.«
»Sie hat einen Mann namens Coleman Terry geheiratet.«
»Haben Sie sie gesehen?« Etwas Unergründliches lag in ihrem Blick.
»Ja.«
Honey schwieg einen Augenblick und fällte dann einen Entschluß. Ihre Würde blieb dabei auf der Strecke. »Und?« fragte sie. »Wie sah sie aus?«
»Wie eine Frau, deren Sohn gerade gestorben ist, denke ich.« Skip versuchte, nicht voreingenommen zu klingen.
»Mein Gott, ich bin so gemein, ich kann es kaum glauben. Aber trotzdem, ich habe mich immer gefragt... Marguerite und Pearce, meine ich. Denn nach Leightons Tod, also, ich weiß nicht, was passiert ist – meine Freundschaft mit Marguerite ging sehr schnell zu Ende und meine Ehe auch.«
»Ich dachte eigentlich, Ihr Mann habe Marguerite vielleicht kennengelernt, als er über den Mord berichtete.«
»Nein, nein. Wir drei waren oft zusammen. Leighton war nicht gerade der Typ, mit dem man ins Las Casas tanzen ging. Mein Gott, damals war Pearce ein toller Kerl!
Aber ich nehme an, ich selbst war damals auch noch anders – bevor ich brav geworden bin. Ich hatte ein tolles Paar Omaschuhe, die ich golden angesprüht hatte.«
»Und Haare bis zum Hintern, nehme ich an.«
»Genau das. Ein Glas in einer Hand, ein Joint in der anderen.«
»Ich wünschte, ich wäre dabeigewesen.«
»Ach, vergessen Sie das, Liebes. Dann wären Sie heute nicht mehr jung.«
»Wie haben Sie Marguerite kennengelernt?«
»Lassen Sie mich mal überlegen.« Und einen Moment später fügte sie hinzu: »Wir haben sie singen gehört – im Dream Palace, glaube ich. Ich glaube, Pearce kannte sie schon, und er hat mich mit hingenommen – genau, so war’s. Er wollte mich beeindrucken.«
»Und Sie sind gleich gut miteinander ausgekommen?«
»O ja. Marguerite war wirklich wild. Ich hab sie schrecklich beneidet.«
»Wieso?«
»Wieso? Weil sich jeder Mann nach ihr umsah, wenn sie ins Zimmer kam.«
»Ach, kommen Sie, so schlecht sehen Sie wahrhaftig nicht aus.«
»Und weil sie alles mitgemacht hat.«
»Was zum Beispiel?«
»Na ja, ich glaube nicht, daß ich je gesehen hab, wie sie was wirklich Schlimmes tat – vielleicht hat sie auch mehr geredet als gehandelt. Oder es hing damit zusammen, daß sie mit diesem komischen Cop verheiratet war – nehmen Sie’s nicht persönlich. Wissen Sie von Leighton? So ein Spießbürger. Haare kürzer als meine heute. Jedenfalls hatte sie Leighton und einen kleinen Jungen, und trotzdem war sie jeden Abend unterwegs. Und sie hat gesungen! Alle lieben Künstlerinnen!«
»Und was ist nach Leightons Tod passiert?«
»Sie wollte – ich weiß nicht – sie wollte einfach nicht mehr mit uns zusammenkommen. Ich dachte damals, sie sei deprimiert. Aber vielleicht gab es auch noch etwas, von dem ich nichts wußte.«