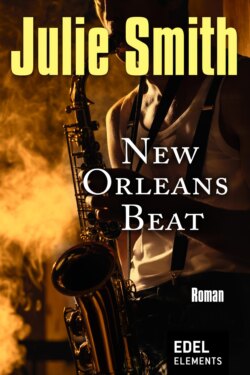Читать книгу New Orleans Beat - Julie Smith - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4
Оглавление»Mama, nein!«
»Was nein, mein Schatz?« fragte Lenore. Caitlin war in letzter Zeit sehr heikel gewesen.
»Bäh!«
»Magst du die Suppe nicht?«
»Will keine Suppe!«
Also konnte sie die Suppe vergessen und Nudeln kochen. Caitlin hatte sich jetzt schon fünf Tage lang von Nudeln ernährt. Im Kindergarten behaupteten sie, sie würde dort auch anderes essen, sogar hier und da etwas Gemüse, aber Lenore fürchtete trotzdem, sie könne von der stärkelastigen Ernährung blutarm werden und unter Vitaminmangel leiden.
»Eine Apfelsine zum Nachtisch?«
»Nein!«
»Doch.«
»Äh-äh.« Und um dem Standpunkt Nachdruck zu verleihen, schlug sie mit dem Löffel auf den Tisch.
»Du bist so niedlich, wenn du wütend bist.«
Das Kind starrte sie nur an, verstand nicht, was sie meinte. Oder sie verstand es und fand die Bemerkung genauso blöd wie Lenore selbst. Sie hatte eine plötzliche Anwandlung von Zärtlichkeit gespürt, als das Licht auf Caitlins verblüffend goldene Locken gefallen war.
Caitlins Vater war schwarz gewesen – ›war gewesen‹, denn Lenore hatte ihn nur einmal gesehen. Oder zumindest Kreole, mit ebensoviel weißem Blut wie schwarzem, aber doch ›schwarz‹. Ein schöner, großer Mann (so weit sie sich erinnern konnte), mit hellerem Haar als Lenores, aber nicht annähernd so hellem wie Caitlins; es war lockig wie Pudelfell und durchschossen von Goldfäden. Nicht blond, sondern pures Gold. Ihre Haut hatte die Farbe dunklen Nußbaumholzes, die schönste Hautfarbe, die Lenore je an einem Menschen gesehen hatte, und sie war mollig, mit winzigen Grübchen in Armen und Beinen.
»Na gut. Mom ist dumm, hm?«
»Ja. Ja!« Jetzt klang das Löffelklopfen entzückt, begeistert.
»Schatz, reg dich kurz vor dem Schlafengehen nicht mehr so auf. Komm, wir nehmen ein Bad, ja?«
»Nein!« Aber sie lächelte.
Eine halbe Stunde später steckte Caitlin in einem frischen weißen Nachthemd mit Mickey-Mouse-Gesichtern, und, erschöpft von einem harten Tag, fiel Lenore plötzlich auf, wie sehr ihr Geoff fehlte.
»Zeit zum Schlafengehen, Schatz.«
»Geschichte!«
»Nicht heute abend. Mama ist zu müde.«
»Nacht, Mond.«
»Richtig. Gute Nacht, Mond.«
»Lesen.«
»Ich habe nein gesagt, Caitlin«, erklärte sie mit Nachdruck.
Und urplötzlich öffneten sich die Schleusen. Verflucht! Bei der kleinsten Kleinigkeit fangen sie an zu heulen.
»Verflucht noch mal, Caitlin, sei still!«
Das brachte sie nur noch mehr zum Weinen.
Danach half nur noch, sie in den Arm zu nehmen und sanft zu wiegen, was Lenore auch tat, bis sie beide eingeschlafen waren. Erschrocken wachte Lenore schließlich wieder auf, froh, die Kleine im Schlaf nicht fallengelassen zu haben.
Sie legte Caitlin ins Bett, aber sie selbst konnte sich noch nicht hinlegen. Sie hatte noch etwas zu tun, viel zu tun.
Sie begann, die Sachen bereitzulegen – die schwarze Altardecke, schwarze Kerzen, den Kessel, das Ritualmesser mit dem schwarzen Griff. Sie war so müde...
Ein Bad. Das würde sie erfrischen, und es war ohnehin notwendig, um sich zu läutern, sich vorzubereiten. Sie hüllte sich in ihr schwarzes Gewand und gab Kräuter ins Wasser – Verbene, Majoran, Pfefferminze, Rosmarin – eine besonders wirksame Mischung; besonders heilkräftig vor allem.
Nach dem Bad entschied sie, das Gewand nicht wieder anzulegen. Sie wollte nur vom Himmel bekleidet arbeiten. Doch sie trug den Gürtel, an dem zauberkräftige Substanzen hingen, die immer noch aktiv waren, jede in einem kleinen Seiden- oder Lederbeutel, und um den Hals hängte sie sich ein Amulett, einen silbernen Drudenfuß an einer schwarzen Seidenschnur.
Sie suchte die vier Kerzen, die sie brauchte, um die Himmelsrichtungen anzurufen – gelb für Osten, rot für Süden, blau für Westen und grün für Norden. Sie legte Papier und Streichhölzer bereit – später würde sie etwas in ihrem Kessel verbrennen müssen. (Einige vertraten die Ansicht, der Kessel solle eine Tasse sein, die nie etwas anderes als Wasser enthalten dürfe. Lenore dachte da anders, sie brauchte richtiges Feuer.) Sie holte Wasser und Salz dazu, den Drudenfuß für den Altar, den Kelch. Und ein Messer mit weißem Griff, um damit Worte in die Kerzen zu ritzen, in die schwarzen. Und dann noch etwas – Drachenblut, um die Kerzen zu salben.
War das alles? Sie nahm es an.
Sie war erschöpft. Aber jetzt hatte sie alles zusammen, und die Beschwörungsformel hatte sie schon notiert.
Es war erst kurz nach Samhain, und der Schleier war noch dünn – sie konnte das Ziehen von der anderen Seite spüren. Sie spürte es oft in dieser Jahreszeit, aber jetzt ganz besonders, wegen Geoff, nahm sie an. Sie konnte nicht allein zurechtkommen; sie würde ihn wohl nie loswerden, sein schreckliches Gewicht, das auf ihren Schultern lastete, dieses Messer in ihrem Herzen. Aber was sie jetzt vorhatte, würde helfen.
Sie nahm das Messer mit dem schwarzen Griff.
Pearce Randolph genehmigte sich einen netten kleinen Schluck Bourbon und loggte sich dann in der TOWN ein. Das war ein abendliches Ritual geworden, das er inzwischen sehr genoß, um nicht zu sagen, über alles liebte.
Manchmal steckte er sich auch eine Zigarre an, paffte ein bißchen, rieb sich den schlaff werdenden Bauch und dachte selbstgefällig: Diese TOWN gehört mir, hier gelte ich etwas.
Natürlich mit einem gewissen Maß an Ironie. Pearce Randolph war alles andere als dumm – eine Tatsache, der er sich nur zu bewußt war und an die er sich, wenn nötig, hin und wieder selbst erinnerte. Aber trotzdem, irgendwie gefiel ihm dieser alberne Gedanke. Besonders, wenn er schon tief in das zum allabendlichen Ritual gehörende Bourbonglas geguckt hatte.
Aber er hatte auch ernsthaftere Gedanken, etwa: Verschwinde bis Sonnenuntergang aus der Stadt.
Und In dieser Stadt hast du deine letzte Mahlzeit gegessen.
Er hatte die Macht, Leute verschwinden zu lassen. Man liebte ihn in der TOWN. Mit Haß, mit Abneigung war hier nichts zu erreichen – so funktionierte die TOWN nicht. Nein, wenn sich eines dieser arroganten Arschlöcher blicken ließ, einer dieser gottverfluchten Klugscheißer, mußte man sie einfach übertreffen. Sie an die Wand spielen.
Sie machten mit, weil Konkurrenz sie aufblühen ließ, aber vor allem, weil sie immer ganz oben sein mußten. Also war die Linie für Pearce vorgegeben. Er war der Bürgermeister dieser gottverdammten Stadt, und das war nicht einfach, vor allem, da die meisten und lebhaftesten User in Kalifornien wohnten und sich tatsächlich persönlich kannten.
Darauf war er stolz, das machte ihm Spaß. Natürlich half es, daß er Berufsschriftsteller war, und worum es bei dieser ganzen Sache letztlich ging, war Schreiben.
Er konnte das Nötigste in einer halben Stunde erledigen, aber meistens verbrachte er eine ruhige Stunde, manchmal auch mehr, damit, hier ein Bonmot fallenzulassen, dort eine geistreiche Bemerkung einzuflechten. Zuerst in der »Stadthalle«, jedermanns Lieblingskonferenz. Wäre das hier keine TOWN, sondern eine COMPANY gewesen, hätten sich alle in der virtuellen Kantine getroffen. Und im Amerika des zwanzigsten Jahrhunderts gab es in der wirklichen Welt keine vergleichbaren Treffpunkte mehr. Was nach Pearces Ansicht die Überlegenheit der virtuellen Welt bewies. Man schaute herein, sagte guten Tag, erfuhr das Neueste, kabbelte sich ein bißchen und ging seiner Wege zu weiteren Konferenzen. Pearce liebte »Schreiben«, »Film«, »Bücher«, die »Beichte«, »Spiele«, »Das Unheimliche« und »Sex«, aber in letztere Konferenz schaltete er sich nie selbst ein, er kiebitzte nur. Es war amüsant, die phantasievollen Beiträge hier mit dem aufgeblasenen Getue derselben User bei anderen Themen zu vergleichen.
An diesem Abend übersprang Pearce »Sex«, »Spiele« und »Das Unheimliche«. Er war besonders versessen auf »Schreiben«, wegen der Gesellschaft anderer Autoren, und auf »Bücher« und »Film«, weil sich hier eine Menge Stoff für das bot, was er am besten konnte – Schreiben und Denken.
Aber an diesem Abend war er unkonzentriert. In der »Beichte« gab es unzweifelhaft die heißesten Dispute. Der arme Geoff war noch nicht mal kalt, und schon hatte die TOWN ihn in eine Spielfigur verwandelt. Trotzdem, Pearce mußte zugeben, daß Geoff jetzt ein wichtiger Bürger geworden war, was ihm sicher gefallen hätte. Im wirklichen Leben hatte er nicht viel zu melden gehabt, war nur ein Spinner gewesen, wie die meisten anderen in der TOWN auch.
Pearce tippte bei – »Beichte« – ein, und ging dann zu »Jüngst verzogen«. Aber am Ende wurde er enttäuscht: nichts wirklich Neues. Das letzte Unterthema »TOWN ohne Gnade« war ganz interessant, wenn man gern beobachtete, wie selbstgerechte Ärsche sich drehten und wanden. Natürlich waren hier sämtliche politisch korrekten »Wir-zeigen-euch-wo’s-langgeht-Typen« vertreten. Da er nicht in L. A., sondern in New Orleans wohnte, war Pearce ihnen nie begegnet, aber er wußte, mit wem er es zu tun hatte: Kerle mit knochigen Schultern und schmutzigen Jeans, Frauen mit fünfzig Pfund zuviel und verkniffenen kleinen Krötengesichtern. Es gab die PC-Typen und andere, die eine großartige Karriere im diplomatischen Dienst verpaßt hatten, als permanente Vertreter des Ministeriums für Sturm in Wassergläsern. Sie sonderten ununterbrochen Meldungen ab, die beschwichtigen sollten, aber nur dazu führten, daß man ihnen am liebsten den Hals umgedreht hätte: »Ich verstehe schon, worauf Lefty raus will, Bilious, aber ich frage mich, ob es nicht an der Zeit ist, das alles hinter uns zu lassen und interne Streitigkeiten zu begraben. Immerhin gibt es Wichtigeres zu tun.«
Sie schafften es tatsächlich, die PC-Typen noch zu übertreffen.
Zurück zu »Jüngst verzogen«. Wenigstens hatte Lenore heute nichts beigetragen. Mit das schlimmste an Geoffs Tod war nach Pearces Ansicht, daß er Lenore genau das Forum zur Selbstdarstellung geliefert hatte, das ihr noch fehlte. Insgeheim nannte er sie immer »die Stadtschreierin«. Wenn Lenore ein Problem hatte, wurde die gesamte TOWN konsultiert, und wenn es ihr an wirklichen Problemen mangelte, erfand sie welche.
Sie hatten sie schon durch eine ungewollte Schwangerschaft begleitet – »Soll ich abtreiben?« war eine Diskussion, die sie in der »Beichte« eröffnet hatte. Diese Frau hatte einfach kein Schamgefühl. Darauf folgte: »Sanfte Geburt oder nicht?« und ein scheinbar endloser Strom ichbezogener Dramen, die sich darum drehten, ob sie dem Vater des Kindes von dessen Existenz berichten und wie sie die Kleine nennen sollte, und natürlich um die Erfahrung der Mutterschaft: Sie hatte es gewußt, selbstverständlich, man hatte ihr davon erzählt, aber nie hätte sie sich vorstellen können ...
Genau. Das Offensichtliche immer zuerst. Das war Lenore.
Pearce hatte geholfen, »Jüngst verzogen« zu lancieren, und zwar mit großem Vergnügen (auch wenn es ihm zunächst eher wie reine Notwendigkeit erschienen war – er hatte mit jemandem sprechen müssen, selbst wenn er nicht wirklich sprach). Aber es machte Spaß, weil es ihm Gelegenheit bot, seine Überlegenheit zu demonstrieren. So etwas genoß er immer.
Trotzdem paßte ihm nicht, wie sich die ganze Sache entwickelt hatte. Diese Leute meinten es ernst. Es tat ihnen leid, daß Geoff tot war, und sie versuchten ernsthaft, etwas zu unternehmen (natürlich nur auf ihre jämmerliche beschränkte Art). Sie bildeten sich tatsächlich ein, einen Mordfall lösen zu können, indem sie einfach mit Hilfe der Elektronik aufeinander einschnatterten. Was amüsant hätte sein können, wenn es nicht so geschmacklos wäre, Trauernden geistreich zu begegnen, und Geist war nun mal Pearces Stärke.
Angewidert gab er EXIT ein. Es war vielleicht besser, den Computer zu dem Zweck zu benutzen, für den er ihn gekauft hatte.
Er öffnete eine Datei, die er »Klage« nannte und die vielleicht einmal Teil eines größeren Ganzen sein würde, er war sich noch nicht sicher. Er tippte die Jahreszahl 1967, und schon der Anblick der vier Ziffern erregte ihn, beschwor den Duft von Patchouli und Marihuanarauch herauf, den Klang von Hunderten von Kehlen, die Protestslogans skandierten, die Berührung Tausender schlanker Mädchen in Folkloreblusen, das Haar hüftlang und in der Mitte gescheitelt. Und die Schönste von allen war... nein, er konnte es nicht ertragen, an sie zu denken, noch nicht – nicht, ehe er ihren Auftritt vorbereitet hatte.
Er wühlte in seiner Plattensammlung – er hatte sie alle noch, ebenso wie seine alte Stereoanlage. Einen CD-Spieler würde er sich anschaffen, sobald er einen Roman oder zwei verkauft hatte. Oder sein Drehbuch. Wahrscheinlich hätte er lieber daran weiterarbeiten sollen – jeder wußte, daß es einfacher ging, schneller und mehr Geld brachte. Aber in der letzten Zeit hatte er vor allem an dieser anderen Sache gearbeitet, an der »Klage« oder wie immer es heißen sollte. So war es immer bei ihm mit dem Schreiben; die Ideen trieben einfach heran und waren dann nicht mehr zu bremsen. Und wenn etwas rauswollte, gab er einfach nach.
Bob Dylan wäre angemessen, etwas in dieser Richtung. Aber er fand noch etwas Besseres – Jefferson Airplane: Surrealistic Pillow. Er fand den Titel, der von allen Musikstücken auf der Welt (Light my fire vielleicht ausgenommen) am besten geeignet war, 1967 für ihn heraufzubeschwören, das Jahr und seine Gefühle für sie. Die erste Zeile lautete: »Today I feel like pleasing you.«
Er goß sich noch einen Bourbon ein und machte sich ans Schreiben.
Sie war älter als ich, aber nicht viel. Neunundzwanzig, dachte ich, vielleicht auch dreißig, was mich merkwürdig erregte, denn das war natürlich über der Grenze. Es bedeutete, daß man ihr nicht trauen durfte. Aber Vertrauen war auch das Letzte, woran ich gedacht hätte, als ich sie da stehen sah, den Kopf von blauem Rauch umwirbelt, in einem Licht so grausam wie Napalm; und selbst so grell beleuchtet – eine Frau von geringerer Schönheit wäre zur Karikatur aus harten Linien und schlaffer Haut geworden –, strahlte sie so etwas wie tropische Üppigkeit aus, roch geradezu nach Ylang-Ylang oder Plumeria.
Ihr Haar wurde im Nacken von einem Gummiband zusammengehalten, aber so, daß es ihr weich über die Wangen fiel, und wenn sie den Kopf über ihre Gitarre senkte – so ernsthaft und konzentriert –, fiel ein Schatten über ihre Brust. Sie trug Jeans und eine weiße Folklorebluse. Ein Gürtel, eine Art Seil, zusammengeflochten mit etwas Geblümtem, war um ihre Taille gebunden, die Enden hingen an ihrer rechten Hüfte herunter. Derselbe Stoff, rosa Blüten auf gelbem Hintergrund, war als schmales Band an den Saum ihrer Jeans genäht.
Aber was an ihr als erstes auffiel, war die Art, wie sie die Gitarre hielt – wie einen Lover oder ein Kind, wie etwas, was sie unendlich liebte. Sie sang ein Volkslied aus den Appalachen, eine Ballade über einen treulosen Gatten und sein unseliges Verschwinden, nachdem er in den Wäldern etwas Seltsames entdeckt hatte –
Pearce starrte den Bildschirm an. Er konnte sich an jede Einzelheit ihrer Kleidung erinnern, ihre Miene, er wußte immer noch, wie lang ihre Nägel gewesen waren (kurz geschnitten), aber die Worte des Lieds wollten ihm nicht mehr einfallen. Was hatte der Mann im Wald entdeckt? Eine Elfe oder so was? Ein totes Tier? Deshalb war es immer so schwierig, weiterzukommen. Alles mußte genau stimmen. Er würde dieses Kapitel nicht abschließen können, ehe er den Liedtext nicht hatte. Er würde in die Bibliothek gehen und Nachforschungen anstellen müssen. Er markierte die Stelle mit einem Sternchen; es würde ihn morgen seine gesamte Freizeit kosten...
Doch seine Stimmung hielt an. Den Liedtext kannte er nicht, aber der Rest der Erinnerungen ließ sich nicht abschütteln. Zu seinem Erstaunen drängte immer noch mehr hervor.
Als ihr Auftritt vorüber war, spürte ich, wie trocken mein Mund war, die Zunge klebte mir am Gaumen, und ich konnte mich kaum rühren. Was, wenn sie nicht wiederkommen würde? Was, wenn ich sie nie mehr wiedersah?
Aber sie kam! Sie sang Wildwood Flower als Zugabe, und das erschien mir merkwürdig passend, als beschriebe sie sich selbst. Es weckte Erinnerungen an den Geruch von Moos, einen frühlingshaften Duft, etwas Geheimnisvolles, Zartes, Kurzlebiges, wie das, was der treulose Gatte im Wald gesehen hatte. Etwas Magisches, das verschwunden sein würde, wenn man auch nur blinzelte.
Wie sie.
Jetzt erkannte ich, wie sie wirklich war: Trotz ihrer Üppigkeit, ihrer stolzen tropischen Schönheit, war sie tief in ihrer Seele ein Geist, sie war Rima aus Das Vogelmädchen, oder vielleicht eine winzige geflügelte Kreatur aus dem Sommernachtstraum. Ihre Stimme verriet sie – so hoch, so klar, und so rein wie das Herz einer Nonne. Ich wußte, daß sie jetzt endgültig verschwinden würde, und das tat sie auch. Ein solches Wesen blieb nicht in der Bar und trank.
Und doch war es in einer Bar, als ich sie das nächste Mal sah – im Dream Palace in der Frenchman Street, wohin man sich 1967 begab, wenn man sich in gemischtrassige Gesellschaft wagen wollte, ein Stück Bohème, aber im Grunde sicher (wenn auch ein wenig laut). Es war eine dunkle, schäbige Höhle mit winzigen Kacheln am Boden und einem Himmelsfresko an der Decke.
Sie war mit Freunden dort, einem Mann und einer Frau. Alle drei trugen Jeans, und der Mann sah aus wie Jesus auf den Bildern in meiner Kinderbibel. Ich dachte, daß ein weiterer Mann dem Trio gerade noch fehlte, und ging selbstsicher auf sie zu, wie unter Drogen (was ich in diesem Moment nicht war).
»Bist du nicht Marguerite Kavanagh?« fragte ich und wunderte mich zum erstenmal darüber, daß ein so exotisches Geschöpf irischer Herkunft sein sollte.
»Ja.« Und sie lächelte mich an, als wisse sie, was als nächstes passieren würde.
»Ich habe dich singen gehört. Ich wollte nur sagen...« Ich verlor den Mut. »...Ich finde, du warst...«
»Ja?« Diesmal hatte sie einen neckenden Unterton.
Ich neige nicht zu Übertreibungen, und um ehrlich zu sein, fällt es mir schwer, Komplimente zu machen, ich halte mich lieber zurück. Und dennoch, nie in meinem Leben habe ich mich so verzweifelt danach gesehnt, akzeptiert zu werden.
»Du warst wunderbar«, sagte ich und hoffte nur, daß mein Adamsapfel nicht wild auf und ab hüpfte wie bei einem Idioten.
»Das ist sehr nett von dir.«
Der Mann neben ihr, der Jesus-Doppelgänger, zeigte beiläufig auf einen freien Stuhl. »Setz dich doch zu uns«, und ich schaute Marguerite an, um zu sehen, ob sie einverstanden war. Ich glaubte, etwas in ihrem Blick zu erkennen, was dagegen sprach, aber es sah mehr nach Angst als nach Ablehnung aus. Mir war das gleich, ich war sicher, ich würde sie von mir überzeugen können. Ich hätte mich auch hingesetzt, wenn die ganze Bar in diesem Augenblick in Flammen aufgegangen wäre.
Aber das Zögern in ihrem Blick oder was immer es gewesen war, wich sofort einem warmen Leuchten, dem Anfang eines Flirts. »Das hier ist Geordie«, sagte sie, »und das Joyce. Die beiden passen zusammen, nicht?«
»Aber wie!« sagte Geordie. Er hatte einen leichten britischen Akzent.
»Und wer bist du?« fragte Marguerite.
»Pearce Randolph«, sagte ich, denn ich wollte, daß sie Vor- und Nachnamen hörte, sich daran erinnern würde.
»Oh! Der Reporter.«
»Du kennst meine Artikel?« Ich plusterte mich ein bißchen auf.
Sie drehte ihr Glas, fixierte es, war verlegen. »Äh, nein, eigentlich nicht.« Sie sah mich wieder an. Herausfordernd. »Nur deinen Namen.«
»Ach?«
»Von meinem Mann.«
Etwas in mir starb.
»Mein Mann spricht manchmal von dir.«
Und da wußte ich, wer sie sein mußte, und ich bedauerte alles, was ich je getan hatte – Reporter zu werden, überhaupt geboren zu sein, und mit Sicherheit, mich jemals auf gewisse fruchtlose Recherchen über Korruption bei der Polizei eingelassen zu haben. Und trotzdem konnte ich es immer noch nicht glauben, konnte mir diese Verbindung einfach nicht vorstellen. »Leighton Kavanagh?« fragte ich. »Du bist mit Leighton Kavanagh verheiratet?«
Dieser Mann war ein Ungeheuer. Ein riesiger, häßlicher rothaariger Kerl mit Schultern, die eine Brücke getragen hätten, ekligen Sommersprossen von der Größe eines Pennys auf Armen und im Gesicht und so kurzem Haar, daß er es bestimmt mit dem Rasierer schnitt. Aber fett war er nicht; der Mann war in Form. Und ein Dickkopf – »der größte Dickschädel in Louisiana«, wenn man einigen seiner Kollegen glauben konnte, die mir, wenn ich es mir recht überlegte, mehr als einen Bären aufgebunden hatten. Aber trotzdem, wenn es je einen Fall von Die Schöne und das Biest gegeben hatte …
Sie stützte das Kinn auf die Hand, spielte mit dem Strohhalm, zum Flirten aufgelegt. »Aber sicher. Und einen niedlichen kleinen Sohn hab ich auch – möchtest du ein Foto von ihm sehen?«
Ich kam wieder auf die Beine. »Ich will nicht länger stören, ich bin sicher, ihr –«
»Geh nicht«, sagte sie.
Und ich blieb.