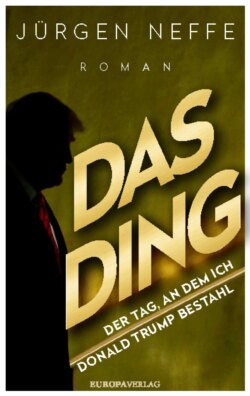Читать книгу Das Ding – Der Tag, an dem ich Donald Trump bestahl - Jurgen Neffe - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5 NACH WASHINGTON
ОглавлениеKeine zwei Wochen nach der Sause im Trump Tower stellte mir mein Vorzimmer ein Gespräch von dort durch. Ich entschuldigte mich bei der Anruferin, bislang noch nicht auf das freundliche Angebot ihres Chefs eingegangen zu sein. Der Stress mit dem Einrichten der Wohnung, wissen Sie, Kontoeröffnung, Behördengänge, Sozialversicherungsnummer und jede Menge Akkreditierungen. Das alles hätte mich noch voll im Griff.
Ich sagte nicht, dass ich bereits mit Arbeit eingedeckt war, mit Verve für meine ersten Artikel recherchierte und mir das Projekt Trump für ruhigere Zeiten aufbewahrt hatte. Dieses Thema, wenn es denn eines wäre, war zeitlos. Der mögliche Protagonist eines Porträts würde mir sicher auch nicht davonlaufen.
Die burschikose Frauenstimme, sie hatte sich mit ihrem vollständigen Namen und dem Zusatz »Trump Organisation« gemeldet, zerstreute meine Skrupel. Sie kenne das von ihrem Boss, der immer gleichzeitig mit vielen Dingen beschäftigt sei. Die Zusammenarbeit mit der Presse liege ihm jedoch sehr am Herzen. Deshalb habe er sie gebeten, einen Zeitpunkt zu vereinbaren, ihn in seinem Büro für ein erstes Vieraugengespräch aufzusuchen.
Sie schlug mehrere Tage und Uhrzeiten vor, ich ging meinen Kalender durch, wir fanden einen gemeinsamen Termin ungefähr vier Wochen später. Sie blieb auch freundlich, als ich die Vereinbarung dann kurzfristig verschieben musste. Mir war etwas dazwischengekommen, was sich andere Berichterstatter so bald nach ihrer Ankunft am Einsatzort vielleicht wünschen. Mir bereitete es vor allem Stress.
Zwei Tage vor Eröffnung der Olympischen Spiele in Atlanta, ich war in meiner sechsten Woche, ging eine Schreckensnachricht um die Welt. Ein Jumbojet der Fluggesellschaft TWA war kurz nach dem Start vom Kennedy-Airport in gut tausend Meter Höhe explodiert. Zweihundertdreißig Menschen verloren ihr Leben, darunter hundertzweiundvierzig Amerikaner.
Als einziger Journalist unseres Blattes vor Ort, ohne jede Erfahrung mit derartigen Situationen, musste ich reagieren. Ich begab mich per Taxi in die Nähe der Unglücksstelle an der Küste vor Long Island, wo ersten Berichten zufolge Trümmerteile, Gepäckstücke und Leichen im Meer trieben.
Dort traf ich auf einen Pulk von Pressevertretern, die einen Anwohner namens O’Reilly umringten. Der Bootsbesitzer habe, so hörte ich von den Kollegen, als Erster die Absturzstelle erreicht. Um ihn herrschte ein einziges Gedränge. Fernsehkameras waren eingeschaltet, Aufnahmegeräte wurden hochgehalten, Fotografen setzten ihn wie einen Prominenten dem stroboskopischen Feuer ihrer Blitzlichter aus. Unversehens war der Mann, der die Aufmerksamkeit genoss, in die Rolle eines Augenzeugen gerutscht, obwohl er erst Stunden nach dem Absturz eingetroffen war. Wir hatten ja sonst keinen. Er erzählte ein ums andere Mal die gleiche, seine einzige Geschichte mit immer neuen Ausschmückungen. Ob sie stimmte, wusste nur er. Er sei einer der Ersten gewesen, der mit seinem Boot die Absturzstelle erreicht hatte, eine halbe Stunde von der Küstenwachtstation East Moriches entfernt.
»Ich dachte, ich könnte noch jemanden retten«, sagte der Mann. Die Hoffnung erlosch, als er die Flammen aus brennendem Kerosin erblickte, die von der spiegelglatten Meeresoberfläche meterhoch ausschlugen. Hilflos musste er zusehen, wie Leichen ins Feuer trieben. Er schaffte es gerade noch, eine tote Frau aus dem Wasser zu ziehen.
Ich hielt die O-Töne fest, erkannte aber, dass ich hier die nötigen Informationen für meinen Bericht nie zusammenbekommen würde. Am Freitagmorgen musste ich einen Text in meine Redaktion kabeln. Wir hatten Mittwochnachmittag.
Also fuhr ich auf schnellstem Weg zurück in mein Büro und schaltete die Live-Übertragung ein. Jede Anstalt hatte andere Quellen, aber alle zeigten O’Reilly. Meine Mitarbeiterinnen sammelten und sortierten, was aus den Nachrichtentickern kam. Eine hörte Radio und stenografierte mit. Der Druck nahm zu und mit ihm der Berg an neuen, teils widersprüchlichen Informationen auf meinem Schreibtisch. Minütlich kamen neue hinzu.
Ich hatte für die nächsten Tage eigentlich andere wichtige Termine im Kalender. Am kommenden Nachmittag sollte ich im Trump Tower dessen Eigentümer treffen. Die Dame mit der festen Stimme zeigte angesichts der Ereignisse Verständnis für meine Bitte um Verschiebung. Am Freitagvormittag hatte ich eine Verabredung, die ich weder absagen wollte noch konnte – ein Treffen mit Präsident Clinton im Weißen Haus.
Als in der Nacht die Nachrichtenflut endlich etwas abebbte, ging ich heim, um ein wenig Ruhe zu finden. Am Donnerstagmorgen, zurück im Büro, sah ich mich erneut von einer gewaltigen Welle an Nachrichten und Neuigkeiten überrollt. Alle Gazetten hatten den Absturz auf der Titelseite, kein Blatt widerstand der Verlockung, über einen Anschlag zu spekulieren, jedes hatte andere Sachverhalte zusammengetragen.
Mehrere Augenzeugen hatten berichtet, zur fraglichen Zeit am Himmel über Long Island einen Feuerschweif gesehen zu haben. Das sprach für die These eines Abschusses durch eine Rakete. Keine der Radarmessstationen hatte jedoch eine solche Flugbewegung registriert.
Ich versuchte, die Flugsicherung ans Telefon zu bekommen. In diesen Stunden ein sinnloses Unterfangen. Statt ihrer erreichte ich Fachleute für Flugzeugtechnik und Havarien, in der Regel nüchtern urteilende Menschen. Sie lieferten mir Argumente sowohl für Probleme mit der Technik als auch für eine Terrorattacke.
Für die Version eines Anschlags sprach nicht zuletzt die unterschwellig grassierende, allgegenwärtige Angst. Schon lange vor der Katastrophe des 11. September 2001 hatten die Sicherheitsbehörden vor einer Terrorattacke erschreckenden Ausmaßes gegen die USA gewarnt.
Am Morgen des Absturzes war sowohl in London als auch in Washington in den Büros der saudi-arabischen Zeitung al-Hayat ein einschlägiges Telefax eingegangen. Das Schreiben enthielt zwar keine spezifischen Drohungen, kündigte aber an, »dass etwas geschehen wird, was die Amerikaner überraschen wird«. In New York stand in jenen Tagen überdies ein mutmaßlicher irakischer Terrorist vor Gericht. Die Anklage warf ihm und zwei Gesinnungsgenossen vor, sie hätten geplant, gleichzeitig elf amerikanische Flugzeuge über dem Pazifik zu sprengen.
Beim Flug TWA 800 handelte es sich außerdem nicht um eine Allerweltsverbindung. Der tägliche Service verband New York und Paris. Die beiden verstehen sich als Schwesterweltstädte, vereint im Geist ihrer Revolutionen im späten 18. Jahrhundert, verstärkt durch die Freiheitsstatue als Geschenk der Franzosen an die Amerikaner. Wer ein Passagierflugzeug in der Luft zerstören wollte, hätte sich kein symbolträchtigeres Ziel auswählen können als die Titanic der Lüfte, wie der havarierte Jumbo bald genannt wurde.
Immer wieder fiel ein Name: Lockerbie. Über dem schottischen Städtchen war kurz vor Weihnachten 1988 eine Maschine gleichen Typs der Fluggesellschaft Pan Am, Flug 103, in der Luft explodiert und abgestürzt. Zweihundertneunundfünfzig Insassen verloren ihr Leben, darunter hundertneunzig US-Bürger. Bis dahin die höchste Zahl an Zivilisten, die Amerika bei einem Terroranschlag verloren hatte.
Weniger als ein Pfund Semtex hatte gereicht, den Jet zu zerreißen. Der Plastiksprengstoff steckte in einem Radiorekorder und dieser in einer Tasche, die in Frankfurt eingecheckt worden war. So etwas, warnten Experten, könnte jederzeit wieder passieren.
Später wurden libysche Terroristen für die Tat verantwortlich gemacht. Der Untersuchungsbericht zum Absturz des TWA-Jets ging kaum ein Jahr nach dem Unglück jedoch von technischem Versagen aufgrund einer tragischen Verkettung ungünstiger Umstände aus. Das konnte in dem Augenblick aber noch niemand wissen.
Gegen Abend packte ich mein Recherchematerial in eine Reisetasche und nahm ein Taxi zum Flughafen La Guardia. Nach meiner Ankunft in Washington fuhr ich zu meiner Unterkunft. Ein befreundeter Kollege, der lange in der Hauptstadt tätig war, hatte mir den Tipp gegeben und angedeutet, Bill Clinton habe dort schon öfter seinen Geburtstag gefeiert.
Das Hotel, eine halbe Stunde Fußweg vom Amtssitz des Präsidenten entfernt, stand in keinem Verzeichnis. Es war von außen nicht als Herberge zu erkennen, sondern in unscheinbaren, im Innern miteinander verbundenen Reihenhäusern untergebracht. Es gab keinen Portier und auch keine Rezeption, wie man sie von gewöhnlichen Bettenhäusern kennt. Ich drückte den Klingelknopf neben der Eingangstür.
Eine Dame im feinen Kostüm mit hochgesteckter Frisur begrüßte mich. Sie bat mich, ihr zu folgen, und geleitete mich durch das Labyrinth ihres verwinkelten Reichs. Wir gingen an gerahmten Fotos vorbei. Auf einem erkannte ich im Vorübergehen tatsächlich Bill und Hillary, die dem Fotografen zuprosteten, auf einem anderen Mick Jagger.
Sie zeigte mir eine geräumige Küche, die als Frühstücksraum diente. Die Mahlzeit am Morgen werde gemeinsam am runden Tisch in der Mitte des Raums eingenommen, der mindestens fünfzehn Personen Platz bot. Das gehöre zur Tradition der Institution, bedeutende Menschen in ungezwungener Atmosphäre einander näherzubringen.
Da die Höflichkeit gebot, der Dame nicht den Stolz auf ihr Haus zu nehmen, hörte ich ihr noch eine Weile halb abwesend zu. Unverdrossen führte sie mich durch Suiten mit luxuriösesten Badelandschaften, allesamt Unikate in Grundriss und Inneneinrichtung – von Teppichen über Wandgemälde und Skulpturen bis hin zu den Deckenleuchten.
Ich ließ sie vorsichtig meine Ungeduld spüren und erklärte, bis zum Morgengrauen einen Artikel fertig schreiben zu müssen. Sie solle mir doch einfach ein Zimmer empfehlen und mir einen starken Kaffee bringen. Sie schlug die japanische Suite vor, in der wir gerade standen. Die verfüge als einzige sogar über ein Dampfbad.
Da war ich in das abgefahrenste Hotel meines Lebens geraten, wo ich mich ursprünglich entspannt auf meinen Besuch im Weißen Haus vorbereiten wollte, und hatte keine Ruhe, es zu genießen. Die Hausherrin übergab mir zu allem Überfluss eine Aufstellung sämtlicher in meinem Raum befindlicher Gegenstände. Jede Zeile endete mit einem Dollarbetrag, viele vier-, manche fünfstellig. Bevor ich auch nur denken konnte, das diene im Fall von Beschädigungen möglichem Regress, erklärte sie, jedes einzelne Teil könne käuflich erworben werden. Sollte mir etwas zusagen, würde es fachgerecht verpackt an jeden Ort der Welt versandt.
Ich versuchte sie höflich Richtung Tür zu lotsen. Sie wollte aber noch wissen, was mich in die Hauptstadt geführt habe. Das Unglück sei doch vor den Gestaden von New York passiert. Ich erzählte ihr von meinem anstehenden Besuch im Oval Office. Sie nickte wie eine, die das nicht zum ersten Mal hörte. Da hätten wir, Präsident und Korrespondent, ja ein wichtiges Thema zu besprechen. Sie meinte den Absturz, sprach aber von einem Anschlag und hatte sich bereits die Version zu eigen gemacht, das sei ein Angriff gegen Amerika.
Ich hatte Schwierigkeiten, mich am Schreibtisch meiner Nippon-Suite auf meine Arbeit zu konzentrieren. Im Fernseher wurde weiterhin auf allen Kanälen vom Crash berichtet. Aus New York kam nichts wesentlich Neues. Also begann ich, meinen Text zu skizzieren. Dank O’Reilly stand der Einstieg bereits fest. Mit dem Zeitunterschied von sechs Stunden kam der Artikel rechtzeitig in Hamburg an.
Im Morgengrauen legte ich mich kurz aufs Ohr und stellte mir vorsorglich den Wecker. Zu meiner Überraschung hatte das Weiße Haus meinen Termin noch nicht abgesagt. Vermutlich hatten sie ihn in der Aufregung des Tages übersehen, und ich würde erst bei meiner Ankunft von der Stornierung erfahren.
Vor mir lag ein Tag, der sich anfühlte, als wäre der nächtliche Traum einfach weitergegangen. Darin hatte ich in einem geheimen Hotel gewohnt, das nur Menschen beherbergt, die im Rampenlicht der Öffentlichkeit standen. Bühnenkünstler, Intellektuelle, Politiker, Journalisten.
Dann wachte ich in einer japanischen Suite auf, frühstückte mit den Mitgliedern einer jamaikanischen Reggae-Band an einem runden Tisch, und in der Luft hing fett der Duft von Dope. Für die Boyz war ich allein schon deshalb der Mittelpunkt, weil ich mich auf den Weg machte, den Präsidenten der Vereinigten Staaten zu treffen.