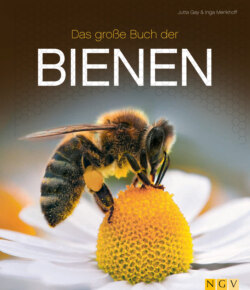Читать книгу Das große Buch der Bienen - Jutta Gay - Страница 16
GESCHICHTE UND EVOLUTION DER BIENEN
ОглавлениеIn den 1920er-Jahren machte Alfred Cary Hawkins in einem Steinbruch bei Kinkora im US-Bundesstaat New Jersey einen bedeutenden Fund. Der engagierte Geologe und Mineraloge entdeckte einen Bernstein, der in seinem Inneren ein knapp sechs Millimeter langes Insekt enthielt. Untersuchungen ergaben, dass es sich hierbei um eine Arbeiterbiene der Gattung Trigona handelte und dass dieses Exemplar vor rund 65 bis 45 Millionen Jahren in einem Harztropfen eingeschlossen wurde. Trigona prisca galt seitdem als älteste fossile Biene der Welt. Da die Gattung Trigona zu der rund 370 Arten umfassenden Gruppe der Meliponini gezählt wird – stachellose Bienen, die wie Honigbienen dauerhafte, über mehrere Generationen bewohnte Kolonien mit Arbeitsteilung gründen –, war überdies der Beweis erbracht, dass seit vermutlich mehr als 50 Millionen Jahren Bienenarten auf der Erde existieren, die sich durch eine soziale Lebensweise auszeichnen.
Fossile Biene
Wie in goldgelben Honig eingetaucht und dort auf ewig konserviert – so sehen die ältesten, in Bernstein eingeschlossenen Exemplare von Bienen aus. Die fossilen Insekten liefern den Beweis dafür, dass die Erde schon vor Jahrmillionen von Bienen bevölkert war, die neben Käfern und Schmetterlingen für die Verbreitung und Diversifikation von Blütenpflanzen sorgten.
2006 wurde ein neues Kapitel in der Geschichte der Bienen aufgeschlagen. In einer Mine im nördlichen Myanmar entdeckte man ebenfalls eine in Bernstein eingeschlossene fossile Biene. Das knapp drei Millimeter kleine Insekt konnte als Exemplar einer bislang unbekannten, nicht mehr existierenden Bienenart identifiziert werden, das in anatomischer Hinsicht Merkmale sowohl mit fleischfressenden Wespen als auch mit pollensammelnden Bienen aufweist. Die wichtigste Erkenntnis diverser Untersuchungen des Fossils jedoch war: Das Alter von Milittosphex burmensis, so der wissenschaftliche Name der fossilen Biene, wurde auf 100 Millionen Jahre geschätzt. Dies entspricht dem erdgeschichtlichen Zeitraum, in dem auch Blütenpflanzen, sogenannte Bedecktsamer, in Erscheinung traten. Dies legt die Annahme nahe, dass die Entwicklung und Verbreitung von Blütenpflanzen die Voraussetzung für die Ausbildung pollensammelnder Bienenarten war. Doch auch der umgekehrte Fall ist denkbar: Bienen könnten die Erde schon vor der Ausbreitung von Blütenpflanzen bewohnt haben, wobei Windblütlerpollen bereits existierender Nadelbäume oder Sporen der Samenfarne ihre Nahrungsgrundlage gebildet hätten. Möglicherweise ist es also die Biene gewesen, die aufgrund ihres pollenbindenden Haarkleids den Impuls zur Entwicklung von Blütenpflanzen gab. Unstrittig ist auf jeden Fall, dass vor 100 Millionen Jahren Bienen und Blütenpflanzen die Vorteile eines Zusammenspiels entdeckten. »Nahrung gegen Verbreitung« heißt das Credo des symbiotischen Verhältnisses, das sich evolutionsgeschichtlich betrachtet schon bald als Erfolgsmodell erwies und zu entsprechenden Koevolutionen führte. Bei den Bienen zeigten sich unter anderem Veränderungen der Mundwerkzeuge sowie Optimierungen der Transportorgane, um Pollen und Nektar effektiver befördern zu können. Blütenpflanzen wiederum entwickelten süßen Nektar als Nahrungs- und Energiequelle, um Bienen und andere potenzielle Bestäuber anzulocken, oder bildeten sogenannte Saftmale aus, die es den Insekten erleichtern, den Nektar und die Bestäubungsorgane zu finden.
Möglicherweise trugen Bienen dazu bei, dass sich vor 100 Millionen Jahren insektenbestäubte Pflanzen (links) gegenüber den Koniferen (rechts) durchsetzten und sich zur artenreichsten aller Pflanzengruppen entwickelten.
Die Maskenbiene (Hylaeus)
Maskenbienen bilden eine Gattung innerhalb der Unterfamilie der Hylaeinae. Sie sind in Europa mit knapp 80 Arten vertreten, wobei einige in ihrer Existenz als bedroht gelten und entsprechend auf der Roten Liste geführt werden. Ihren Namen verdanken die verhältnismäßig klein gewachsenen Bienen einer gelben oder weißen Gesichtsmaske, die insbesondere bei den Männchen ein hervorstechendes Merkmal ist. Ansonsten zeigt die Maskenbiene einen fast durchgängig schwarzen, unbehaarten Körper. Gemeinsames Kennzeichen aller Arten ist das Fehlen von äußeren Transportorganen für Pollen: Bauchbürsten oder Pollenkörbchen wie etwa bei den Honigbienen sind nicht vorhanden. Aus diesem Grund nehmen Maskenbienen den Pollen über einen Borstenkamm auf, verschlucken ihn und würgen ihn im Nest zusammen mit dem aufgenommenen Nektar wieder aus.
Doch damit nicht genug: Als Reaktion auf den starken Selektionsdruck und ein beständiges Konkurrenzverhältnis im »Werben« um Bestäuberinsekten entwickelten Pflanzen immer neue Methoden, um ihren Fortbestand zu sichern: Das Absondern von Sexuallockstoffen, das Vortäuschen einer üppigen Nahrungsquelle, die faktisch gar keinen oder nur wenig Nektar bereithält, oder das vorübergehende Festhalten des Insekts im Blütenkelch, um die Bestäubungswahrscheinlichkeit zu erhöhen, sind einige dieser Überlebensstrategien.
Diese Anpassungsmechanismen erwiesen sich als ungemein erfolgreich: Gegen Ende der Kreidezeit setzten sich insektenbestäubte Pflanzen (Angiospermen) mehr und mehr gegenüber den bis dahin vorherrschenden Koniferen durch und entfalteten sich zur artenreichsten aller Pflanzengruppen. Und auch der Fortbestand und die Weiterentwicklung der Bienen wurde durch das Prinzip »Nahrung gegen Verbreitung« gesichert: Bienen fliegen heute auf jedem Kontinent der Welt. Sie sind insbesondere seit der kommerziellen Nutzung durch den Menschen die mit Abstand wichtigsten Bestäuberinsekten. Und: Sie konnten im Laufe der Jahrmillionen zigtausende Arten ausbilden, die zusammengenommen die große, bunte Familie der Apiformes bilden.
Mit 23 bis 28 Millimetern Körperlänge ist die Blaue Holzbiene die größte in Deutschland ansässige Bienenart. Ihr schwarzer Körper und die blau schimmernden Flügel machen die solitär lebende Wildbiene, die blütenreiche Gegenden mit viel Totholz als Nistplätze bevorzugt, unverwechselbar.
Die Verbreitung von Pflanzen und die Sicherung landwirtschaftlicher Erträge ist maßgeblich von der Bestäubungsleistung der Wildbienen abhängig, hier eindrucksvoll zu sehen an einer Agapostemon splendens aus der Familie der Halictidae, die Pollen aus einem Stachel-Nachtschatten befördert.