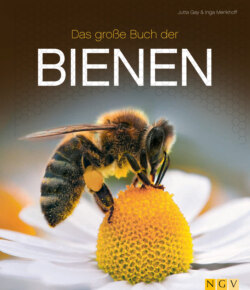Читать книгу Das große Buch der Bienen - Jutta Gay - Страница 23
HINTERLEIB (ABDOMEN)
ОглавлениеSo wie der Kopf Sitz für die Sinnesorgane ist, so ist der Hinterleib der Biene der Bereich für die meisten inneren Organe. Streng genommen ist der häufig verwendete Fachbegriff Abdomen bei der Beschreibung des hinteren Körperteils falsch. Dies liegt darin begründet, dass im Laufe der Evolution das erste Segment des Hinterleibs mit dem letzten Brustsegment verwachsen ist. Die Einschnürung, die wir bei vielen Bienenarten sehr deutlich ausmachen können, trennt demnach nicht Thorax und Abdomen voneinander, sondern ist eine Einschnürung des Hinterleibes selbst, dessen hinterer Teil deshalb eigentlich als Metasoma bezeichnet werden müsste.
Von außen betrachtet gliedert sich der Hinterleib bei Arbeiterbienen und Königin in sechs Segmente bzw. Ringe, bei Drohnen in sieben. Die Beweglichkeit des Hinterleibs wird dadurch gewährleistet, dass sich diese Leibesringe jeweils aus einer Bauchplatte (Sternum) und einer Rückenplatte (Tergum) zusammensetzen, die durch elastische Zwischenhäute verbunden sind. Doch was verbirgt sich im Innern dieser muskelarmen Körperzone?
Nahe der Einschnürung liegt die Honigblase. Da der Speiseplan der Bienen mehr als den außen am Körper transportierten Blütenstaub umfasst, benötigt die Biene ein entsprechendes innen liegendes Transportorgan – diese Funktion übernimmt die Honigblase. Nimmt die Biene nun Nektar, Honigtau oder Wasser über den Schlund am Kopf auf, werden die flüssigen Substanzen über die Speiseröhre in die Honigblase befördert, sicher zum Nest transportiert und dort wieder ausgewürgt – sofern es sich um in Staaten lebende Sammelbienen handelt. Nahrung zum Selbstverbrauch hingegen gelangt über einen Ventiltrichter in den Mitteldarm, wo die Verwertung der Nährstoffe und die Verdauung stattfindet. Unverdauliche Reste landen schließlich im Dünndarm bzw. in der Kotblase. Dieser extrem dehnbare Teil des Dünndarms spielt beim Überwintern von Bienen eine entscheidende Rolle: Er ermöglicht es den Tieren, Kot monatelang zu speichern und erst außerhalb des Überwinterungsplatzes abzugeben. Auf diese Weise wird die Gefahr von Bakterienbefall deutlich reduziert.
Der Hinterleib der Bienen setzt sich äußerlich aus sechs und bei Drohnen aus sieben Segmenten zusammen. Der Eindruck eines Streifenmusters entsteht weniger durch Farbunterschiede der Segmente, sondern vor allem durch die Filzbinden, also Härchen, deren Farbe von Grau und Gelb bis hin zu Rot, Braun und Schwarz reicht.
Die Arbeiterinnen der Honigbiene besitzen an ihrem Unterleib Wachsdrüsen, die ausschließlich in der Phase aktiv sind, in der sie als Baubienen tätig sind, also etwa vom 12. bis 18. Tag. Zur Formung des Wachses setzen sie ihre Mundwerkzeuge ein.
Grundsätzlich unterscheidet man bei Bienen zwei Geschlechter: Weibchen und Männchen. Entsprechend ihrer sozialen Aufgaben sind drei sogenannte Wesen zu differenzieren: Königin (links), Arbeiterin (rechts) und Drohn (Mitte).
Neben dem Verdauungsapparat sind es Luftsäcke, die als Bestandteil des Atmungssystems Bereiche des Hinterleibs ausfüllen. Wie alle anderen Insekten atmen auch Bienen, indem sie Sauerstoff über kleine Öffnungen aufnehmen, die sich paarweise an beiden Seiten des Chitinpanzers befinden. Diese Atemlöcher, die auch Stigmen genannt werden, sind durch ein System von Röhren bzw. Tracheen mit den inneren Organen verbunden. Über die weit verzweigten Tracheen gelangt Sauerstoff zu den Geweben, umgekehrt wird Kohlendioxid über dieses System aus dem Körper abtransportiert. Atmung ist bei Bienen kein aktiver Vorgang wie beim Menschen. Regulativ kann das Insekt nur eingreifen, indem es mit einem Schließmuskel zumindest die Atemöffnungen am Hinterleib verschließt oder aber den Hinterleib bewegt, wodurch Tracheen und Luftsäcke erst zusammengepresst werden – verbrauchte Luft dringt nach außen – und sich dann dank ihrer Eigenelastizität wieder ausdehnen, wodurch der Luftaustausch verstärkt wird.
Auch der Blutkreislauf von Bienen unterscheidet sich grundlegend von dem des Menschen: Zum einen vermischen sich Blut und Gewebsflüssigkeit (Lymphe) bei den Insekten zu einer farblosen, als Haemolymphe bezeichneten Flüssigkeit. Zum anderen verfügen Bienen über kein geschlossenes, sondern ein offenes Gefäßsystem: Im oberen Teil des Hinterleibs verläuft der Herzschlauch, dessen fünf Kammern durch Klappenventile miteineinander verbunden sind. Über seitlich liegende Öffnungen wird die im Bereich der Verdauungsorgane mit zahlreichen Nährstoffen angereicherte Haemolymphe aufgenommen, durch die Kammern nach vorn gepumpt und gelangt schließlich über eine durch den gesamten Körper führende Aorta bis in den Kopf des Insekts. Dort tritt die Körperflüssigkeit aus und strömt frei über den Bauchraum in den Hinterleib zurück, wobei sie alle Organe umspült und bis in die Beine und Flügel des Insekts gelangt.
Die Arbeiterinnen im Bienenstaat sind auch für die Nahrungssuche verantwortlich. Sie verlassen den Bienenstock, sammeln Pollen und Nektar ein und bringen diese zurück in den Stock, wo die Drohnen an dem System des sozialen Futteraustauschs partizipieren.
Durch ein aus Muskulatur und Bindegewebe bestehendes Häutchen wird der obere Bereich des Hinterleibs mit dem Herzschlauch vom Hauptraum getrennt, in dem sich neben dem Verdauungsapparat auch die Geschlechtsorgane befinden. Grundsätzlich unterscheidet man bei Bienen zwei Geschlechter – Weibchen und Männchen. Die Einteilung in Arbeiterin, Königin und Drohn für sozial lebenden Arten wie die Honigbiene suggeriert zwar das Vorhandensein eines dritten Geschlechts, kennzeichnet aber vielmehr die Rollenverteilung, die in einem Bienenstock vorherrscht. Man spricht in diesem Zusammenhang von den drei Wesen: Arbeiterin und Königin sind weiblich, der Drohn ist männlich.
Weibliche Bienen entwickeln sich aus befruchteten Eiern. Bei solitär lebenden Wildbienen, die mit Abstand die größte Gruppe unter den Bienenarten ausmachen, gibt es nur eine weibliche Erscheinungsform: Alle Weibchen verfügen über ausgebildete, paarweise angelegte Eierstöcke, zwei Eileiter und eine Geschlechtsöffnung. Sie sind gewissermaßen ihre eigene Königin, kümmern sich – sofern es sich nicht um parasitäre Arten handelt – nach der Begattung um den Nestbau und die Errichtung von Brutzellen, in die sie jeweils ein Ei legen.
Bei sozial lebenden Bienenarten verhält es sich anders: Hier ist es zunächst ausschließlich die Königin, die über voll entwickelte Geschlechtsorgane verfügt und mit der Abgabe von bis zu 1600 Eiern täglich die Voraussetzungen für den Fortbestand bzw. die Erweiterung des Bienenvolks schafft. Auch Arbeiterinnen verfügen über Eierstöcke. Solange die Königin jedoch über die Mandibeldrüse eine Pheromon-Mischung – die sogenannte Königinnensubstanz – produziert, die von allen Arbeiterinnen aufgenommen wird, sind deren Eierstöcke verkümmert und als solche funktionslos. Stirbt die Königin oder verliert die Königinnensubstanz an Wirkung, werden Arbeiterinnen binnen drei bis vier Wochen geschlechtsreif und können Eier legen, die aufgrund fehlender Begattung allerdings immer unbefruchtet sind und damit ausschließlich Drohnen hervorbringen.
Die männlichen Bienen verfügen über ein Paar Hoden, in denen Sperma produziert wird, zwei Samenleiter und einen Penis. Die Aufgabe der Drohnen ist klar und einfach definiert: Sie kümmern sich um die Befruchtung der Weibchen. Verglichen mit dem anstrengenden Arbeitsalltag der Weibchen klingt das Leben der männlichen Bienen in hochentwickelten Bienenstaaten geradezu paradiesisch: Brutfürsorge ist den Drohnen der Honigbiene ebenso fremd wie Nahrungssuche. Stattdessen partizipieren sie an dem System des sozialen Futteraustauschs. Doch Vorsicht: Mit der Geschlechtsreife wendet sich das Blatt und schon bald zahlen die Männchen einen hohen Preis für ihr »Lotterleben«. Der Ärger beginnt zu Beginn des Hochsommers. Dann werden die Männchen, indem sie von Arbeiterinnen aus dem warmen Nest befördert werden, unsanft daran erinnert, dass ihre Lebensaufgabe außerhalb des Stockes liegt. Einem bislang nicht entschlüsselten Pfad folgend, sammeln sich bis zu 20.000 Männchen an einem Drohnensammelplatz, wo sie auf Jungköniginnen warten, die sich von mehreren Drohnen begatten lassen. Die eigentliche Paarung findet im Flug statt. Hierbei stülpt der Drohn seinen ansonsten innen liegenden Penis nach außen und pumpt seinen Samen in die Königin – ein Vorgang, der ihn sein Leben kostet, denn der Penis reißt ab. Der Drohn stirbt an Haemolymph-Verlust und fällt von der Jungkönigin ab. Von den rund 100 Millionen Spermien, die eine Königin während des Hochzeitsflugs insgesamt aufnimmt, gelangen etwa 6 Millionen in die Samenblase, wo sie sich mit den Spermien anderer Drohnen vermischen. Dieser Vorrat reicht für alle Lebensjahre der Königin.
Arbeiterinnen verbringen die ersten 18 Tage ihres Lebens überwiegend im Bienenstock. Dort sind sie u.a. mit dem Bau von Wabenzellen beschäftigt, die mit einem Wachsdeckel verschlossen werden, nachdem die Königin sie mit einem Ei bestiftet hat.
Nur weibliche Bienen besitzen einen Stachelapparat, der sich aus einem Organ zur Eiablage, dem sogenannten Legebohrer, entwickelt hat.
Der Stachel der Biene befindet sich am unteren Ende des Hinterleibs und ist mit einer Giftblase verbunden. Wenn sich eine Biene bedroht fühlt, nutzt sie ihn als Wehrstachel und treibt ihn in den Körper des Angreifers und injiziert ein giftiges Sekret.
Die Biene bezahlt den Stich in die Haut eines Menschen mit ihrem Leben. Der Stachel bleibt samt Stachelapparat in der elastischen Haut stecken, sodass die Biene an ihren inneren Verletzungen stirbt.
Ein weiteres geschlechtsspezifisches Merkmal ist der Stachelapparat, der den Männchen gänzlich fehlt. Dies liegt darin begründet, dass sich der Stachel aus dem sogenannten Legebohrer entwickelt hat, einem Organ zur Eiablage, das bei Schlupf- und Gallwespen oder anderen zu den Legimmen zählenden Insektenarten noch heute in seiner ursprünglichen Funktion benutzt wird. Der Stachel befindet sich am unteren Ende des Hinterleibs und ist mit einer Giftblase verbunden. Im Gegensatz zu Grab- und Wegwespen, die ihre Waffe einsetzen, um ihre Beute zu lähmen, benutzen ihn die meisten Bienenarten als Wehrstachel. Und das geschieht in erster Linie, wenn sich die Tiere durch Angriffe individuell bedroht fühlen oder aber Räuber, Parasiten oder Konkurrenten der eigenen Art ins Nest einzudringen versuchen. Dann treiben die Weibchen ihren Stachel in den Körper des Angreifers und injizieren ein giftiges Sekret, das in der Giftdrüse produziert und in der Giftblase gesammelt wird. Königinnen wiederum setzen den Stachel sehr gezielt ein, um Rivalinnen, die noch nicht geschlüpft sind, in der Wabe zu töten.
Bienen können den Stachel durchaus mehrmals in ihrem Leben einsetzen. Das gilt im Übrigen auch für Honigbienen, sofern es sich bei ihrem Gegner um ein Insekt handelt. In diesem Fall versenken Honigbienen ihren Wehrstachel geschickt in die empfindlichen Häute, die sich zwischen den einzelnen Segmenten des Chitin-Außenskeletts befinden, und können ihn danach wieder herausziehen. In der dicken, elastischen Haut des Menschen hingegen bleibt der Stachel aufgrund von Widerhaken hängen. Versucht die Biene, sich zu befreien, reißt sie sich den gesamten Stachelapparat aus dem Körper und stirbt bald darauf an ihren Verletzungen.
Den Stich einer Honigbiene empfinden wir Menschen als besonders unangenehm, weil mit dem Herausreißen des Stachelapparats sämtliches in der Giftblase vorhandene Sekret in die Haut injiziert wird. Die Giftmenge ist größer und damit auch die Wirkung. Wildbienen hingegen, deren Stachel keine Widerhaken besitzen und die ihn daher problemlos wieder herausziehen können, geben bei Stichen nur einen Teil ihres Giftes ab. Doch bis es dazu kommt, muss schon einiges passieren. In aller Regel sind Wildbienen außerordentlich friedlich, verteidigen mitunter nicht einmal ihre Brut. Gegen Menschen können sie oft gar nichts ausrichten, denn nicht selten ist ihr Stachel zu schwach, um in unsere Haut einzudringen.
Mit diesem Problem werden Vertreter der rund 370 Arten umfassenden Gruppe der Meliponini erst gar nicht konfrontiert: Hier teilen Männchen wie Weibchen das Schicksal, stachellos zu sein. Wehrlos sind diese in tropischen und subtropischen Regionen beheimateten Bienen jedoch nicht: Sie verteidigen sich durch Bisse und die Absonderung ätzender Flüssigkeiten.
Willkommener Bienenstich
Wohl jeder kennt den Blechkuchen aus Hefeteig, der mit einer süßen Vanille- oder Sahnecreme gefüllt und mit einer karamelisierten Mandelschicht bedeckt ist – Bienenstich. Kaum jemand kennt jedoch die Legende, die der Namensgebung des Kuchens zugrunde liegt und die bis in das 15. Jahrhundert zurückreicht.
1474 planen Einwohner von Linz am Rhein einen Angriff auf die verfeindete Nachbarstadt Andernach. Im Morgengrauen nähern sie sich den Stadttoren, darauf hoffend, dass sie die für ihre Feierlust bekannten Andernacher im Schlaf überrumpeln können. Und tatsächlich: Die Bewohner der linksrheinischen Gemeinde einschließlich der Torwächter sind in tiefem Schlaf versunken – bis auf zwei Bäckerjungen, die sich an den Stadtmauern herumtreiben, um an Bienenkörbe zu gelangen, die dort aufgereiht sind. Die einen behaupten, Honig sei das Objekt ihrer Begierde gewesen, andere meinen, dass die Jungen dem schlafenden Imker einen Streich spielen wollten, indem sie die Bienenkörbe verkleben und die Bienen damit am Ausschwärmen hindern wollten. Wie dem auch sei. Während sich die zwei Bäckerjungen an den Bienenkörben zu schaffen machen, bemerken sie die zum Angriff gerüsteten Linzer. Für das Alarmieren der Bevölkerung ist es zu spät. Und so greifen sich die Jungen beherzt die Bienenkörbe und schleudern sie von den Stadtmauern direkt in die dichtgedrängte Feindesschar. Tausende verschreckte Bienen setzen daraufhin ihren Stachel gegen die vermeintlichen Angreifer ein und zwingen die Linzer zum Rückzug. Andernach indes feiert seine beiden Helden mit einem großen Fest, zu dem ein besonderer Kuchen gebacken wird, der in Anlehnung an das Ereignis den Namen »Bienenstich« erhält.
Arbeiterinnen sammeln Pollen, Nektar und Honigtau, um den Ertrag bald darauf in den Bienenstock zu transportieren, wo er von anderen Bienen weiterverarbeitet wird.