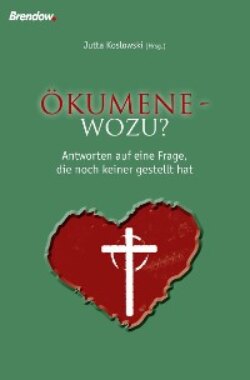Читать книгу Ökumene - wozu? - Jutta Koslowski - Страница 12
4. Aus freikirchlicher Sicht
ОглавлениеKim Strübind
Freikirchen1 haben zur Ökumene ein ambivalentes Verhältnis, was mit ihrer Entstehung und Geschichte zusammenhängt. Die sogenannten »klassischen« Freikirchen (Mennoniten, Methodisten, Baptisten und Freie evangelische Gemeinden) sind – jedenfalls was ihre deutschen »Ableger« betrifft – in der Mitte des 19. Jahrhunderts als religiöse Kontrastgemeinschaften entstanden. Ihre Gründung richtete sich einerseits gegen die Säkularisierung und Liberalisierung des Christentums; andererseits wandte man sich gegen die vermeintlich staatshörigen und klerikalisierten Großkirchen, denen man eine aus gleichberechtigten Mitgliedern bestehende »Gemeindekirche« nach biblischem Vorbild entgegensetzen wollte.
Für den Baptismus wurde die auf freiwilliger und eigenverantwortlicher Glaubensentscheidung beruhende »Gläubigentaufe« (für die man sich auf einschlägige Stellen des Neuen Testaments beruft) zu einem Alleinstellungsmerkmal innerhalb des ökumenischen Kanons der Kirchen.2 Trotz ihres kirchenkritischen Potenzials waren bereits die Anfänge des Baptismus und anderer Freikirchen von einer ökumenischen Grundgesinnung geprägt, die sich nicht an der formalen Kirchenmitgliedschaft, sondern am gemeinsamen Glauben orientierte. Die eigene sich etablierende kirchliche Struktur verstand man dabei eher pragmatisch als dogmatisch.
Innerhalb des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden, dem Dachverband der Baptistengemeinden in Deutschland, lassen sich unterschiedliche ökumenische Ansätze feststellen.3 Er steht aufgrund seiner kongregationalistischen (d. h. von der Einzelgemeinde her konzipierten) Kirchenstruktur latent vor einer inneren ökumenischen Frage. Die sich in dieser Kirchenform zeigende ausgeprägte Binnendifferenzierung weist eine oft unübersichtliche Vielfalt an Glaubens- und Frömmigkeitsformen auf. Die gemeinsame Identität innerhalb einer »Gemeindekirche« mit vielfältigen lokalen und regionalen Binnentraditionen muss stets neu definiert werden. Dies stellt nicht nur einen innerkirchlichen spirituellen Reichtum, sondern zugleich das größte Problem für die konfessionelle Konsistenz des Baptismus dar.4
Im Prinzip ist dabei der Grundsatz leitend, dass jede Ortsgemeinde charismatisch hinreichend begabt und damit kompetent ist, das Gemeindeleben selbstbestimmt und gemäß der eigenen Erkenntnis zu gestalten. Übergeordnete regulative Instanzen des Gemeindebunds spielen dabei kaum eine normative, sondern vor allem eine konsultative und pastorale Rolle. Diese Form des Gemeindelebens gründet im »allgemeinen Priestertum«, dessen oberste Instanz keine dogmatisch fixierten Lehrsätze, Bekenntnisse oder ein allgemeingültiges Kirchenrecht bilden, sondern die Versammlung aller Mitglieder, deren Beschlüsse die Gemeinde(n) insgesamt binden.5
Abgesehen von einigen grundlegenden Prinzipien – wie der Praxis der »Gläubigentaufe«, dem Vertrauen auf die normative Kraft der Bibel für die Lehre und die praxis pietatis, dem unbedingten Vorrang der Glaubens- und Gewissensfreiheit sowie der Trennung von Staat und Kirche – sind die Gemeinden bei der Gestaltung ihres spirituellen Lebens weitgehend autonom und an keinerlei Weisungen von außen gebunden. Überörtliche Konferenzen und Tagungen, auf denen die Einzelgemeinden und die innerkirchlichen Werke durch Repräsentantinnen und Repräsentanten vertreten sind, haben daher immer auch den Charakter einer »innerkirchlichen Ökumene«, bilden diese ab und sind auf den Konsens durch die Einzelgemeinden angewiesen. Eng definierte Vollmachten wie die rechtliche Vertretung nach außen oder übergeordnete und die Gemeinschaft insgesamt betreffende Aufgaben werden an regionale (Leitung der Landesverbände) und nationale Institutionen (Präsidium und Bundesgeschäftsführung, gesamtkirchliche Werke) delegiert.
Über die jeweils herzustellende innere Ökumene hinaus stößt der Baptismus wie jede andere Kirche auf die äußere Ökumene, wenn die Beziehungen zu anderen Kirchen in den Blick geraten. Erfreulicherweise nehmen viele Vertreterinnen und Vertreter von Baptistengemeinden sowie die Kirchenleitung mit Interesse und Engagement an den Formen und Foren des zwischenkirchlichen Austauschs teil und gestalten diesen oft aktiv mit. Der Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden (BEFG) gehört u. a. zu den Gründungsmitgliedern der 1948 gegründeten Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Deutschland (ACK). Die Charta Oecumenica wurde anlässlich des Ökumenischen Kirchentags 2003 offiziell ratifiziert. Vertreterinnen und Vertreter des BEFG sind auch in Form von ökumenischen Lehrgesprächen, durch die Erteilung von kirchlichem Religionsunterricht und mittels vielfältiger diakonischer Vernetzungen mit anderen kirchlichen Einrichtungen ökumenisch verbunden. Zwischenkirchliche Kontakte und das Kennenlernen anderer christlicher Traditionen stoßen innerhalb von Baptistengemeinden auf eine offene Gesprächsatmosphäre, an der sich gerade die theologischen Laien engagiert und mit Interesse beteiligen. In ökumenischen oder interkonfessionellen Haus- und Gebetskreisen, in gemeinsamen Aktionen mit benachbarten Kirchengemeinden und vor allem im Bereich des gemeinsamen missionarischen Zeugnisses gewinnt diese Form der Ökumene eine konkrete und sehr pragmatische Gestalt. Mitglieder anderer Kirchen werden in baptistischen Gemeinden meist herzlich aufgenommen und stoßen in der Regel auf große Offenheit. Diese Offenheit zeigt sich nicht nur im Falle eines Konfessionswechsels, sondern auch gegenüber Gästen oder den oft fest in das Gemeindeleben integrierten Mitgliedern anderer Kirchen, die auch ohne volle Mitgliedschaft als »Freunde der Gemeinde« bei Baptisten integriert sind und das Leben dort in nahezu allen Bereichen mitgestalten.6
Wie lässt sich solche Vielfalt der »inneren« und »äußeren« Ökumene leben? Zunächst einmal belegt die Tatsache der Existenz von lebendigen und aktiven baptistischen Gemeinden, dass ein Kirchenmodell, welches auf Lehrkonsense sowie auf Machtbefugnisse überörtlicher Instanzen verzichtet, lebens- und zeugnisfähig und für viele Menschen durchaus attraktiv ist. Das ist auch von jenen Kirchen, die ein einheitliches dogmatisches Selbstverständnis für unabdingbar halten, zunächst einmal wahrzunehmen. Entsprechend ihrer basisorientierten Kirchenstruktur werden ökumenische Kontakte vor Ort durch jede einzelne Baptistengemeinde bestimmt und verantwortet. Allgemeine Stellungnahmen regionaler oder nationaler Leitungsgremien zur Ökumene haben dagegen nur den Rang einer »Empfehlung« für die Gemeinden, die selbst darüber entscheiden, was sie sich davon zu eigen machen. Daraus ergibt sich ein spezifisches Problem für freikirchliche Delegierte, sofern sie im Namen der Bundesgemeinschaft zu bestimmten Themen Stellung nehmen sollen. Diese Verlegenheit ist auch ein Hindernis für ökumenisch besetzte Gremien und im Rahmen zwischenkirchlicher Lehrgespräche. Es ist aufgrund des ständigen Vorbehalts einer Ratifizierung durch die Gemeinden oft schwer zu sagen, welche Position »die« (d. h. die Mehrheit der) Baptisten in Einzelfragen vertreten. Dies ist dem kongregationalistischen Grundverständnis geschuldet, dem die meisten, wenn auch nicht alle Freikirchen verpflichtet sind.7
Baptistinnen und Baptisten haben aufgrund ihrer Erfahrungen mit der Ökumenizität innerhalb der eigenen Kirche meist ein grundsätzlich positives Verhältnis zur Ökumene und können sich am Glauben anderer Kirchen und Gemeinden freuen. Andererseits zeigen sich besonders in stark evangelikal geprägten Gemeinden auch beachtliche Vorbehalte gegenüber der Ökumene. Dies ist allerdings kein spezifisch baptistisches Phänomen, sondern beruht auf einem interkonfessionellen Konsens des Evangelikalismus, der sich von den als »lau« und »inhaltsleer« geltenden Landeskirchen sowie von der katholischen Kirche abgewandt hat und deren (Volks-)Kirchlichkeit grundsätzlich infrage stellt. Derart geprägte Gemeinden, die sich gerne das Etikett einer »Gemeinde nach dem Neuen Testament« umhängen, verweigern sich aufgrund ihrer religiösen Hybris dem ökumenischen Gespräch und verstehen ihre religiösen Gemeinschaften als Protest- oder Gegenkirche. Ihr Selbstverständnis verdankt sich der Produktivität eines antikirchlichen Feindbilds, wobei sie in der Regel mit den konkreten Verhältnissen der Großkirchen und ihrer Spiritualität gar nicht vertraut sind. Sofern sich solche Gemeinden dennoch auf ökumenische Gesprächsebenen einlassen, werden diese für verborgene – meist »missionarische«– Strategien verzweckt. Man genießt die öffentliche Anerkennung, welche man als Gesprächspartner auf Augenhöhe genießt, und wird von dem (in unserer von religiösen Phobien durchsetzten Gesellschaft allgegenwärtigen) Sektenverdacht entlastet. Diese Verzweckung der Ökumene durch evangelikale Gemeinden dient ausschließlich eigennützigen Zielen, ohne ernsthaft an anderen kirchlichen Traditionen interessiert zu sein, die man auf der Grundlage einer Bibelorthodoxie als »unbiblisch« ablehnt. Einstellungen dieser Art sind innerhalb des Baptismus allerdings eher selten anzutreffen. Sie verdanken sich oft einem regionalen Frömmigkeitskolorit und sind historisch, soziologisch und anderweitig binnenkulturell bedingt.
Die Frage nach einer »institutionellen« Kirchengemeinschaft ist für den Baptismus im Unterschied zu anderen Kirchen bisher kaum ein ökumenisches Problem gewesen, da die Bekenntnisfreiheit jeder und jedes Einzelnen respektiert wird. Weil alle kirchlichen Institutionen nach baptistischem Verständnis vorläufig, historisch kontingent und damit auch widerrufbar sind, können Baptisten eine ökumenische Kirchengemeinschaft auch bei gravierenden Erkenntnisunterschieden jederzeit dort feststellen, wo Jesus Christus im Glauben bekannt wird und die Heilige Schrift als gemeinsame Grundlage für Glauben und Lebenspraxis Anerkennung findet.
Ausgangspunkt ist dabei, dass die Einheit der Kirche kein Werk menschlicher Erkenntnis, sondern Werk des Wortes Gottes ist (»ecclesia creatura verbi«). Kirchliche Einheit ist daher für Baptistinnen und Baptisten und auch für die Mehrzahl der Freikirchen nicht von einem zuvor festgestellten und gemeinsam formulierbaren dogmatischen »Bekenntnisstand« abhängig (etwa durch eine Übereinstimmung in der Rechtfertigungslehre). Das Grundbekenntnis, dass Jesus Christus, wie ihn die Heilige Schrift bezeugt, der eine Herr ist, wird als hinreichend für alle Formen ökumenischer Partnerschaften betrachtet, sofern sie sich biblisch rechtfertigen lassen. Leitend ist dabei ein Verständnis von der Fehlbarkeit menschlicher Erkenntnis, die sich erst eschatologisch auflöst.8 Kirchengemeinschaft ist nach baptistischem Verständnis daher selbst in der widersprüchlichen Gestalt getrennter Kirchen und unterschiedlicher Auslegungen feststellbar. Sie lässt sich, etwa in Form ökumenischer Gottesdienste und einer offenen Abendmahlspraxis aller an Christus Glaubenden, unabhängig von der jeweiligen Kirchenzugehörigkeit liturgisch feiern. Die gemeinsame Mahlfeier stellt daher eines der ökumenischen Potenziale des Baptismus dar. Den Primat einer einzelnen Kirche oder bestimmter Amtsträger können Baptisten dagegen nicht anerkennen und halten einen solchen weder für sinnvoll oder erforderlich noch überhaupt für herstellbar. Ökumene wird vielmehr als ein notwendiger Ausdruck des Beziehungsreichtums Gottes gedeutet. Diese auf einem radikal verstandenen allgemeinen Priestertum beruhende Laienkirche gesteht dem geistlichen Amt der Pastorinnen und Pastoren zwar eine spirituelle Autorität, aber nur begrenzte exekutive Befugnisse zu.9
Die ekklesiologische Grundlage für das Ökumeneverständnis der Baptisten in Deutschland findet sich im gemeinsamen Grundbekenntnis, der »Rechenschaft vom Glauben« (1977). In Artikel 7 (»Der eine Leib Christi und die getrennten Kirchen«) ist die ökumenische Selbstverpflichtung festgehalten:10 »[…] Der eine Geist schenkt viele Gaben, die sich in den Ortsgemeinden, aber auch in den voneinander getrennten Kirchen in gegenseitig bereichernder Vielfalt auswirken können. Jesus Christus baut seine Gemeinde in den verschiedenen Kirchen und Gemeinschaften. Doch kann es trotz der Verschiedenheiten und trotz Irrtum und Schuld auf allen Seiten nicht der Wille Gottes sein, dass konfessionelle Schranken die sichtbare Gemeinschaft aller Glaubenden und damit ihr glaubwürdiges Zeugnis vor aller Welt verhindern. Deshalb beten wir mit den Christen der ganzen Erde um Erneuerung aller Gemeinden und Kirchen, dass mehr gegenseitige Anerkennung möglich werde und Gott uns zu der Einheit führe, die er will. Schon heute ist es nicht nur Aufgabe einzelner Christen aus verschiedenen Kirchen, sondern dieser Kirchen selbst, aus der Trennung heraus mögliche Schritte aufeinander hin zu tun, vorhandene Vorurteile abzubauen und Einwände gewissenhaft zu formulieren und zu vertreten, voneinander zu lernen, füreinander zu beten und gemeinsam Christus zu verherrlichen in Zeugnis und Dienst.«
Damit ist einer konfessionellen Selbstgenügsamkeit widersprochen, die besonders in kongregationalistischen Kirchen naheliegt. Sie stellt eine der berechtigten Anfragen aus der Ökumene an die Glaubenspraxis der Baptisten und anderer Freikirchen dar. Durch das Offenhalten der Tauffrage ist die Existenz des Baptismus ökumenisch gleichwohl von anhaltender Bedeutung. Dies gilt in zweifacher Hinsicht:
(1.) Der Baptismus ist mit seinem Insistieren auf der Praxis der »Gläubigentaufe«, die auf freiwilliger Taufentscheidung beruht, und mit der Kritik an der Taufe von Neugeborenen ein ständiger Stein des Anstoßes bei ökumenischen Selbstinszenierungen.11 Da eine vom Konsens der traditionellen Konfessionskirchen abweichende Tauftheologie und -praxis zur Identität des Baptismus gehört, kann die Taufe aus baptistischer Sicht nicht das »Sakrament der Einheit« sein, als das es andere Kirchen gerne etwas voreilig bezeichnen.
(2.) Der Baptismus bildet mit seiner Taufpraxis zugleich einen notwendigen ökumenischen Anstoß, weil er auf die exegetischen und ekklesiologischen Defizite der Taufpraktiken in den Traditionskirchen hinweist. Dies führt nicht zu einer grundsätzlichen Verweigerung der Anerkennung der Taufpraxis anderer Kirchen, aber es erinnert die Partnerkirchen daran, dass ihre Taufpraxis aus der Sicht des Neuen Testaments ausgesprochen problembehaftet ist. Dies gilt besonders für jene Kirchen, die sich neben der Säuglingstaufe zugleich auf das Schriftprinzip sola scriptura berufen. Der Baptismus erinnert diese Kirchen daran, dass eine Taufe der Unmündigen auch die Gefahr einer unmündigen Kirche in sich birgt (JÜRGEN MOLTMANN).
Der deutsche Baptismus hat mehrere ökumenische Ziele in den Blick zu nehmen. Er stößt historisch auf eine wesentlich ältere und reichhaltige internationale baptistische Tradition und Herkunft vor allem im angloamerikanischen Raum, die auch gesellschaftspolitisches Engagement einschließt.12 Diese binnenökumenische Dimension ist im deutschen Baptismus noch weitgehend unentdeckt. Anderseits bedarf der Baptismus in gleicher Weise der Kritik und Korrektur durch die ökumenischen Partnerkirchen außerhalb der eigenen Denomination, um nicht der stets naheliegenden Provinzialität einer »Gemeindekirche« ausgeliefert zu sein, welche die eigene Gemeinde schon für das Reich Gottes hält. Dazu gehört nicht zuletzt das gelegentlich anzutreffende hybride Selbstverständnis, baptistische Gemeinden seien ausschließlich dem Neuen Testament verpflichtet. Dies hält einer näheren historischen und exegetischen Prüfung nicht stand.13
Dass gerade das lange Zeit kirchentrennende Taufverständnis nicht in ökumenischer Rat- und Sprachlosigkeit enden muss, belegt das im April 2009 publizierte Konvergenzdokument »Voneinander lernen – miteinander glauben«.14 Es schließt ein sechsjähriges Lehrgespräch zwischen Vertretern der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern und des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland ab und entspricht damit einer Selbstverpflichtung der Charta Oecuemica. Das Dokument belegt, dass auch die oft gescholtene »Konsensökumene« ökumenisch weiterführende Ergebnisse hervorbringen kann. Zum Taufverständnis findet sich dort das Fazit: »Baptisten und Lutheraner können beide Taufverständnisse als unterschiedliche, jedoch legitime Auslegungen des einen Evangeliums anerkennen. Die Gewissheit, in der eigenen Lehre und Praxis dem Evangelium zu entsprechen, impliziert daher nicht, die davon unterschiedene Lehre und Praxis der anderen als nicht evangeliumsgemäß zu verurteilen, weil man in der anderen konfessionellen Tradition die wesentlichen Anliegen auch der eigenen Auslegung gewahrt sieht.« Dieses Konvergenzdokument wird derzeit in den beteiligten Kirchen und Gemeinden kontrovers diskutiert. Man darf gespannt sein, wie sich der ökumenische sowie der innerkirchliche Rezeptionsprozess gestalten werden.15