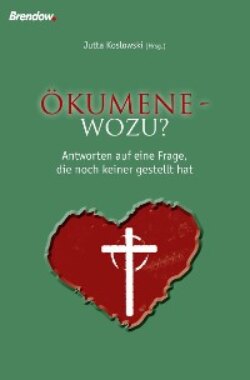Читать книгу Ökumene - wozu? - Jutta Koslowski - Страница 8
ОглавлениеI. Ökumene – wie? Oder: Was bedeutet die ökumenische Bewegung?
A. Konfessionelle Perspektiven
1. Aus evangelischer Sicht
Michael Weinrich
An hohen Feiertagen wird in vielen evangelischen Kirchen das Bekenntnis von Nizäa-Konstantinopel aus dem Jahr 381 gesprochen. Es gilt als das ökumenische Glaubensbekenntnis, weil es die westliche Tradition mit der östlichen verbindet. Im dritten Artikel heißt es dort: »Wir glauben an den Heiligen Geist … und die eine, heilige, christliche und apostolische Kirche.« Im Original steht für das Wort »christlich« der Begriff »katholisch«, und das meint die allgemeine, die universale Kirche. Katholizität ist kein Spezifikum der römisch-katholischen Kirche, sondern gehört zu den Eigenschaften jeder recht verstandenen Kirche – eben deshalb sollte sie nicht allein der katholischen Kirche überlassen werden. Wenn dieses Bekenntnis gesprochen wird, ist mit »Kirche« nicht einfach die eigene Kirche gemeint, sondern die wahre universale Kirche, zu der wir uns auch mit der evangelischen Kirche rechnen. Das ist eine wichtige Pointe.
Dies war auch die zentrale Substanz der Erklärung des Zentralausschusses des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) 1950 in Toronto, wo es heißt: »Die Mitgliedskirchen erkennen an, daß die Mitgliedschaft in der Kirche Christi umfassender ist als die Mitgliedschaft in ihrer eigenen Kirche.« Diese Einsicht qualifiziert den ÖRK als ein theologisch motiviertes Unternehmen, das von Kirchen vorangetrieben wird, obwohl sie untereinander auch fundamentale Vorbehalte haben. Die Tatsache, dass die verschiedenen Kirchen diesen Satz gemeinsam sagen können, ist allerdings noch kein Hinweis darauf, dass sie ihn auch in gleicher Weise verstehen. Vielmehr muss konstatiert werden, dass er sehr unterschiedlich ausgelegt wird. Im Folgenden soll eine protestantische Lesart dieses Satzes skizziert werden.
Wenn Kirche mehr ist als das jeweilige verfasste Kirchesein – dann kann umgekehrt das verfasste Kirchesein im Grunde nur weniger sein als Kirche im Vollsinn des Wortes. Und genau darum geht es, wenn nach der ökumenischen Zielperspektive gefragt wird: Was ist die wahre Kirche im Sinne des Glaubensbekenntnisses? Keine Kirche wird einfach für sich in Anspruch nehmen können, dass sie die »wahre Kirche« sei, so sehr sie daran glauben wird, an der wahren Kirche Anteil zu haben; eben dies bekennt sie mit dem Glaubensbekenntnis. Die wahre Kirche muss bekannt werden, weil sie ebenso wenig sichtbar und zugleich ebenso wirklich ist wie der auferstandene Christus.
Diese Unterscheidung spricht aber der verfassten Kirche keineswegs ihr Kirchesein ab. Wenn in ihr das Evangelium recht gepredigt wird und die biblisch eingesetzten Sakramente ihrer Einsetzung entsprechend gefeiert werden, dann sind die notwendigen und hinreichenden Kennzeichen gegeben, an denen eine Kirche zu erkennen ist. Das wird nicht dadurch infrage gestellt, dass sich in ihr neben den Glaubenden auch Heuchler befinden. Es ist nicht unsere Aufgabe, hier Urteile zu fällen. Geschichtlich heißt »Kirche sein« immer vor allem »Kirche werden«.
Nimmt die Kirche ihr Glaubensbekenntnis ernst, so wird sie nicht in Versuchung geraten, zu hoch von sich selbst zu denken oder sich gar triumphalistisch in Szene zu setzen. Denn alle vier Attribute, die da im Nizänischen Glaubensbekenntnis angeführt werden (nämlich Einheit, Heiligkeit, Katholizität und Apostolizität), werfen ein kritisches Licht auf die unterschiedlichen Erscheinungsformen der Kirche und auf ihre konfessionelle Zersplitterung. Zwar mag eine Kirche es von sich weisen, als »Konfessionskirche« angesehen zu werden – tatsächlich wird sie sich aber dem Faktum stellen müssen, dass sie stets als eine Konfessionskirche agiert. Diese Attribute erinnern jede Kirche vor allem daran, dass es in allem, was sie ist, stets auch noch etwas zu beklagen gibt, was sie (noch) nicht ist.
Indirekt formulieren die vier Attribute einen markanten Mangel im Blick auf unser faktisches Kirchesein. In ihrem Spiegel können alle Kirchen ihre offenkundigen Unvollkommenheiten und Defekte erkennen, auch wenn sie die Mängel lieber bei den anderen sehen. Sie können etwa schlicht feststellen, dass es problematisch bleibt, ohne die anderen von sich selbst als der einen Kirche zu sprechen. Wir können nicht vollständig Kirche sein, solange wir ohne die anderen sind. Keine theologische Dialektik kann dieses Defizit schönreden – und es ist eben ein Mangel, den wir nicht anderen zuschieben können, sondern einer, an dem wir selbst leiden. Eine solche analytische Feststellung sollte nicht mit einem moralischen Urteil verwechselt werden.
Und wenn eines der vier Attribute der Kirche so fundamental verletzt ist, wie es im Blick auf die Einheit gewiss festzustellen ist, bleibt dies nicht ohne Auswirkungen auf die drei anderen Attribute. Ohne eine rechte Einheit kann die Kirche eben auch keine heilige Kirche sein. Sie kann allein darauf setzen, dass Gott sie ihren Mängeln zum Trotz heiligt. Ohne Einheit kann sie auch nicht katholische, d. h. universale Kirche sein. Faktisch ist sie partikular, und sie kann wiederum nur darauf setzen, dass sie als solche an der Katholizität der von Gott erwählten Kirche teilhat. Und auch das vierte Attribut bleibt eingetrübt – denn wie wollte sich eine Kirche, deren Einheit, Heiligkeit und Katholizität nur überaus gebrochen in Erscheinung treten, guten Gewissens eine apostolische, also eine Kirche im Sinne der Apostel nennen können? Der Mangel an Einheit bringt der Kirche bei nüchterner Betrachtung eine Fehlanzeige auf der ganzen Linie ein, so dass nur der Trost des Bekenntnisses bleibt, dass Gott wirken wird, auch wenn wir ihn mit unserem geschichtlichen Tun immer wieder behindern. Eben deshalb bleibt das Bekenntnis zu der in Gott gegebenen Einheit der Kirche für alle ökumenischen Anstrengungen so essenziell. Das wissen zwar alle Kirchen, aber in der Regel werden nur wenige Konsequenzen aus diesem Wissen gezogen.
Diese Überlegungen zeigen, dass es in der Frage nach der Einheit der Kirche nicht um eine Randfrage geht, der man sich stellen kann oder eben auch nicht, sondern es geht unmittelbar um die Substanz der Kirche. Die Sorge der Kirche um ihre Einheit ist kein Luxusproblem, von dem man sich in schlechteren Zeiten dann auch wieder zurückziehen kann; sie ist keine Kür, für die nur Zeit bleibt, wenn die Pflicht hinreichend erfüllt ist. Vielmehr gehört das Bemühen um die Einheit zur Pflicht – ohne sie würde sie zwangsläufig zu einer sektiererischen Unternehmung. Die Frage nach der Einheit der Kirche stand auch schon auf der Tagesordnung, als noch nicht von »Ökumene« gesprochen wurde. Da, wo die Kirche erneut nach ihrem Ursprung und ihrem wahren Grund fragt, um sich zu reformieren, da fragt sie auch nach ihrer Einheit. Insofern war die Reformation – zumindest ihrer Intention nach – ein ökumenisches Ereignis. Es gibt keine Zeit, in der es einen solchen Reformationsbedarf nicht gäbe.
Dies ist die erste und grundlegende Perspektive des evangelischen Ökumeneverständnisses. Von Anfang an war die Kirche darauf angewiesen, ihre Einheit zu bekennen – weil es nie eine Zeit gegeben hat, in der diese Einheit einfach sinnenfällig vor Augen stand. Aus dieser ersten folgt dann eine zweite Perspektive, die nun unsere dem Bekenntnis entsprechenden Bemühungen um eine geschichtlich aufzeigbare Einheit betrifft. Diese Perspektive zielt nicht auf eine große »Überkirche«, in der alles dem gleichen Reglement unterworfen ist. Vielmehr blickt die evangelische Einheitsvision auf eine Kirchengemeinschaft sich nicht nur gegenseitig anerkennender, sondern auch miteinander lebender Kirchen. Die Einigkeit in den Fundamentalartikeln des Glaubens schafft eine ausreichende Basis dafür, Unterschiede in weniger zentralen Fragen nicht als kirchentrennend zu bewerten. Keine Anerkennung einer diffusen Vielfalt oder einer abstrakten Pluralität ist gemeint, sondern eine durch eine gemeinsame Mitte konzentrierte Vielfalt. Am überzeugendsten kann der Charakter dieser Vielfalt durch den Hinweis auf den biblischen Kanon illustriert werden. Denn dieser umfasst sehr unterschiedliche Wahrnehmungen und Perspektiven, ohne dass deshalb die Konzentration auf eine das Ganze zusammenhaltende gemeinsame Blickrichtung infrage gestellt würde.
Die für die Kirche ins Auge zu fassende Einheit darf keine Vereinheitlichung bedeuten, sondern muss als eine differenzierte Einheit verstanden werden, in der die Vielfalt die Einheit nicht gefährdet, so wie umgekehrt die Einheit die Vielfalt nicht egalisiert und reglementiert. Es geht um die Nutzung der Produktivität einer wirklich aufeinander bezogenen Vielfalt und nicht um eine sich einfach nur in Ruhe lassende und sich somit im Grunde gar nicht gegenseitig ernst nehmende Vielfalt. Liberale Toleranz überlässt die anderen beteiligungslos sich selbst. Das kann mit einer »versöhnten Verschiedenheit« der Kirchen wohl kaum gemeint sein. Vielmehr lebt in der Ökumene die Verschiedenheit aus der gegenseitig festgestellten Gemeinsamkeit, ohne welche die Legitimität der Verschiedenheit infrage stünde. Auch bei einer »Ökumene der Profile« geht es recht verstanden um profilierte Ökumene und nicht um einen Freibrief zur Rekonfessionalisierung. Die festgestellte und im Bekenntnis immer wieder auch gemeinsam bekannte Gemeinsamkeit wird als tragfähig genug eingeschätzt, um die darüber hinaus bestehenden Unterschiede in gegenseitiger Akzeptanz, Zugewandtheit und Offenheit weiterzuerörtern – wie es etwa in den Lehrgesprächen der »Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa« (GEKE) geschieht. Die Einheit ist im Grunde nicht das Ziel des Prozesses, sondern seine Voraussetzung.
Ich weiß, dass manche der von mir gemachten Zuspitzungen in der Ökumene strittig sind. Wir wären sehr viel weiter, wenn wir uns einig wären über das, was unter der Einheit zu verstehen ist. Aber ich war ja nicht gefragt, diesen gordischen Knoten zu lösen, sondern die evangelische Zielperspektive der Ökumene zu skizzieren.