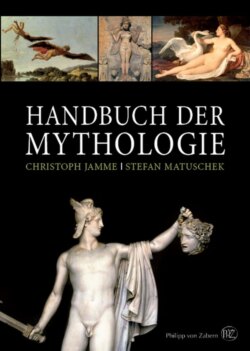Читать книгу Handbuch der Mythologie - Kai Brodersen - Страница 15
Mythos und Politik
ОглавлениеMythen und Politik hängen insofern eng miteinander zusammen, als wohl fast alle politischen Gemeinschaften durch mythische Erzählungen ihre Identität und Gemeinsamkeiten bilden und stabilisieren. Mythen dienen dabei als sinngebende Erzählungen. Sie greifen Vergangenes auf und erzählen und deuten es so, dass es für Gegenwart und Zukunft Orientierung geben kann. Mythen wenden sich gegen die Zufälligkeit und Unvorhersehbarkeit politischer Prozesse, indem sie dem Geschichtsverlauf Ursachen, Konsequenzen und Ziele unterstellen. Entscheidend für ihren Erfolg ist nicht, dass sie nachweisbar richtig, sondern dass sie allgemein akzeptiert sind. Mythen sind somit erzählerisch gestiftete Überzeugungen, die als bloße Überzeugungen, die nicht belegbar sind, Ideologiecharakter haben. Sie geben den Anschein von Historizität, ohne sie zu belegen. Damit können sie auch gegen ihre faktische Widerlegung resistent sein: Auch wenn die Geschichtsschreibung beweisen kann, dass der Sturm auf die Bastille am 14.7.1789 ganz unspektakulär und keineswegs das entscheidende Ereignis der Französischen Revolution war, so wird er im Revolutionsmythos doch dazu gemacht und durch malerische Fantasie und vor allem den französischen Nationalfeiertag bis heute rituell in dieser Bedeutung zelebriert. Wie dieses Beispiel zeigt, sind politische Mythen nicht nur Erzählungen, sondern multimediale Inszenierungen der Erinnerungskultur und Erinnerungspolitik. Vor allem Denkmäler, Feier- und Gedenktage verschaffen ihnen eine massenwirksame, nachhaltige Präsenz.
Mythische Überhöhungen realer Herrscherfiguren und Dynastien sind seit der antiken Dichtung und Geschichtsschreibung überliefert. Sie dienen zur Verherrlichung und zur Absicherung der Regierenden, indem deren Position als folgerichtig und notwendig vom mythischen Ursprung abgeleitet werden. Der römische Kaiser Augustus wird so an den Stammvater ▸ Aeneas und den mythischen Stadtgründer ▸ Romulus angeschlossen, und auch die germanische Mythologie erfüllt die gleiche Funktion, wenn mittelalterliche Geschichtswerke das dänische Königshaus auf den Gott ▸ Balder, das schwedische auf den Gott ▸ Freyr oder das angelsächsische auf den Gott ▸ Odin zurückführen. Mythos und Geschichtsschreibung vermischen sich hier mit dem Ziel, der jeweiligen Dynastie eine nicht anders denkbare, schicksalhafte Folgerichtigkeit zuzusprechen. In der frühneuzeitlichen, barocken Hofkultur dienen die antiken Helden- und Götterfiguren zur Herrschaftsrepräsentation, indem sie zur ruhmvollen Veranschaulichung fürstlicher Aufgaben und Eigenschaften genutzt werden (▸ Herkules, ▸ Artemis/Diana).
Im Prozess der neuzeitlichen Nationenbildung übernehmen Mythen eine weitere Funktion: Sie schließen sich nicht nur an reale Herrschaftsverhältnisse an, sondern erschaffen ihrerseits die Vorstellung einer politischen Gemeinschaft, die es als politische Realität nicht gibt. So ist es in der deutschen Geschichte: Die deutsche Nation wird lange Zeit aus mythischen Erzählungen und Motiven beschworen, bevor sie mit der Reichsgründung 1870/71 staatliche Realität wird. Dabei spielt der Germanenmythos eine entscheidende Rolle: In der ersten durchgreifenden Nationalisierungsbewegung im Zuge der Befreiungskriege gegen Napoleon dient der Mythos der Hermannsschlacht nicht nur zur Mobilisierung der Soldaten, sondern zugleich zur Schaffung eines deutschen Nationalstolzes, der in der kollektiven Befreiung von der Fremdherrschaft die nationale Einigung herbeiführen soll. Die Hermannsschlacht ist zwar ein historisch belegtes Ereignis. Politisch wirksam wird sie aber durch ihre mythische Gestaltung, in der Hermann der Cherusker kein (wie die Geschichtswissenschaft sagt) römisch sozialisierter und entsprechend militärisch ausgebildeter Kriegsführer, sondern ein reiner Germane ist, der sein Volk von den Römern befreit. Auch die Vorstellung eines einigen Germanenvolkes ist Fiktion, die aber gerade als Fiktion eine reale politische Größe darstellt, wenn sie kollektiv akzeptiert wird. Produzenten und Vermittler dieser Fiktion sind u.a. die Literatur (Heinrich von Kleist, Die Hermannsschlacht, 1821 [1808]) und Denkmäler wie das Hermannsdenkmal im Teutoburger Wald (begonnen 1838, 1875 im Beisein Kaiser Wilhelms I. eingeweiht), das der nicht sicher lokalisierbaren Schlacht einen konkreten, touristisch besuchbaren Erinnerungsort schafft. Zur nationalen deutschen Identitätsstiftung wird über das 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jh. auch die germanische Mythologie herangezogen, was von der akademischen Erforschung (Gründung der ‚Germanistik‘) bis zur schulischen, künstlerischen und filmischen Popularisierung zu einer gesellschaftlich durchgreifenden germanischen Selbstbildkampagne in Deutschland führt (▸ Nibelungenlied, ▸ Sigurd/Siegfried). Durch Richard Wagners Opern und sein Bayreuther Festspiel-Konzept, das die religiös-kultische Dimension im modernen Musikdrama wiederbeleben sollte, wird sie im bildungsbürgerlichen Kanon etabliert. Im Nationalsozialismus verbindet sich der Germanenkult mit rassistischer Ideologie und dient als Begleittext, Mobilisierung und Legitimierung von Völkermord und Massenvernichtungslagern, womit bis heute ein Extremwert für die Gefahr gegeben ist, die von politischen Mythen ausgehen kann. In den ersten Nachkriegsjahrzehnten stand die politische Mythosdiskussion in und über Deutschland ganz unter diesem Eindruck, so dass die Verbindung von Mythos und Politik überhaupt die radikale, massenhafte ideologische Mobilmachung konnotierte und im Wesentlichen als Gegenstand der Ideologiekritik verstanden wurde. In den vergangenen zwei Jahrzehnten kulturwissenschaftlicher Forschung hat sich dagegen die Auffassung durchgesetzt, Mythen als einen normalen, auch in demokratischen, aufgeklärten Gesellschaften verbreiteten und funktional wichtigen Bestandteil der politischen Kultur anzusehen. Durch sie bilden sich soziale Großgruppen zu imaginären, auch emotional erfahrbaren Gemeinschaften. Durch greifbare, affektiv überzeugende Sinnstiftungen geben sie Zuversicht und Orientierung, wo die realen Verhältnisse unüberschaubar komplex und unverständlich zu werden drohen. In der gegenwärtigen Europapolitik wird gerade diese mythische Dimension vielfach vermisst und beklagt, dass die europäische Einigung zu einer technokratischen Angelegenheit einer Verwaltungselite geworden sei. Sie drohe genau daran zu scheitern, dass ihr die große sinngebende Erzählung im Einigungsprozess unter Verwaltungsvorschriften verloren gegangen sei. Die Gründergeneration der EU hatte sie in der unumkehrbaren Versöhnungsgeschichte der ehemaligen Kriegsgegner. Für die nachfolgenden Generationen ist diese Erzählung zur Selbstverständlichkeit verblasst, die zur Sinnstiftung und Orientierung nicht mehr ausreicht.
Anonym: Einnahme der Bastille. 14. Juli 1789, Vizille, Musée de la Révolution Française, Château de Vizille
Hermannsdenkmal
Ché-Guevara-Plakat, Demonstration auf dem Kurfürstendamm gegen den Vietnamkrieg, 1968
Nach ihren Kernmotiven kann man politische Mythen in Personen-, Ereignis-, Raum- und Zeitmythen unterscheiden. Die ersten personalisieren die Geschichte und fokussieren das kollektive Schicksal oder Selbstbild in einer Leitfigur. Die kann fiktiv (Siegfried oder Faust als der ‚strebende Deutsche‘) oder auch real sein, wobei die historische Person fiktiv stilisiert wird (Martin Luther als mutiger Thesenanschläger und Bekenner vorm Wormser Reichstag, Ernesto Ché Guevara als ewig junger Revolutionsheld). Ereignismythen zeichnen historische Ereignisse in nicht verifizierbarer Weise als geschichtliche Zäsuren und Wendepunkt aus (etwa den Sturm auf die Bastille oder die Boston Tea Party, deren mythisches Potenzial sich zuletzt als amerikanische Parteienbewegung revitalisiert hat) oder sie projizieren mythische Handlungsmotive in die geschichtliche Wirklichkeit (‚Dolchstoßlegende‘, ▸ Sigurd/Siegfried). Raummythen sakralisieren territoriale Ansprüche (etwa Palästina als ‚Gelobtes Land‘ der Israeliten, der im Kosovo-Krieg aktualisierte Amselfeld-Mythos oder der nordamerikanische Frontier-[Grenz-]Mythos, der die West-Eroberung der USA antrieb). Zeitmythen heben bestimmte Zeitabschnitte als signifikante Momente aus dem Zeitkontinuum heraus (etwa die ‚Stunde Null‘ als Läuterung und Neuanfang nach dem Nationalsozialismus, die Wirtschaftswunderzeit als Goldene Zeit einer sich in fleißiger, qualitätsvoller Arbeit bewährenden Nation, ‚1968‘ als kritischer Neuanfang der jüngeren Generation oder die Wendezeit zwischen dem Ende der DDR und dem Beitritt zur Bundesrepublik als verpasste Chance für einen ‚dritten Weg‘).
Wie diese Beispiele zeigen, ist der politische Mythosbegriff weit. Er schließt sich an das traditionell stoffgeschichtliche Verständnis an, indem auch Teile der griechischen, römischen, germanischen Mythologie als politische Mythen zu verstehen sind. Zugleich überträgt er das Konzept des Mythischen (eine nicht verifizierbare und dennoch kollektiv sinnstiftende Erzählung) auf die neuere Geschichte, auf historische Personen und Ereignisse, auf aktuelle Situationen und Debatten. In politischer Perspektive ist der Mythos nicht das Alte, Vergangene, Archaische. Er ist vielmehr ein fortdauernd produktives, sich immer wieder erneuerndes, an neue Themen und Probleme anschließendes gesellschaftliches Phänomen. Seine Lebendigkeit verdankt sich dem jeweils aktuellen Bezug, in den die Erzählung rückt. Wenn sie vom ganz Alten oder sogar vor- oder außergeschichtlich Transzendenten handelt, geht es ihr doch immer darum, wie dies in der historisch bestimmten Situation zur Geltung kommen soll. Das Adjektiv ‚politisch‘ meint die jeweils aktuelle Adressierung und Funktionalisierung des Mythos: Politische Mythen sind Beiträge zur politischen Kommunikation.
Der französische Publizist und Sozialphilosoph Georges Sorel hat dies am klarsten pointiert: Politische Mythen seien ein Mittel zur Wirkung auf die Gegenwart. Es sei sinnlos zu fragen, wie sie inhaltlich mit dem tatsächlichen Geschichtsverlauf zusammenhängen (Réflexions sur la violence, Über die Gewalt, 1908). Sorels zentrales Beispiel ist die Vorstellung des Generalstreiks, den er ganz unabhängig von der Frage seiner Realisierbarkeit für ein unverzichtbares mythisches Agitationsmittel der Arbeiterbewegung hält.
Neben der affektiven und emotionalen Mobilisierung haben politische Mythen eine wichtige Funktion darin, dass sie die von ihnen angesprochenen Themen und Probleme aus dem politischen Entscheidungsprozess hinaus auf eine unverfügbare naturgegebene oder transzendente Ebene projizieren (das siegfriedhafte oder faustische Wesen der Deutschen; Palästina als ‚Gelobtes Land‘ der Israeliten; Amerika als ‚God’s own country‘), um sie dadurch der Verhandelbarkeit zu entziehen. Mythenbildungen halten Fragen aus der rationalen Auseinandersetzung heraus und versuchen sie stattdessen durch affektiv, emotional und sinnlich wirksame Erzählungen und Vorstellungen zu beantworten. Der französische Literaturwissenschaftler Roland Barthes hat dies als eine Strategie der Naturalisierung beschrieben: als den Versuch, zufälligen Entwicklungen oder Verhandlungs- und Streitsachen den Anschein einer unverfügbaren Zwangsläufigkeit, Richtigkeit und Ordnung zu verleihen (Mythologies, Mythen des Alltags, 1957). Die mythische wirke so als entpolitisierende Rede. Ideologischerweise hielt Barthes das für ein spezifisches Kennzeichen der bürgerlichen Kultur, der die Linke durch ihr bewusstes Politisieren entgegenträte. Man braucht nur an den Gründungsmythos der DDR (dass sich dieser Staat dem freien demokratischen Willen der deutschen Arbeiter und Antifaschisten verdanke) zu erinnern, um zu sehen, wie falsch es ist, die Mythen der bürgerlichen Rechten und die entmythisierende Aufklärung der Linken zuzuschreiben. Und auch sind es nicht immer nur strategische Verklärungen oder Täuschungen, die der Mythos beschert. Der Wunsch nach einer neuen sinnstiftenden Europaerzählung vereint heute viele politische Parteien, und dies nicht in der Absicht, die EU zu verunklären oder um über sie zu täuschen, sondern um dem Einigungsprozess ein neues kollektives Interesse und Engagement zu verschaffen.
LITERATUR
Wulf Wülfing, Karin Bruns, Rolf Parr (Hg.): Historische Mythologie der Deutschen. München 1991
Christopher Flood: Political Myth. A Theoretical Introduction. New York 1996
Monika Flacke (Hg.): Mythen der Nationen. Ein europäisches Panorama. Berlin 1998
Yves Bizeul (Hg.): Politische Mythen und Rituale in Deutschland, Frankreich und Polen. Berlin 2000
Helmut Altrichter, Klaus Herbers, Helmut Neuhaus (Hg.): Mythen in der Geschichte. Freiburg 2004
Frank Becker: Begriff und Bedeutung des politischen Mythos. In: Barbara Stollberg-Rilinger (Hg.): Was heißt Kulturgeschichte des Politischen? Berlin 2005, S. 129–148
Hans Henning Hahn, Heidi Hein-Kircher (Hg.): Politische Mythen im 19. und 20. Jahrhundert in Mittel- und Osteuropa Marburg 2006
Herfried Münkler: Die Deutschen und ihre Mythen. Berlin 2009 SM