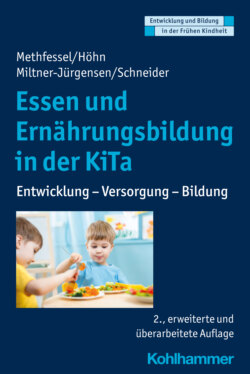Читать книгу Essen und Ernährungsbildung in der KiTa - Kariane Höhn - Страница 46
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.3.5 Bedeutung für Essen und Ernährungsbildung
ОглавлениеSchon beim Stillen werden physische gemeinsam mit sozialen und psychischen Bedürfnissen befriedigt ( Kap. 3.2). Dies ist der Beginn der Förderung der Bindung durch die Nahrungsgabe. Auch nach dem Abstillen wird durch ein gemeinsames Essen Bindung verstärkt. Diese Beziehung kann so ausgeprägt sein, dass lebenslang allein durch einzelne Speisen dieses Gefühl der Bindung bzw. der darüber vermittelten Sicherheit oder Identität hergestellt werden kann. Leidvermeidung wird von Geburt an durch das »Einklagen« des Essens erreicht, indem das Kind schreit, wenn es Hunger hat (abgesehen davon, dass Hunger auch als schmerzhaft empfunden werden kann). Schon früh erleben Kinder, dass sie durch Essen, das Lust und Beruhigung vermittelt, von leidvollen oder Leid auslösenden Situationen (wie Erschrecken) abgelenkt werden.
Mit dem Übergang vom Stillen (bzw. einer Ernährung ausschließlich mit Milch) zur Beikost und dann zur gemeinsamen Mahlzeit werden Kinder mit neuen Lebensmitteln und Speisen konfrontiert. Diese Nahrung müssen sie spontan als essbar oder nicht essbar beurteilen (»schluck oder spuck«; Kap. 3.2). Gegenüber einem neuen Geschmack besteht aber eine angeborene Neophobie, und diese wird ebenso durch Neugier wie mithilfe des Hungers überwunden. Das Erkundenkönnen des Essbaren ist daher eine wesentliche Voraussetzung für die weitere Essentwicklung.
Mit dem selbstständigen Essen und mit der Entscheidung des Kindes darüber, was es essen möchte, und später mit der Zubereitung und weiteren, das Essen begleitenden Aktivitäten, kann ein Kind entscheidende Erfahrungen seiner Selbstwirksamkeit sowie seiner Selbstbestimmung und Autonomie machen.
Auch die Entwicklung des sog. prosozialen Motivs wird durch gemeinsames Essen – durch verschiedene Handlungen und Abläufe durchaus unterschiedlich – gefördert: Zwischen den Kindern wird geteilt, ihnen wird Essen gereicht, und auf ihre individuellen Interessen wird Rücksicht genommen. Dabei haben die Handlungen und Ereignisse während eines gemeinsamen Essens wiederum Auswirkungen auf das zukünftige Essverhalten ebenso wie die Erfahrungen des Teilens oder auch des Übervorteilt-Werdens.
Sobald ein Kind merkt, dass der Bezugsperson wichtig ist, dass die angebotenen Speisen auch gegessen werden, kann das Kind dies als Mittel zu Macht bzw. zur Entwicklung von Autonomie und Selbstbestimmung nutzen. Solange Not herrschte, waren Kinder dankbar, zu essen zu bekommen. Seit das »richtige Essen« ein Erziehungsprogramm wurde, diente es auch der Erziehung der Eltern (und anderer Bezugspersonen) durch das Kind, das seinen Willen und seine Präferenzen durchsetzen möchte (vgl. auch Gutknecht & Höhn, 2017; Juul, 2002; Pudel, 2002b). In der KiTa wird dieser »Kampf« nicht so entschieden ausgetragen wie am Familientisch. Viele Eltern sind daher erstaunt, wenn sie hören oder beobachten, dass ihr Kind in der KiTa Speisen akzeptiert, die es zuhause entschieden ablehnt.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass spätestens nach dem Abstillen Essen nicht mehr allein ein physisches Motiv ist. Essen bietet Situationen nicht nur für die Gleichzeitigkeit von Motiven, sondern auch für die Wechselwirkungen aller grundlegenden Motive bzw. Bedürfnisse. Die inneren Motive sind nicht mehr (allein) verhaltensrelevant, wie dies auch schon im Zusammenhang mit Emotionen diskutiert wurde (zu weiteren Essmotiven Kap. 2.2 u. 3.2). Differenziertere wissenschaftliche Analysen dazu sind allerdings bezogen auf Kinder wenig erforscht. Hilfen für den Umgang mit diesen Motiven im Feld der »biologischen Indifferenz« (Pudel & Westenhöfer, 2003; Kap. 2.2), in dem die biologische Steuerung psychisch und sozial überlagert sein kann bzw. ist, sind für das Essverhalten im Kleinkindalter noch wenig entwickelt (bisher u. a. Gutknecht & Höhn, 2017; Ellrott, 2009a, 2009b; Pudel, 2002b). Allerdings nimmt die Forschung dazu zu ( Kap. 3). Angesichts der zunehmenden Interaktionsprobleme bietet sich hier noch ein breites Forschungsfeld.