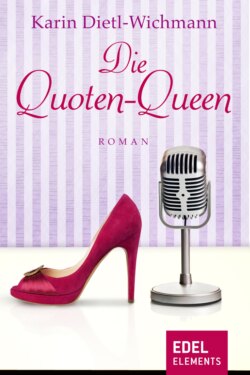Читать книгу Die Quoten-Queen - Karin Dietl-Wichmann - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
ОглавлениеEr überfiel sie jeden Sonntagnachmittag aufs Neue: der ›sunday afternoon blues‹. Dieses nagende Gefühl der Einsamkeit. Die Wochenendausgaben der FAZ und der Süddeutschen waren gelesen, das Frühstücksgeschirr weggeräumt, die nächste Verabredung erst am Abend. Kara Oswald tigerte durch das plötzlich so große und leere Appartement. Es war 14 Uhr, und es gab niemanden, den sie um diese Zeit anrufen konnte. Die Freunde, die verheiratet waren, kümmerten sich um Kind und Kegel. Die Singles tauchten gerade aus den alkoholisierten Umarmungen der ›last night stands‹ auf. Ihre eigene Familie war in alle Welt verstreut. Die Tochter im Internat, der Vater mit seiner neuen Liebe auf Weltreise, und zu keinem ihrer Ex-Ehemänner gab es besonders herzliche Kontakte. Ihren letzten Lover, einen sanftmütigen Versager, hatte sie an ihre Freundin Antonia Salbach abgetreten, und der gegenwärtige, ein manisch-depressiver Bildhauer, erpresste sie ständig emotional. Die Stunden zwischen zwei und sieben Uhr schienen vom Teufel gemacht. Alte Ängste krochen wie Kröten übers Gemüt. Beginnende Depressionen hatten den besten Nährboden.
Die Situation bei TV6, dem Sender, bei dem Kara als Programmchefin engagiert war, machte ihr zu schaffen. Die Zahlen waren seit ein paar Wochen ein Horror, und ob ihre Idee einer neuen Show, die sie gleich am Montag Horst Köhler, ihrem Partner in der Geschäftsführung vortragen wollte, wirklich der dringend benötigte Hit war – Kara wusste es nicht. Seit Wochen wachte sie schweißgebadet auf. Es war immer der gleiche Alptraum. Wie eine Kriminelle war sie entdeckt worden. Sie stand vor einem Gericht, und alle ihre Fehler wurden aufgezählt. Es waren schrecklich viele. Immer wieder versuchte sie etwas zu ihrer Verteidigung zu sagen. Die Richter ließen sie nicht. Dann sprach einer das Urteil. »Sie sind«, sagte der Mann im Traum, »eine Hochstaplerin. Sie haben Fähigkeiten vorgetäuscht, die Sie nicht besitzen. Sie sind ein Nichts. Eine Versagerin!« Mein Gott, dachte Kara im Traum, jetzt wissen es alle. Jetzt wissen alle, dass ich immer nur geblendet habe. Dass ich tatsächlich eine Falschspielerin bin. Sie schämte sich, und die Gewissheit, nicht mehr geliebt und bewundert zu werden, setzte ihr schmerzlich zu. Das war stets die Stelle, an der sie aufwachte. Sie lag dann den Rest der Nacht wach. Fragte sich, wovor sie solche Angst hatte. Ob sie tatsächlich nur täuschte und trickste. Ob es nur Glück gewesen war, dass sie in ihrem Job so hoch gekommen war. Unheimliches Glück. Und dass nun eben dieses Glück sie verlassen hatte. Sich anderen zuwandte.
»Ich muss raus aus dieser Depression«, sagte sie halblaut vor sich hin. Sie probierte es mit Atemübungen. Nach ein paar Versuchen gab sie auch das auf. Ihr Kopf schien zerspringen zu wollen. Sie konnte nicht einen einzigen ihrer jagenden Gedanken festhalten. Das blanke Chaos war ausgebrochen. In diesem wilden Durcheinander versuchte sie den Anfang oder wenigstens das Ende einer Idee zu erhaschen. Sie bemühte sich, einen Satz zu denken, ihn laut auszusprechen.
»Ich darf jetzt nicht durchdrehen«, sagte sie. »Ich muss die Nerven behalten. Es gibt keine unlösbaren Probleme.« Sie schwieg und lauschte ihren Worten hinterher. Sie hallten in ihrem Schädel nach. Kara versuchte dem Rat von Antonia zu folgen. »Denk positiv«, hatte die ihr vor Monaten geraten, als sie einmal nachts in einer ähnlichen Stimmung bei ihr angerufen hatte. »Stell dir Dinge vor, die dich glücklich gemacht haben. Lass dich nicht hineinziehen in diese abgrundtiefen Löcher!«
Verzweifelt durchstöberte sie ihr Hirn nach glücklichen Erlebnissen. Nichts, rein gar nichts fiel ihr ein. Dafür begann sie mit geradezu masochistischer Lust in ihren Wunden zu wühlen. Sie sprang auf, lief zu ihrem Schreibtisch, griff sich das kleine Diktafon und begann mit stockender Stimme zu sprechen: »Es ist Sonntagnachmittag. Einer dieser schrecklichen Nachmittage, die mich eines Tages umbringen werden. Die mir meine Existenz zur Qual machen. Die mich zweifeln lassen an dem, was ich tue. Die mich die Banalität meines Lebens schmerzhaft spüren lassen. Wer bin ich eigentlich? Was habe ich erreicht mit meinen 39 Jahren? Nicht einmal eine funktionierende Ehe habe ich fertig gebracht. Dreimal geschieden, ohne familiäre Bindungen.«
Kara legte das Tonband aus der Hand. Sie ging in die Küche und setzte die Kaffeemaschine in Gang. »Scheiße«, sagte sie halblaut vor sich hin. »Alles Scheiße!« Sie erinnerte sich an ihre drei Ehemänner. Der Erste, den sie mit Anfang zwanzig geheiratet hatte: ein konservativer Schwachkopf. Der Zweite, zu dessen Werbung sie aus Übermut Ja gesagt hatte: ein aufgeblasener Dandy. Und der Dritte, von dem sie gar nicht mehr wusste, weshalb sie ihn überhaupt geheiratet hatte: ein intellektueller Schwätzer. Allesamt Männer, die ihr die Luft zum Atmen nahmen. Von denen sie sich mit brachialer Gewalt befreit hatte. Die Lover, die folgten? Kara lachte bitter auf. Da gab es Alexander, dessen künstlerische Arbeit sie faszinierte. Der sie mit seinen Visionen mitreißen konnte, wie selten ein Mensch zuvor. Der ein wunderbarer Liebhaber war, dessen Schattenseiten sie aber unendlich viel Kraft kosteten. Der in seiner manischen Phase vor Kreativität sprühte. Jeden Kulturreferenten von der Einzigartigkeit einer seiner monumentalen Skulpturen überzeugte, um sich dann in seiner depressiven Phase wie ein Wurm im Erdreich zu verkriechen. Kara machte diese Zyklen seit fast zwei Jahren mit. Immer wieder hatte sie versucht, Alexander in die Wüste zu schicken. Hatte auf seine Anrufe nicht geantwortet, seine Briefe nicht geöffnet. Und dann stand er unangemeldet vor ihrer Tür. Und sie hatte ihm alles verziehen, wohl wissend, dass sich diese Szenen immer wiederholen würden.
»Warum tust du das?«, hatte Antonia sie beschworen. »Dieser Mann ist ein Vampir. Er wird dich aussaugen und dann wegwerfen. Mach Schluss, solange es noch Zeit ist!«
Kara hatte sich oft nach solchen Vorhaltungen einen aus der Schar ihrer Höflinge gepickt. Hatte ihre Nummer: ›wenn du artig bist, darfst du auch zur Königin aufs Lager‹ durchgespielt. Am Schluss kam sie stets zu der Überzeugung, dass diese Art von Affären nur Zeitverschwendung waren.
»Nichts als käufliche, eingebildete Parasiten«, sagte sie dann zu Antonia, die die Brauen hochzog, was so viel hieß wie: Das hab ich dir doch schon vorher gesagt.
Selbst ihr Vater, den sie als Kind so bewundert hatte, entpuppte sich als eitler, selbstgefälliger Schwadroneur, der auf seine alten Tage noch den Sugar-Daddy spielte.
Irgendwie scheine ich kein Händchen für Männer zu haben, überlegte sie, als sie sich den Kaffee eingoss. Die, die sie bewunderten und sich um sie bemühten, gefielen ihr nicht. Alle anderen betrachtete sie voller Misstrauen. So war sie dazu übergegangen, die Männer, die sich unvorsichtigerweise in ihren Umkreis wagten, zu erniedrigen. Sie schlecht zu behandeln. Sie zu korrumpieren und zu kaufen. Sie zeigte ihre ›trophy men‹ herum wie andere eine neue Handtasche. Auf diese Weise konnte sie bei Beendigung einer Affäre voller Verachtung auf die Wichte hinunterschauen. Sie verabscheuen dafür, dass sie ihr Spiel mitgemacht hatten. Dass sie mit sich geschehen ließen, was sie dann letztlich in Karas Augen zu den Lemuren degradierte, die sie im Grunde gar nicht waren.
Kara durchschaute ihr grausames Spiel zwar – konnte es aber nicht stoppen. Sie wusste, dass die negativen Erfahrungen mit Männern selbst inszeniert waren.
»Du hast Angst vor ihnen«, hatte Antonia einmal gesagt. »Du traust deiner Attraktivität nicht. Deshalb kaufst du sie dir. Und auch nur deshalb reagierst du so menschenverachtend. Wenn du das nicht bleiben lässt, wirst du nie eine befriedigende Beziehung haben!«
Kara war zornig gewesen, weil die Freundin in ihrer klaren Art den Nagel auf den Kopf getroffen hatte. Sie hatte sich damals sehr elend gefühlt. Hatte herzzerreißend geschluchzt, beschlossen, ab sofort alles anders zu machen, und schließlich genauso weitergelebt wie bisher. Sie tröstete sich damit, dass die ›richtigen‹, die ›wirklich guten‹ Männer so etwas wie sie gar nicht ertragen könnten. Dass solch ein Mann sie beschneiden würde in ihrer Freiheit, dass er etwas gegen ihren Job hätte und folgerichtig nicht in Frage käme.
»Wir benutzen die Kerle«, gab Antonia immer als Parole aus. »Wir machen es einfach so, wie sie es immer mit den Frauen getan haben: ex und hopp!«
Meistens fühlte sich Kara von solchen Sätzen getröstet. Was will ich eigentlich? fragte sie sich dann. Sie hatte einen Job, der sie forderte, ein dutzend Freunde, von denen sie sich verstanden fühlte, und sie hatte Antonia. Ihr vertraute sie bedingungslos. Sie war ihr Alter Ego. Ihre beste Freundin, ihre Schwester und – seitdem sie Chefin von TV6 war – auch ihre bevorzugte Mitarbeiterin. Zwischen ihnen gab es keine Geheimnisse, keinen Neid, keine bösen Gedanken. Antonia war aufrichtig und loyal. Ohne sich mit ihr zu besprechen, würde Kara keine wichtige Entscheidung mehr treffen.
Kara, die keine Geschwister hatte, sehnte sich nach familiärer Wärme. Nie würde sie die Zeit vergessen, als Antonia und sie zusammenlebten. Diese gemeinsamen Abende, an denen sie beim Wein auf dem Sofa kuschelten und über ihre Pläne sprachen. An denen Antonia sie liebevoll aufrichtete, wenn sie eine Reportage neu schreiben musste oder ein Kerl sich ihren Reizen entzog. Antonia gab ihr immer das Gefühl, die Beste zu sein. Vielleicht nur noch ein Treppchen weit vom großen Sieg entfernt zu sein. Niemals meldete sie Zweifel an Karas Fähigkeiten an. Niemals an ihrem Draufgängertum. Im Gegenteil: »Du bist die geborene Macha«, bestärkte sie die Freundin, wenn diese wie Hans Albers in ›Hoppla jetzt komm ich‹-Manier auf den Kriegspfad ging. Als sie ihre erste Chefposition angeboten bekam und zweifelte, ob sie der Sache überhaupt gewachsen sei, meinte Antonia: »Du kannst das. Und wenn nicht, hast du wenigstens die Chance ergriffen!« Manchmal dachte Kara, Antonia war so etwas wie die stets beschworene ›kluge Frau‹, die angeblich hinter jedem erfolgreichen Mann steht. Und auch als Kara endlich ganz oben angekommen war, konnte sie auf Antonia nicht verzichten. Sie beschäftigte die Freundin als Reporterin und Moderatorin in ihrem Sender. Antonia war das einzige menschliche Regulativ, das sie in ihrem Höhenrausch noch hatte. Nach dem sie gierte, weil es sie in der Kälte ihrer Position mit Wärme versorgte. Weil auf ein hysterisches »Ich schaff das nicht mehr« ihrerseits ein liebevolles »Das wäre doch gelacht« von der Freundin kam. Kara fühlte sich verlassen, wenn Antonia auf Reisen war. Sie wartete ungeduldig auf deren Rückkehr.
Bei Antonia musste sie keine Rolle spielen. Musste nicht klug, nicht fabelhaft, nicht amüsant sein. Sie konnte von banalen Träumen sprechen, ohne Verrat fürchten zu müssen.
Antonia war gescheit und diskret. Sie war nicht wie Kara darauf angewiesen, geliebt zu werden. Niemals liebte sie so wie Kara: so leidenschaftlich und maßlos. Antonia ließ sich lieben. Huldvoll und sehr fern – für den, der sich nach ihr verzehrte. Ein flüchtig benutzter Liebhaber hatte ein Buch über seine Beziehung zu Antonia geschrieben. Er gab ihm den Titel ›Tiefgefroren‹.
Als Antonia, der das Werk gewidmet war, das Buch las, lachte sie spöttisch: »Tiefgefroren, wie klug er das erkannt hat!«, sagte sie.
Trotz dieser Vereisungen von Antonia war Kara sicher, dass sie selbst zu den wenigen Menschen gehörte, die ihre Freundin liebte. Für die ihre kühle Freundin ein ebenso familiäres Gefühl entwickelte wie sie. Diese Sicherheit, dass ihr, egal was auch immer geschähe, Antonias Zuneigung gewiss wäre, ließ Kara ihren einsamen Job besser ertragen.
Und jetzt war ihr danach, mit Antonia zu sprechen. Jetzt sofort. Sie wählte Antonias Nummer. »Geh schon ran«, dachte Kara. »Sei wenigstens zu Hause!«
Als Antonia antwortete, wurde ihr sofort wohler. Sie liebte diese helle, mädchenhafte Stimme. Jetzt mit Antonia zu sprechen, hieß die Dämonen zu bannen, nicht verloren zu sein. Das rettende Ufer erreicht zu haben.
Antonia schien ihren Anruf erwartet zu haben.
»Diesmal hast du deine Isolationshaft eine Stunde länger ertragen«, sagte sie und hatte ein Kieksen in der Stimme, das sie immer dann bekam, wenn sie etwas sehr amüsierte.
»Spotte nur«, sagte Kara, »mich haben schon wieder alle Sonntagsmörder gewürgt. An irgendeinem dieser grässlichen Sonntagnachmittage werde ich verrückt werden. Lach nicht, ich weiß das genau. Dann werde ich schreiend und nackt auf die Straße laufen und endlich meinen dröhnenden Kopf nicht mehr spüren!«
»Was macht dich eigentlich so kirre, Kara?«, fragte Antonia, noch immer belustigt. »Du könntest doch bei einer Tasse Tee in einem deiner teuren Sessel sitzen, Musik hören und dich deines Lebens freuen!«
Kara hörte, wie Antonia sich eine Zigarette anzündete. Die Freundin war ihr so nah, dass sie glaubte, den süßlichen Geruch dieser schrecklichen orientalischen Dinger zu riechen. Sie wusste, dass Antonia, wahrscheinlich in einem Kimono gehüllt, auf dem einzigen Sessel ihrer völlig improvisierten Wohnung kauerte. In den fast zwanzig Jahren ihrer Freundschaft hatte Antonia es noch nie fertig gebracht, sich ein Zuhause zu schaffen.
Sie war von einer Stadt in die andere gewechselt. Hatte Wohnungen, kaum dass sie bezogen waren, wieder verlassen, um sich schließlich mit ihrem wenigen Mobiliar in einem wahllos ausgesuchten Appartement neu zu installieren. Wenn Kara sich über diese Unrast wunderte, entgegnete Antonia meist: »Ich bin noch nicht angekommen. Am liebsten würde ich mit einem Wohnwagen durch die Welt ziehen. Heute hier – morgen dort!«
Kara kam sich bei solchen Gesprächen mit ihrem Drang, sich in jeder Stadt, die sie liebte, heimisch einzurichten, spießig vor. Sie reagierte dann genauso aggressiv wie jetzt auf die Vorhaltung von Antonia.
»Was willst du?«, fragte sie mit erhobener Stimme. »Dass ich mir, nur weil mir hin und wieder die Decke auf den Kopf fällt, einen Kerl anlache, der sich bei mir breit macht? Der abends lauert, bis ich aus dem Sender komme, um mich mit dümmlich erwartungsvollem Lächeln und einer Flasche Sekt empfängt?«
»Würde dir Jahrgangschampagner besser gefallen?«, fragte Antonia leicht süffisant.
»Ach komm!« Kara mochte nicht auf den lockeren Tonfall der Freundin eingehen. »Du weißt doch genau, was die Schwierigkeit ist. Ich habe zu lange allein gelebt und kann mich nicht mehr anpassen. Auf der anderen Seite werde ich hundsordinär neidisch, wenn ich glückliche Paare sehe. Unter der Woche geht’s ja. Da kann ich kaum schnaufen vor Arbeit. Aber wehe, ich hab mal eine Stunde Freizeit – dann laufen meine sämtlichen unerfüllten Hoffnungen Amok!«
»Schau mal«, sagte Antonia, »allein bist du doch wirklich nicht. Du hast eine Menge guter Freunde. Und du hast mich. Ich bin doch wirklich immer für dich da! Und nun sag schon: Gibt es einen aktuellen Grund, weshalb du dich mies fühlst?«
»Na ja – was heißt aktuell?« Kara spürte, dass ihr allein vom Reden leichter wurde. »Du weißt ja, wie es um den Sender steht. Wir brauchen einen Hit, und das sehr schnell! Sonst drehen uns die zauberhaften Eigner den Strom ab.«
»Und?«, fragte Antonia, »ist dir etwas eingefallen?«
»Ich denke schon. Können wir uns nicht treffen? Ich möchte hören, was du darüber denkst!«
Kara hörte, wie Antonia leise stöhnte. Sofort war dieses beklemmende Gefühl wieder da.
»Manchmal bist du wie ein trotziges Kind«, seufzte Antonia. »Ich bin verabredet. Jetzt werde nur nicht gleich wieder sauer. Ich will mit Roswitha ins Kino gehen. Komm doch einfach mit.«
»Ich habe andere Probleme«, sagte Kara gereizt. »Ich muss mir etwas einfallen lassen. Hast du nicht vorher Zeit? Ich meine jetzt! Wir könnten einen Kaffee im Hofgarten trinken. Du hörst dir meine Idee an und sagst, wie sie dir gefällt. In einer halben Stunde? Okay?«
Kara war sich nicht bewusst, welchen Druck sie auf die Freundin ausübte. Es wäre ihr auch gleichgültig gewesen. Sie konnte keine Minute mehr allein sein. Sie wollte Antonia sehen, mit ihr reden und danach, am Abend, hatte sie selbst wieder eine Verabredung. Dann wäre die grauenvolle Leere überstanden.
Und Antonia beugte sich wie immer dieser Nötigung.