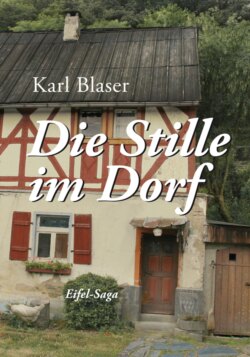Читать книгу Die Stille im Dorf - Karl Blaser - Страница 8
4
ОглавлениеDezember 1944/Januar 1945
Während am Heiligen Abend im Ruhrgebiet Bomben fallen, im Osten die Flucht weiter geht, die Lagerwachen »Oh du fröhliche« singen, in Budapest die Pfeilkreuzler alle noch lebenden Juden ans Ufer der Donau treiben und kaltblütig erschießen, während Pius XII. in Rom das Weihnachtsfest erstmals im Freien stattfinden lässt und eine Ansprache hält, die Menschen in Paris wieder Freiheit atmen und auf die Musik des amerikanischen Majors Glenn Miller warten, der in dieser Nacht bei schlechtem Wetter auf dem Flug von England in den Ärmelkanal abstürzen wird, während das Heilige Fest in Moskau wegen des orthodoxen eigenen Kalenders noch bevorsteht, holt Anne-Kathrin das beste Kleid aus ihrem Schrank hervor, wirft sich den dicken Mantel über und stapft hinaus in die kalte Nacht. Sie ist bei Johann und ihrer Cousine Anna eingeladen. Im Wohnzimmer des Ortsbauernführers haben sich dessen Schwester Mathilde mit ihrem Mann Will Bommersbach und ihrer Tochter Lissy einquartiert – im November haben die Bomben sie obdachlos gemacht und aus dem Eifelstädtchen Mayen vertrieben.
Anna hat den Tisch mit grünen Zweigen geschmückt. Hier sitzen sie beisammen hinter abgedunkelten Fenstern vor dem Weihnachtsbaum, der in diesem Jahr keine Kerzen trägt, weil es der Ortsbauernführer verboten hat. Unter dem Baum steht die Krippe mit Maria und Josef und dem Jesulein in Bethlehems Stall, darüber der Stern, von dem es heißt, dass er den Hirten auf dem Feld den Weg zum Kuhstall gewiesen haben soll.
In Johanns warmer Stube duftet es nach Lebkuchen.
»Habt ihr die Plätzchen selbst gebacken?«, fragt Anne-Kathrin.
»Ja«, antwortet Anna, »für Marek und Marsena, unsere Polen, hat Weihnachten übrigens schon im November begonnen«, erzählt sie. »Ich habe Marsena über die Schulter geschaut, als sie Rote-Beete-Knollen angesetzt und behauptet hat, daraus würde eine Suppe entstehen. Borschtsch, oder so ähnlich, hat sie die Brühe genannt. Igittigitt, habe ich gesagt, und das soll schmecken?«
Die Polen seien ein seltsames Volk. Sie schüttelt sich und lacht.
»Ja, hat er gesagt: Polnisch Suppe aus viele ‚Burakow‘. Gott vergib uns, habe ich im Stillen gefleht. Das kann ja nichts werden: Suppe aus roten Rüben!«
»Wenn’s nicht schmeckt, bekommt ihr drei Wochen Schweinearrest, drohte ich ihm an«, mischt sich Johann ein.
»Und dann haben wir zugeschaut, wie sie kleine Teigtaschen geformt und mit Steinpilzen gefüllt hat. Die sehen schon besser aus, dachte ich, richtige kleine Kunstwerke aus Teig, gefüllt mit Steinpilzen. Marek und seine Tochter Hanka haben sie im Sommer auf den Wiesen gesammelt, dann getrocknet und wieder aufgeweicht. Ich habe versucht, nachzusprechen, wie er sie genannt hat: Uszchhkschhha ...«
»Lass es«, unterbricht Johann sie. »Ich hab’s dir doch schon mal gesagt: Versuch es besser mal mit richtigem Deutsch.«
Er lacht, sieht Beifall heischend in die Runde. Aber niemand reagiert.
Am Vierundzwanzigsten kommt also Borschtsch auf den Tisch. Anne-Kathrin sieht mit großen Augen zu, wie Anna vorsichtig die Suppe serviert, die sie nur noch erhitzt hat.
»Wo sind die Polen? Wo stecken Marek und seine Familie?«, will Anne-Kathrin wissen. »Sie sind so fleißig.«
»Die hat Vater im Kuhstall eingesperrt«, antwortet Margarete.
Gross sieht seine Tochter an und grinst schamlos.
»Das ist die polnische Krippe, da ist es warm. Maria und Josef haben ja auch klein angefangen, damals in Bethlehem«, antwortet er.
»Jeder erst mal eine Kelle«, sagt Mathilde. »Lasst uns jetzt nicht über die Polen reden.«
»Ich erst mal nicht.«
Anne-Kathrin hält die Hand schützend über ihren Teller.
»Wehe, es schmeckt nicht! Dann kann die Polin was erleben!«
Johann starrt skeptisch auf die dunkelrote Flüssigkeit in seinem Teller.
»Das hat’s in der Eifel noch nie zu essen gegeben«, sagt Will und reibt sich den Oberarm.
Als Kind hatte er einen Unfall, über den er nie spricht. Seither muss er mit einem verkrüppelten Arm leben. Er hatte sich gleich zu Kriegsbeginn als Freiwilliger zum Fronteinsatz gemeldet, wurde jedoch als wehruntauglich abgelehnt. Anders sein Sohn Wilfried: Der große, blonde Hüne hatte sich 1939 zur Waffen-SS gemeldet. In Krakau, erzählt Will, sei er eine große Nummer. Wilfried sei zur Sicherung der besetzten Gebiete abkommandiert worden. Er führe dort einen heroischen Kampf gegen Partisanen und andere Gegner des unbesiegbaren ewigen Führerreichs. Seine Blutgruppe, hat er mit der Feldpost geschrieben, sei auf der Innenseite des linken Oberarms eintätowiert.
»Gut so«, schwafelt Will. »Unser Bub gehört zu Hitlers Elite!«
»Vielleicht ist’s ja auch das erste und das letzte Mal, dass wir diese unaussprechliche Brühe essen.«
Johann nimmt eine Löffelprobe. Er kaut auf der Suppe.
»Und?«, fragt Mathilde.
»Gar nicht schlecht«, sagt er. »Hätte ich nicht gedacht!«
»Schmeckt gut«, befindet auch Lissy.
Sie hat ihr dichtes blondes Haar zu einem Zopf zusammengebunden.
»Passt auf, passt auf, Kinder! Das gibt knallrote Flecken auf der Tischdecke. Die gehen nicht mehr raus«, ruft Anna.
»Egal, Hauptsache, es mundet«, sagt Will vornehm.
Er nimmt sich einen kräftigen Nachschlag. Diese rote Suppe mit den Schweinsöhrchen sei köstlich, da hätten die Polen den Deutschen was voraus.
»Du musst nicht gleich übertreiben, Will, wenn dein Bauch grummelt«, erteilt ihm Johann spöttisch einen Dämpfer.
»Jetzt kommt was Deutsches«, ruft Mathilde.
Ihre dicken Backen glänzen. Sie hat jedem von ihnen einen Teller mit Rotkohl, Kartoffeln und etwas fetten Schweinebauch vorgesetzt, den sie hier ‚Bauchlappen‘ nennen. Fast im Dunkeln leeren sie die Teller.
»Das nächste Mal an Weihnachten ist Margarete für die Küche zuständig«, sagt Mathilde.
Margarete schweigt. Da können sie lange drauf warten, denkt sie. Anna sieht Mathilde mit einem gezwungenen Lächeln an. Sie weiß doch, dass Margarete seit ihrem Fenstersturz an Kopfschmerzen leidet. Jetzt nur nicht das Kochthema vertiefen, dann ist der Heilige Abend gelaufen. Die Mutter hat es aufgegeben, ihr das Kochen beizubringen. Zwecklos ist das.
»Margarete hat Kopf«, pflegt sie zu antworten, wenn einer fragt, warum ihre Tochter die heiße Herdplatte meidet wie die Katze.
Es hat sich längst im Dorf herumgesprochen, keiner fragt mehr. Anna stimmt ein Weihnachtslied an, voller Andacht singen sie ‘Stille Nacht, Heilige Nacht’.
Nirgends ist die Nacht so still wie hier in diesem Dorf.
Im Stall schlafen die Polen bei Kuh und Ochs.
Über der Eifel leuchtet kein Stern.
*
Der 2. Januar 1945 ist ein kalter Wintertag, verharschter Schnee liegt auf den Feldern, darüber strahlt der Himmel, blau und trügerisch. An diesem Tag, friedlich wie ein Sonntag in Frankreich, wo die Männer munter zum Angeln gehen, machen sich Anne-Kathrin und Mathilde mit ihren klapprigen Fahrrädern auf den Weg in die Stadt. Mit einem Bezugsschein wollen sie ein paar Besorgungen erledigen, auf jeden Fall eine dicke Unterhose für Will herschaffen, der in letzter Zeit immer friert, und, wenn sie es finden sollten, weißes Nähgarn für Anna. Sie wollen gerade das Geschäft in der Marktstraße betreten, als die Sirenen heulen: Bombenalarm. Die Stadt liegt zu diesem Zeitpunkt bereits seit Wochen unter andauerndem Beschuss aus der Luft. Meist richten sich die Attacken gegen die Eisenbahnbrücke im Nettetal, um der Deutschen Armee den Nachschubweg in die Ardennen abzuschneiden.
»Wir hätten nicht fahren sollen. Wir stecken mitten drin im Schlamassel«, jammert Anne-Kathrin.
»Und genau da müssen wir jetzt wieder raus«, sagt Mathilde beherzt. »Ich lass mir doch Wills Höschen nicht mehr wegnehmen. Komm! Beeil dich! Nicht dahin, nur nicht in den Bunker unter der Burg«, ruft sie und greift nach Anne-Kathrins Hand. »Schnell, schnell! Die verdammten Bunker sind nicht mehr sicher!«
Sie lassen ihre Fahrräder am Straßenrand liegen. Zu Fuß laufen sie den Weg hoch bis zur ‚Waldesruh‘, einem Wäldchen oberhalb der Stadt. Neben einem Himbeerbusch sinken sie in den kalten Schnee, halten den Atem an, als sie, von der Mosel herkommend, die US-Bomber erkennen, im tiefen Anflug auf die wehrlose Stadt, einer nach dem andern klinkt seine Spreng- und Brandbomben aus, die auf die Dächer regnen. Steine und Erdreich fliegen durch die Luft. Der kleine Marktflecken in der Eifel, er brennt lichterloh, als die Flugträger, Anne-Kathrin und Mathilde können sie nicht zählen, nach nur wenigen Minuten wieder abdrehen und in den Wolken wie im Nichts verschwinden.
»Die armen Menschen, die armen Menschen, was haben sie euch getan! Verbrecher!«
Anne-Kathrin kommen die Tränen.
Der schiefe Kirchturm von St. Clemens wird getroffen. Die Frauen sehen, wie er in sich zusammensackt, Häuser, Brücken, Menschen stehen in Flammen. Eine dicke Staubwolke hängt über der Stadt. Das Dröhnen der Bomber ist verhallt, als die Frauen es wagen, ihre Fahrräder zu holen, um sich auf den Heimweg zu machen. In Mathildes Tasche, die über ihrer Schulter baumelt, liegt die wollene Unterhose für Will.
»Verdammt knapp«, seufzt Anne-Kathrin. Sie schiebt ihr Fahrgestell in den Hof.
»Hauptsache, unsere ‚Aktion Unterhose‘ war erfolgreich, und Will jammert nicht mehr ständig rum«, erwidert Mathilde. Ein jammernder Ehemann sei schlimmer als Bombenalarm.
Noch Wochen nach dem überraschenden Angriff steigt, so ist zu hören, feiner gekräuselter Rauch aus den Schuttbergen auf, Flammen züngeln in den kalten Januarhimmel. Mit Kinderwagen, in denen sie alles verstaut haben, was ihnen geblieben ist, irren zerrissene Gestalten Tag und Nacht durch die Trümmer, suchen eine Bleibe und betrauern jene, die es nicht bis in einen der Schutzräume geschafft haben. Herrenlose Tiere laufen umher.
Manche hätten ihre Wohnungen einfach nicht verlassen. Sie seien verbrannt, heißt es.
Mayen wird zur ‚toten Stadt‘ erklärt.
*
Im Dorf wartet Anne-Kathrin weiter auf Niklas. Den Rosenkranz in der Hand, sitzt sie in der Küche auf dem Stuhl neben dem Ofen. An diesem Morgen, vielleicht sind es zwei, vielleicht drei Wochen her, so genau kann sich niemand mehr erinnern, wann die Bomben auf die Stadt gefallen waren, sieht Anne-Kathrin vom Küchenfenster aus den Ortsbauernführer Gross direkt auf ihr Haus zukommen.
Er kramt einen Brief aus der abgewetzten Ledertasche hervor, die von seiner rechten Schulter herunterbaumelt. Johann schaut auf den Umschlag, dann auf das Haus, als wolle er sich noch einmal vergewissern, dass es wirklich das richtige sei. Wie viele dieser Standardbriefe hat er heute in der schwarzen Tasche? Anne-Kathrin will nicht, dass er bei ihr anklopft. Sie ahnt, welche Nachricht der Mann ihr überbringen wird.
»Geh weiter, geh weiter, geh weiter«, murmelt sie in ihren Rosenkranz.
Aber Johann tut ihr den Gefallen nicht. Er klopft forsch an ihre Tür, nach einigem Zögern öffnet sie ihm das Haus.
»Darf ich reinkommen?«, fragt er mit gesenktem Blick.
Sie nickt. Auch ihre Augen sind auf den Boden gerichtet.
»Du kennst mich. Du weißt, dass ich es mir nicht leichtmache«, sagt er.
Gleichzeitig drückt er ihr den Brief in die Hand.
»Muss ich ihn nehmen?«, fragt sie, fast kaum hörbar.
Johann zögert mit der Antwort.
»Ja, du musst ihn nehmen. Wir müssen alle stark sein.«
»Ja, natürlich«, murmelt sie. »Wir haben das zu ertragen.«
»Es tut mir leid«, sagt Johann noch, als er schon wieder in der Haustür steht.
Er fährt sich durch die zerzausten Haare und wischt sich die feuchten Hände an seiner Hose ab. Er müsse weiter, sagt er verlegen, und huscht ins Freie.
Anne-Kathrin schaut ihm durch das verschlossene Fenster hinterher, den Brief in der Hand. Sie reißt sich die Arbeitsschürze vom Leib und schleudert sie in die Ecke. Als der Ortsbauernführer außer Sichtweite ist, verschließt sie die Tür, zieht die Gardinen zu, als wolle sie sich verschanzen. Sie legt den Umschlag behutsam vor sich auf den Tisch. Sie starrt ihn an. Das Atmen fällt ihr schwer. Schweißperlen tropfen von ihren roten Wangen.
Sie ballt die Fäuste, beißt auf die Zähne. »Nein! Nein, nein«, sagt sie immer und immer wieder. In ihrem Innern brodelt ein Vulkan. So vergehen die Stunden. Langsam. Warum soll sie den Umschlag öffnen, fragt sie sich. Soll sie ihn ins Feuer werfen? Die Wahrheit verbrennen, damit ihre Hoffnung weiterleben kann? Sie starrt auf das Papier. Was für einen Sinn haben diese vorgedruckten Briefe? Als es dunkel wird, nimmt sie ein Messer. Wäre es nicht besser, es ins eigene Herz zu rammen als diesen Brief zu öffnen, fragt sie sich. Widerwillig öffnet sie schließlich den Umschlag. Einmal, zweimal, dreimal liest sie die wenigen Zeilen, die langsam vor ihren Augen verschwimmen. Dann gleitet ihr der Bogen aus den kraftlosen Händen und fällt zu Boden. Die Schäferhündin schnuppert daran.
»Warum haben wir ihn nur ziehen lassen, Penelope? Warum?«
Die Hündin schaut ihr mit treuen Augen nach, als Anne-Kathrin hinaus auf die Straße stürzt.
»Es ist meine Schuld, allein meine Schuld«, schreit sie laut. »Mein Gott! Mein Gott!«
Sie stolpert, fällt auf das nasse Pflaster. Warum hat sie denn überhaupt gebetet, wenn doch alles sinnlos ist? Mit beiden Händen trommelt sie auf die kalte Erde, als solle sie sich öffnen.
Anne-Kathrins kleiner Winkelhof liegt direkt neben der Kirche mit dem hohen Turm, dem Wahrzeichen des alten Haufendorfs. Um den Kirchturm herum gruppieren sich die Bauernhöfe und die Straßen der Siedlung. Anne-Kathrin und Johann wohnen nicht weit voneinander, das schwere Hoftor des reichen Bauern ist meist verschlossen. Jetzt öffnet es sich. Margarete wirft einen Blick nach draußen und läuft die Straße hinab.
»Stimmt es? Stimmt es wirklich?«, will sie von Anne-Kathrin wissen.
Anne-Kathrin sieht Margarete fragend, mit rotunterlaufenen, verweinten Augen an. Was soll sie ihr sagen? Beiden blutet das Herz. Beiden ist der liebste Schatz genommen, den sie auf Erden hatten. Beide sind jetzt arm. Und doch ist Anne-Kathrin unfähig und auch nicht willens, ihre Trauer mit der jungen Frau zu teilen. Als Margarete die Hand auf Anne-Kathrins Schultern legt, weist Anne-Kathrin sie ab. Niklas Mutter will sich nicht von diesem Mädchen trösten lassen. Margarete hält weinend die Hände vors Gesicht. Sie dreht sich hilflos weg und läuft gebückt zurück nach Hause, wo sie sich in ihrem Zimmer verbarrikadiert und wo niemand verstehen kann, warum ihr der Tod dieses Soldaten so nahegeht.
Mathilde und Anna eilen schließlich herbei. Sie heben die Mutter aus dem Dreck. Auch andere Nachbarsfrauen kommen und stehen hilflos herum.
»Sie hätte ihn nicht wieder gehen lassen dürfen«, wispert eine Stimme.
»So ist der Krieg: gefräßig und ungerecht«, sagt eine andere.
»Komm, wir gehen ins Haus«, flüstert Mathilde. »Es ist nicht deine Schuld.«
»Doch, doch!«, stammelt Anne-Kathrin. »Es ist meine Schuld!«
Sie ballt ihre Fäuste und reckt sie hoch gegen den verwaisten Turm.
»Ich kann dir nicht mehr glauben«, schreit sie verzweifelt in den kalten grauen Himmel. »Antworte! Antworte mir! Du sollst mir antworten! Goooooott!«
Sie drückt ihr verweintes Gesicht an Mathildes Brust.
»Warum nur haben wir dieser braunen Bande geglaubt?«, schluchzt sie.
»Weil wir ihr glauben wollten«, antwortet Mathilde.
Anne-Kathrin gibt sich mit dieser Antwort nicht zufrieden. Nur widerwillig lässt sie sich ins Haus führen. Anna kehrt wieder zurück auf ihren Hof, um nach Margarete zu schauen. Sie hat Angst, dass ihre Tochter sich etwas antun könnte.
»Alles wird gut«, sagt Mathilde.
Allein sitzt sie mit Anne-Kathrin am Küchentisch.
»Die den Krieg säen, frisst er zum Schluss«, flüstert die Elende. »Nichts wird mehr gut, niemals!«
Wie viele Söhne werden noch fallen, denkt sie. Am Abend läutet die Glocke im Dorf zum neunten Mal.