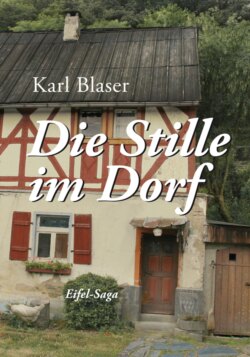Читать книгу Die Stille im Dorf - Karl Blaser - Страница 9
5
ОглавлениеAnfang März 1945
Margarete schläft noch tief, als über ihrem Haus der Tag erwacht. Der Frühling liegt in der Luft. Er hat nun endlich über den viel zu langen Winter gesiegt. Ein leichter Wind weht Grüße durch das offene Fenster herein, und in den Öfen erlischt langsam die Glut. Mitte, manchmal sogar Ende März wird das Gras allmählich grün, als würden unsichtbare Hände es übermalen wie das Gesicht einer blassen Frau, die morgens vor dem Spiegel sitzt und ihre Haare kämmt. Aber noch ist es nicht so weit. Nur vorsichtig trägt die Natur Schminke auf, nur zaghaft recken sich die ersten Halme in den herrlich-blauen Himmel. Es ist kein tiefes, kräftiges Blau, wie man es vom Meer her kennt; es ist ein zartes, pastellfarbenes Blau, mit einem Schuss Weiß gemischt, wie zufällig dahingewischt mit schneller Hand. Im Traum kann sich Margaretes Blick nicht davon lösen. Sie muss es immerzu ansehen, weil es hier oben in dieser Welt, die nicht für Menschen geschaffen scheint, so selten ist.
Margarete träumt. Sie fährt zusammen mit Niklas über das sanfte Land. Penelope läuft dem Wagengespann hinterher, am Waldrand steigen sie ab, legen sich in den Schatten, ihre Münder berühren sich, eng schmiegen sie ihre Körper aneinander. Sie spürt seinen Atem, Niklas flüstert ihr leise ins Ohr. Er will Kinder mit ihr haben, viele Kinder! Er greift nach ihrer Hand.
»Eins, zwei, drei, vier«, zählt er.
Er schaut tief in ihre Augen. Sie hält verschämt die Hand vors Gesicht. Niklas übersät ihren Körper mit Küssen, und sie lässt es geschehen.
Über ihr die Wolken, der Himmel und das Zwitschern der Vögel. Am Wiesenrand grast der Ochse. Da schlägt sie die Augen auf.
Niklas!
Er war da!
Er war bei mir!
Mit ihm hatte sie sich eine gemeinsame Zukunft vorstellen können. Sie spürt seine Haut. Sie fühlt seine weichen Lippen. Sie vermisst ihn so sehr!
»Wenn ich wiederkomme, werden wir aufhören mit dieser Heimlichtuerei«, hatte er versprochen und ihr zum Abschied ein kleines, schlichtes Holzkreuz geschenkt, das er aus einem heruntergefallenen trockenen Ast der alten Kastanie in Johanns Hof selbst geschnitzt hatte. Wie jeden Morgen kramt sie es aus der Nachttischschublade hervor. Sie hat es versteckt, wickelt es aus dem Handtuch und umklammert es fest mit ihren Händen. Hoffen. Hoffen, hoffen. Nicht bangen, sagt sie sich. Vielleicht klopft es bald an der Tür. Vielleicht steht Niklas bald wieder lächelnd vor ihr und nimmt sie bei der Hand. Vielleicht ist er gar nicht tot, wie alle sagen.
Ihre müden Augen wandern die graue Zimmerdecke entlang, als würden sie dort oben kleben, die schönen Spuren ihres Schlafs. Aber ihr Traum, ist er nicht längst ausgeträumt? Der Krieg, er tobt nun schon seit sechs Jahren, und über den Frühling, der jeden Tag ein wenig näher rückt wie der Feind aus dem Westen, mag sich im Dorf niemand freuen. Die Menschen stehen abends vor dem Dorfbrunnen und machen sich gegenseitig Mut. Die Frauen stimmen alte Volkslieder an. »Hoch auf dem gelben Wagen«, juchzen sie und »Es sah ein Knab ein Röslein steh’n.« So schlimm kann es doch nicht werden, hoffen sie. Nur Christel, die Sakristeigehilfin, bleibt unerbittlich und kontert mit apokalyptischen Versen aus der Bibel, bis Johann ihr Einhalt gebietet und ihr in harschem Ton befiehlt, sie solle endlich still sein.
Die knorrigen Äste der alten Kastanie ragen in den verregneten Märzhimmel. Der Himmel ist wolkenlos und stumpf. Margarete hat Kopfweh. Unten in der Küche haben alle bloß Sorge um ihren Bruder Micha, alle Gespräche drehen sich nur um ihn, der zu den wenigen gehört, von denen noch keine Todes- oder Vermisstennachricht das Dorf erreicht hat. Margarete spricht ein Gebet. Aber sie weiß: Dieser Gott erhört nicht jedes Gebet. Margarete ist froh, dass zumindest Niklas‘ Mutter Anne-Kathrin ihre Trauer etwas überwunden zu haben scheint. Das berichtet zumindest Mathilde, die sie regelmäßig besucht. Mathilde sagt, dass Anne-Kathrin wieder ab und zu lachen könne. Auch sie, Margarete, müsse Niklas vergessen. Das sagt sich so leicht. Vergessen. Vergessen kann nur ein Hund. Man sieht sie jetzt öfters sonntags mit Hanka spazieren gehen, die versucht, ihr Polnisch beizubringen. Immerhin kann sie nach Monaten schon bis drei zählen: jeden, dwa, trzy. Das polnische Zahlwort für vier, cztery, kann sich Margarete allerdings schon nicht mehr merken. Die polnischen Wörter sind viel zu schwer, als dass sie in einem Kopf, der immerhin einem Fenstersturz getrotzt hat, haften blieben. Seit jenem Tag im April 1944 fällt es Margarete schwer, sich zu konzentrieren. Da klopft es an der Tür. Die Mutter kommt in ihr Zimmer.
»Kocham cie, mama«, sagt Margarete und lacht.
»Was heißt das?«, will Anna wissen.
»Das ist Polnisch und bedeutet: ‚Ich liebe dich, Mutter‘.«
Anna fällt ihrer Tochter um den Hals.
»Du bist mein ein und alles«, antwortet sie. »Mein ein und alles. Ich will, dass du glücklich wirst.«
Margarete steht auf. Sie schlurft zum Waschtisch, füllt Wasser in die Zinkschüssel, wischt sich den Schlaf aus den Augen. Sie sieht in den Spiegel. Eine braune Haarsträhne fällt in ihr rundes Gesicht, sie lächelt wehmütig und erinnert sich: War er nicht schön, dieser winzige Augenblick, als sie sich unsterblich in Niklas verliebte? Auf dem Bett sitzt Anna. Fremd schaut sie der Tochter zu.
»Warst du auch einmal glücklich, Mutter?«
Margarete setzt sich zu ihr aufs Bett. Anna greift nach ihrer Hand. Mit einem tiefen Seufzer beginnt sie zu erzählen.
»Das ist schon lange her, mein Kind. Aber ja, natürlich war ich einmal glücklich, als junges Mädchen. Da war ich etwa so alt wie du. Damals, zwischen den Kriegen, da waren die Zeiten auch hart. An der New Yorker Börse sanken die Aktien. Die Reichsmark war von einem Tag auf den anderen nur noch einen Strohhalm wert.«
Anna starrt vor sich hin, als erblicke sie in einer Kugel ihre Vergangenheit. Sie erinnert sich genau an diesen hellen Julimorgen 1920: Zwei Jahre war es her, seit der Erste Weltkrieg zu Ende gegangen war.
»Ich war fünfundzwanzig Jahre alt und noch immer ein naives Huhn.«
»Was ist damals passiert?«, fragt Margarete.
»Ich schob an diesem Morgen mein Fahrrad aus der Scheune und machte mich auf den Weg in die Stadt. Da bin ich deinem Vater zum ersten Mal begegnet«, erzählt Anna. »Mit welcher Kraft die Morgensonne damals strahlte! Und wie jung ich war! Nie werde ich diesen Tag vergessen, an dem ich zum Markt geradelt bin, um drei Hühner zu verkaufen. Ich hatte mein bunt geblümtes Sommerkleid angezogen, das ich selbst genäht hatte. Sobald ich die Hühner verkauft hatte, sollte ich beim Juden Kautabak für den Vater und Stopfgarn für die Mutter besorgen.«
Mutter und Tochter sitzen auf der Kante des Betts. Anna fällt es schwer, sich mit ihrer Tochter über Liebe zu unterhalten und von ihrer Vergangenheit zu erzählen. Sie schließt die Augen, dann geht es einfacher: Sie fühlte den kühlen Sommermorgen auf ihrer Haut, als sie das Dorf verließ. Angestrengt trat sie in die Pedale und hatte Mühe, das Gleichgewicht zu halten, die toten Hühner baumelten Kopf unter an der Radstange herab. Am Elzbach, der sich von der Hohen Eifel aus östlich in Richtung Mosel schlängelt und anfangs ein schmales Rinnsal ist, lungerten wie immer junge Männer, Fahrende, herum, die am Rand des Dorfes sesshaft geworden waren.
»Niemand wollte mit denen etwas zu tun haben. Sie wurden ‚Kesselflicker‘ genannt, weil sie durch die Dörfer zogen, alte Kartoffelkessel und Töpfe reparierten und Weidenkörbe flechten konnten, die die Bauern bei der Kartoffel- oder der Apfelernte vor sich herschoben. Als sie mich sahen, pfiffen sie mir hinterher. Du glaubst nicht, wie schnell ich in die Pedale getreten habe.«
Anna erreichte schnaufend die Anhöhe, bog in den kleinen Waldweg ein, strampelte mit Karacho bergab in die Stadt. Der kühle Fahrtwind wehte ihr ins Gesicht. Was für ein Morgen! War es nicht egal, was in diesem Augenblick an der New Yorker Börse geschah? Die Luft duftete nach frischem Grün und gelbblühendem Ginster, den sie hier das »Eifelgold« nennen. Wie die Wiese, über die sie querfeldein radelte, war Annas Leben: Jung und verschwenderisch! Sie hoffte, dass es jemand pflücken würde wie die Blumen, die auf den feuchten Wiesen blühten und aussahen wie ein Märchenteppich aus Tausendundeinernacht. In der Stadt angekommen, überquerte sie den Marktplatz, der sich langsam füllte: Dorfbauern zerrten mit hochrotem Kopf Ochsen herbei, Hirten trieben ihre widerspenstigen Schweine vor sich her, Frauen in dicken Röcken breiteten geräucherten Schinken, selbst gemachten Ziegenkäse, frische Eier und Gemüse an ihren Ständen vor sich aus, in ihren Käfigen gackerten Huhn und Gans. Ein Hund hetzte ein paar Tauben über den Platz und stieß die Milchkanne einer Marktfrau um, die ihn wild gestikulierend davonjagte, die Milch schwappte über ihre frisch gestärkte Schürze und floss in Rinnsalen über das Pflaster: Hier war er, der betäubende Geruch des Marktes, der keinen Unterschied machte zwischen Stadt und Land.
Johann hatte wie immer lange geschlafen, seine Morgentoilette beendet, ausgiebig gefrühstückt, dann die Katzen gefüttert, sich angezogen und die Haare gekämmt: Der Scheitel saß wie eine Eins. Ein letztes Mal betrachtete er sich im Spiegel. Er rückte den Hemdkragen zurecht, zog die Haustür hinter sich zu, schlenderte die schattige Seite der Straße entlang zum Marktplatz hinunter, erhobenen Hauptes an den Bauern vorbei, die er nicht leiden mochte. Im Vorbeigehen stibitzte er ein paar rot leuchtende Kirschen und flegelte sich sodann breitbeinig mitten auf dem Platz auf die abgewetzten Basaltstufen des Marktbrunnens. Von da sah er dem Treiben zu und grinste ab und zu spöttisch. Wie sie feilschten und dabei ihre Hände an die Brust schlugen, mit Worten um sich warfen, lachten, schimpften, sich entrüsteten, die Stände verließen und wiederkamen, die schlauen Händler, die Besitzer, die vielen Käufer: zufrieden alle, Hauptsache die Geschäfte liefen, egal ob gut oder schlecht. Johann griff in die Hosentasche, zog seine Mundharmonika hervor und begann zu spielen. Er hatte die Musik im Blut. Unfähig zwar, Noten zu lesen, konnte er jedoch jede Melodie nachspielen, wenn sie sich einmal in seinem Kopf festgesetzt hatte, und darauf war er stolz.
Die Töne hüpften wie spielende Kinder über den Platz.
Was für ein Julitag!
Nicht weit von Johann entfernt breitete Anna eine karierte Tischdecke aus und drapierte die geschlachteten Hühner akkurat auf dem Stoff. Es dauerte nicht lange, da trat Sarah, die junge Frau des hoch geachteten Amtsarztes, zu ihr an den Stand und erzählte, dass sie am Abend in ihrem Haus eine Gesellschaft gebe. Sarah handelte nicht lange, drückte nicht den Preis, den Anna von ihr verlangte, sie kaufte alle drei Hühner auf einen Streich. Anna faltete zufrieden ihre Decke wieder zusammen. Dann lief sie rasch zu Jakobs Laden hinüber. Sie musste noch Besorgungen machen. Draußen am Fenster stand ein feiner Schriftzug:
JAKOB ROSENWASSER
Kurzwaren.
Anna öffnete die Tür: Dingididong. Sie zuckte leicht und trat ein. Schüchtern schritt sie durch das kleine Geschäft, vollgestopft mit allem möglichen Krimskrams. Vor den Halsketten, die an der Brust einer kopflosen Modepuppe baumelten, blieb sie stehen. Nein, keinen Klunker, sagte sie sich. Die Frauen im Dorf trugen keinen Schmuck, nur einen Goldring, wenn sie heirateten, das war alles. Sie waren nicht behängt wie die Christbäume, gerade das unterschied sie von den Weibern in der Stadt.
»So ein Quatsch«, kommentiert Margarete. Sie lacht. »Unsinn! Das hast du wirklich gedacht?«
»Ja, das schoss mir durch den Kopf. Und es stimmt ja auch. Heute noch mehr als damals. Oder kannst du mir eine Frau im Dorf nennen, die herumläuft wie ein geschmückter Weihnachtsbaum?«
Margarete schweigt. Sie will das nicht kommentieren.
Anna erzählt weiter: Auf der Theke stapelten sich Stoffe, Dosen mit Knöpfen in allen Größen, Farben und Formen, Garn und Zwirn, Socken und Strumpfbänder. Annas Blick fiel auf einen Hut.
So einen hatte sie noch nie gesehen. Sie trat näher und fuhr mit ihren rauen Fingerkuppen darüber. Weich war er wie das Fell eines kleinen Kätzchens. Ein Hut, dachte sie, aus dunkelrotem Haarstoff. So einen Hut hatte im Dorf keine. Und wie gut er sich anfühlte! Aber die Frauen im Dorf banden sich Kopftücher um. Ihre Mutter hätte es niemals erlaubt, dass sie sich mit einem Hut auf der Straße zeigte. Und nur um die Kühe und die Hühner im Stall damit zu beeindrucken, dafür war er viel zu teuer. Anna war eine Bäuerin, die trugen keine Hüte. Schuster bleib bei deinen Leisten, fuhr es durch ihren Kopf.
Hinter einem Kleiderständer lugte auf einmal das verschmitzte Gesicht des Juden hervor. Seine Haut glänzte. Er hatte ein einnehmendes Lächeln.
»Der Jud‘ konnte einen glauben machen, dass alles, was er feilbot, wertvoll sei. Selbst ein billiger Hosenknopf. Sein Mund war sehr schmeichlerisch«, erzählt Anna.
»Das junge Fräulein mal wieder in der Stadt«, fragte er.
»Heut war ja Markt«, sagte Anna. »Ich muss mich beeilen, damit ich im Hellen zurück bin.«
»Sucht das junge Fräulein was Bestimmtes?«, erkundigte sich Jakob, »vielleicht einen neuen Hut?«
»Er nannte dich Fräulein?«, fragt Margarete.
»Ja, er sagte Fräulein zu mir. Dieser Jud‘ musste mich beobachtet haben.«
»Ich soll Priem für den Vater mitbringen«, sagte ich.
»Sofort.«
Er kramte eine Blechdose aus dem Regal hinter sich hervor. Er reihte die Kautabakrollen auf die gläserne Theke.
»Pflaume ist jetzt ganz groß in Mode bei den Herren der Gesellschaft. Pflaume kann ich wärmstens empfehlen.«
»Nein, bloß nicht! Lakritze muss es sein.«
»Natürlich, Lakritze, mein Fräulein! Hier die Lakritze für den Vater. Darf es sonst noch etwas sein für das junge Fräulein?«
»Ach, ja, und graues Stopfgarn«, erinnerte sich Anna.
Das hätte sie beinahe vergessen. Er zog eine weitere Dose hervor und öffnete sie wie einen kostbaren Schatz.
»Warum probiert das junge Fräulein den Hut nicht mal an?«, fragte er, sprang hinter der Theke hervor, nahm den Hut von der Puppe und hielt ihn Anna direkt vor die Nase.
»Gefällt er dem jungen Fräulein etwa nicht? Ein schöner Stoff ist das. Aus kostbarem Biberhaar gefertigt.«
Er griff nach Annas Hand, führte sie sanft über die Hutoberfläche.
»Das Fräulein kann ihn ruhig einmal anprobieren. Probieren kostet nichts.«
»Ja ... aber ... ich«, stammelte Anna.
Jakob drückte ihr den Hut an die Brust und verschwand wieder hinter der Theke, die verunsicherte Kundin aus der Entfernung betrachtend.
»Setzen Sie ihn auf, ich drehe mich um und zähle bis drei. Eins … zwei …«
Ungelenk stülpte sich Anna den Hut über den Kopf.
»… und drei!« Jakob drehte sich blitzschnell um seine Achse. »Voilà! Wunderwunderwunderschön!«
Mit einem Spiegel in der Hand kam er wieder hinter der Theke hervor.
»Erlauben Sie?«
Er schob den Hut etwas in ihr kleines, rundes Gesicht.
»Steht er mir?«
Anna spürte, dass sie errötete.
»Das fragt das Fräulein noch? Sehen’s nur! Spiegel lügen nicht!«
»Weiß nicht«, murmelte Anna verlegen.
Sie betrachtete sich eine Weile, drehte sich nach links, nach rechts. Noch nie hatte sie sich mit Hut gesehen. Er veränderte ihr Gesicht! Ob der Jude den Hut wohl gegen ein Suppenhuhn eintauschen würde? Ein Huhn weniger auf der Wiese würde sicher keinem auffallen.
»Im Dorf tragen die Frauen aber keine Hüte«, sagte Anna.
Sie nahm den Hut vom Kopf und drückte ihn Jakob in die Hand.
»Ich lege ihn bis zum nächsten Markttag zurück. So ein Hutkauf will überlegt sein. Ein Hut ist schließlich was fürs Leben. Wie ein Ehemann. Schlafen Sie ruhig noch einmal drüber.«
Das leuchtete Anna sofort ein. Sie nickte zögernd, fast kaum sichtbar, mit dem Kopf.
»Einverstanden! Legen Sie ihn bitte zurück!«
Sie reichte ihm die Geldscheine über die Theke, fünfzigtausend, vielleicht hundertfünfzigtausend schwindelige Reichsmark. Die Inflation galoppierte schneller als ein junges Rennpferd. Sie verzeichnete täglich einen neuen Rekord. Und täglich wurden die Menschen ärmer.
Sie huschte aus dem Laden. Der Jude drückte sein Gesicht gegen die Türscheibe, sah ihr nach, wie sie zurück zu den Marktständen floh. Über seinem Kopf prangte in Sütterlinschrift der Name: Jakob Rosenwasser.
Das Marktspektakel war zu Ende, ein Mann kehrte mit einem Besen aus Weidenzweigen den Unrat beiseite, nur Johann saß noch am Brunnen und spielte auf seiner Mundharmonika.
Anna wollte über den Marktplatz eilen, blieb aber stehen und lauschte der Melodie. Die Töne der Mundharmonika tanzten federleicht um den Brunnen, verfingen sich in ihrem Haar. Ihre Augen trafen die des Mundharmonikaspielers. Die abendliche Julisonne wärmte den Basalt und fiel weich auf sein Gesicht. Er lächelte sie an, und Anna trat, wie von einem Magneten angezogen, ein paar Schritte näher heran, näher auf den Mann zu, in den sie sich in diesem Augenblick unsterblich verliebte.
»Ich komme immer hierher, wenn Markt ist«, rief er ihr nach. Sie drehte sich mit rotheißen Wangen noch einmal um, bevor sie schleunigst das Weite suchte.
Die beiden hatten sich schon bald wiedergesehen. Anna war eine Woche drauf wiedergekommen. Die Wochen darauf hatte sie ebenfalls einen Vorwand gesucht, um in die Stadt zu radeln. Und dann wieder und wieder. Eines Tages hatte sie ihn mitgenommen aufs Dorf: wie einen ihrer Einkäufe aus Jakob Rosenwassers Kurzwarenladen. Was für ein Fehler! Was für ein fataler Irrtum!
Anna öffnet ihre Augen. Wie flugs ist die Zeit seitdem vergangen! Es kommt ihr vor, als sei es gestern gewesen. Bald darauf hatte es Namen wie Rosenwasser in der Stadt nicht mehr gegeben, auch Jakob hatte diese Stadt, hatte Deutschland verlassen müssen. Nicht etwa, weil er sich aus freien Stücken dazu entschlossen hatte. Nicht etwa, weil er es satthatte, in dieser kleinen Stadt hinter der Ladentheke zu stehen und Kurzwaren zu verkaufen. Den Grund seiner Abreise lieferte ein junger Mann namens Herschel Grynszpan. Am Morgen des 7. November 1938 war der Jude in der deutschen Botschaft in Paris erschienen, er hatte sich beim Amtsgehilfen gemeldet und einen der Legationssekretäre sprechen wollen. Man führte ihn zum Gesandten vom Rath, und der Eindringling hatte sofort, nachdem er in das Zimmer eingetreten war, zwei Schüsse auf den deutschen Gesandten abgefeuert, ohne dass sie vorher ein Wort miteinander gewechselt hatten. Sogleich hatte Herschel versucht, aus dem Gebäude zu flüchten, aber der Amtsgehilfe verständigte umgehend den französischen Polizeibeamten, der vor dem Botschaftsgebäude Wache schob. Der Attentäter wurde verhaftet, später ohne Prozess hingerichtet. Und der hinkende Doktor Goebbels hatte gleich mit der ersten Meldung über das Pariser Attentat am Tag darauf im »Völkischen Beobachter« gesagt, was die Juden jetzt zu erwarten hätten: Es sei klar, dass das deutsche Volk aus dieser Tat seine Folgerungen ziehen werde. Es sei ein unmöglicher Zustand, dass in unseren Grenzen Hunderttausende von Juden noch ganze Ladenstraßen beherrschten, Vergnügungsstätten bevölkerten und als »ausländische« Hausbesitzer das Geld deutscher Mieter einsteckten, während ihre Schmarotzer draußen zum Krieg gegen Deutschland aufforderten und deutsche Beamte niederschössen.
Zwei Tage später waren sie gekommen und hatten auch Jakobs Kurzwarenladen kurz und klein geschlagen, ihn getreten, angespuckt und gerufen: »Verschwinde Jude!« Anna hatte den Biber-Hut niemals getragen. Er war in jener Nacht vom 9. zum 10. November 1938 in Jakobs Laden verbrannt.
»Und was ist mit diesem Jakob passiert?«, will Margarete wissen.
»Wir haben im Dorf erst Tage später erfahren, was geschehen war. Da hatte Jakob Rosenwasser die Stadt schon lange Hals über Kopf verlassen. Es hieß, er sei mit nichts mehr als seinem nackten Leben auf dem Weg nach Amerika. Mathilde hat erzählt, dass er seine Haut gerade noch rechtzeitig hatte retten können. In New York habe er einen neuen Krämerladen aufgemacht.«
Margarete nimmt die Mutter zärtlich in die Arme.
»So war das damals«, sagt Anna verlegen. »So war das, mein Kind. Es war nicht alles schlecht. Ich war glücklich damals. Es ist ja noch gar nicht so lange her.«
Anna steht auf. Sie schaut nachdenklich aus dem Fenster.
»Wie es Micha wohl geht«, fragt sie. Sie schaut sich um und verlässt das Zimmer.
Margarete geht dieser Eifeljude Jakob tagelang nicht mehr aus dem Sinn. Ob er es wirklich bis nach Amerika geschafft hat? Bis nach New York? Da werden sich die jungen Frauen wohl nicht so zieren wie hier! In New York wird es sicher viele Fräuleins geben, die Hüte tragen, aus Samt und Seide oder gar aus feinem Biberhaar. So einen Hut möchte ich auch einmal tragen, denkt Margarete.
Ob sie es jemals bis nach New York schaffen wird?