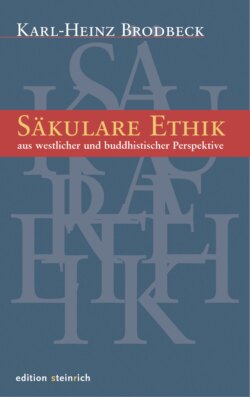Читать книгу Säkulare Ethik - Karl-Heinz Brodbeck - Страница 10
2.3 THEOLOGISCHE MORALBEGRÜNDUNGEN
ОглавлениеDie wichtigste Quelle moralischer Werte sind zweifellos die Religionen. Man kann alle Religionen in zwei große Gruppen einteilen: theistische und nichttheistische Religionen. Die theistischen Religionen gehen bei allen Unterschieden davon aus, dass alles, was existiert, von einem allmächtigen Schöpfergott (»Creator«) hervorgebracht worden ist. Die nicht theistischen Religionen verwenden dieses Konzept eines Schöpfergottes nicht – ohne es aber ausdrücklich zu bekämpfen, wie der Atheismus (frei übersetzt: »die Gottesgegnerschaft«). Der Atheismus stellt dem Begriff eines Schöpfergottes meist einen anderen obersten Begriff gegenüber: die Materie – so der kommunistische Atheismus – oder, wie der moderne Atheismus (z.B. Richard Dawkins), die Evolutionstheorie. Eine Sonderstellung nimmt der existentialistische Atheismus ein (vgl. Kapitel 2.6), der als obersten Begriff die menschliche Freiheit ansetzt.
Die nichttheistischen Religionen akzeptieren durchaus neben materiellen Gegebenheiten andere, geistige Formen. Sie berufen sich aber in ihrer Moralbegründung nicht auf eine göttliche Offenbarung (Rig-Veda, Thora, Bibel, Koran, Zend-Advesta usw.). Nichttheistisch sind Teile des Hinduismus, der Daoismus, Konfuzianismus, Shintoismus und natürlich der Buddhismus. Eine Moralbegründung nenne ich hier theologisch, wenn sie als Voraussetzung einen Schöpfergott verwendet, der zugleich Schöpfer jeder Moral ist und aus dieser Voraussetzung anhand von Offenbarungen moralische Regeln ableitet. Rationale Argumente (z.B. Gottesbeweise) stützten dann die »Wahrheiten« aus der Offenbarung. In der jüdischen, christlichen und islamischen Theologie werden beide Formen der Begründung verwendet. Man argumentiert unter Voraussetzung der Existenz eines Schöpfergottes mit philosophisch-logischen Argumenten, und man verbindet dies mit Aussagen aus »heiligen Texten«, die man entsprechend interpretiert oder unmittelbar daraus moralische Aussagen entnimmt.
In der Praxis gilt in theistischen Systemen meist eine schlicht normative Moral: Man kennt Gebote (Dekalog, Scharia) und wendet sie unmittelbar an. Logische Begründungen oder Rechtfertigungen für diese Moralregeln gibt es in den Offenbarungstexten so gut wie nie – jedenfalls nicht, wenn man diese Texte wörtlich auslegt. Eine metaphorische Auslegung findet sich allerdings häufig, bis hin zu den extremen Formen in der Kabbala, worin die Buchstaben der (hebräischen) Thora, die zugleich Zahlenwerte sind, als eine Art Modell des Kosmos interpretiert werden. Diese Art der metaphorischen Auslegung heiliger Texte wird aber auch immer wieder von anderen Religionsvertretern strikt abgelehnt: Man beharrt dann auf dem Wortlaut der Thora, der Bibel oder des Koran. Diese wörtliche Auslegung heißt »Fundamentalismus«. Luther lehnte z.B. die mittelalterliche Theologie ab, die versuchte, die Aussagen der Bibel in eine philosophische Sprache zu übersetzen (besonders Thomas von Aquin, aber auch Mystiker wie Meister Eckhart taten dies). Da sich eine wörtliche Interpretation eines »heiligen« Textes von je anderen, durchaus sehr verschiedenen Texten unterscheidet, gibt es zwischen Fundamentalisten differenter Religionen keine unmittelbare Verständigungsmöglichkeit. Dieser Fundamentalismus mündet deshalb bestenfalls in wechselseitiger Toleranz, häufig aber auch in direkten Kampf gegeneinander. Da der Sinn eines Textes dennoch immer einer Auslegung bedarf (»Hermeneutik«), geschieht es auch, dass sich fundamentalistische Gruppen, die sich auf denselben Text berufen, dennoch bekämpfen.
Wie lässt sich nun die innere Logik einer theistischen Moralbegründung beschreiben? Jede Begründung muss von Voraussetzungen ausgehen. Diese Voraussetzungen nennt man in der Neuzeit »Werte«. Da moralische Regeln keine Naturgesetze sind, die man empirisch auf ihre Geltung hin überprüfen kann, sind moralische Regeln prinzipiell aus einer anderen Quelle abzuleiten. Theistische Systeme sehen diese andere Quelle in Gott. »Gott« ist definiert als allmächtiger, allwissender Schöpfer aller Dinge. Aus welchem Grund Gott jeweils das, was ist, geschaffen hat, erschließt sich der menschlichen Vernunft nicht. Deshalb hat dieser Gott – ihm wird darin Milde und Barmherzigkeit attestiert – aus Liebe zu seinen Geschöpfen seine verborgenen Ratschlüsse in einem heiligen Text offenbart. Die Menschen stehen in der Skala der Kreaturen, die dieser Gott hervorgebracht hat, an oberster Stelle: als Krone der Schöpfung. Die Menschen bleiben dabei zwar weit unter Gott, sind ihm aber doch ähnlich. Worin besteht diese Ähnlichkeit? Menschen sind weder allwissend noch allmächtig, weder handeln sie aus reiner Liebe, noch erkennen sie alle Dinge. Aber sie besitzen Verstand (Intellekt). In ihrem Intellekt sind sie Gott ähnlich. Deshalb präsentiert Gott den Menschen nicht wie den Tieren nur die Resultate seiner Schöpfung (Nahrung und Lebensraum), sondern er spricht auch zu ihnen, teilt ihnen seine Absichten mit. Dieser Prozess heißt »Offenbarung«. Zwar sei in allen Kreaturen auch das Werk des Kreators, des Schöpfergottes, erkennbar; man nennt solch eine Erkenntnis natürliche Theologie. Doch reicht diese Erkenntnis nicht hin, vor allem nicht zur Erkenntnis der moralischen Regeln für das menschliche Handeln. Diese offenbart Gott unmittelbar, indem er moralische Gesetze aufstellt, die Menschen zu befolgen haben. Sie verstehen zwar den Wortlaut dieser Gesetze, nicht aber ihren wirklichen tiefen Sinn – der bleibt dem inneren Ratschluss Gottes vorbehalten.
Deshalb besteht der einzige Weg zur moralischen Erkenntnis im Glauben. Man muss einfach dem Wort Gottes Glauben schenken. Und man muss gehorsam sein – denn es ist ja der moralische Befehl des Allmächtigen. Gott schenkt den Menschen zwar prinzipiell die Freiheit. Das unterscheidet sie von den Tieren, die nur ihren Trieben folgen und nur auf Reize reagieren. Die Menschen wissen, was sie tun, und können folglich auch dem göttlichen Wort gehorchen. Aber sie sind dazu nicht durch eine Art Naturgesetz gezwungen. Das wäre sonst gar keine menschliche Freiheit. Weil sie also zu Gottes Befehl, zur göttlichen Moral auch Nein! sagen können, können sie sich gegen Gott stellen. Weil Gott – in diesem Argument unterscheiden sich Juden, Christen und Moslems in subtilen Details der Begründung – der allmächtige Schöpfer aller Dinge ist, deshalb gilt letztlich sein Wille auch immer (sonst wäre er gar nicht allmächtig). Deshalb kann Gott nicht zulassen, dass sich Menschen in ihrer Freiheit gegen seine moralischen Regeln stellen. Um seinen Willen wieder herzustellen, bestraft er ihre Handlungen und Gedanken, die sich gegen ihn stellen. Und da Gott unendlich in all seinen Attributen ist, bestraft er eine letzte Verweigerung seines Willens aus freier Entscheidung (»Todsünde«) auch unendlich. Eine unendliche Strafe ist die ewige Verdammnis.
Damit die göttliche Strafe gerecht ist, bleibt natürlich die Voraussetzung bestehen, dass man die Offenbarung auch tatsächlich gehört haben muss. Wer ohne Kenntnis der göttlichen Offenbarung Handlungen begeht, die für einen Gläubigen »unmoralisch« sind, der wird deshalb anders beurteilt. Auch hierin unterscheiden sich die theistischen Systeme, und ich will auf Unterschiede nur sehr skizzenhaft eingehen. Christentum und Islam leiten aus der Voraussetzung, dass alle Menschen die göttliche Offenbarung auch hören müssen, als erste Pflicht die Missionierung der Nichtgläubigen ab. »Und Wir bestrafen nicht, bevor wir einen Gesandten geschickt haben«, heißt es im Koran 17,15. Jeder soll eine Chance haben, sich aus Freiheit zu Gott zu bekennen oder aber – das wird meist zunächst nicht laut dazugesagt – sich auch gegen Gott zu entscheiden, was dann fürchterlich bestraft wird.
Das Bild des Menschen wird innerhalb der theistischen Systeme unterschiedlich entworfen. Einerseits betont die Theologie die menschliche Freiheit, den Intellekt als Ebenbildlichkeit zu Gott, andererseits wird gerade aus der Freiheit eine tiefe Neigung zur Sünde abgeleitet und insgesamt ein höchst negatives Bild von den menschlichen Möglichkeiten gezeichnet. Einigkeit herrscht nur, dass die Menschen ohne Bezug auf Gott verloren sind. Im Christentum wird die Chance, zu den Auserwählten, nicht zu den Verdammten zu gehören, ziemlich gering eingeschätzt: »Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt.« (Matth 22,14) Auch die Zahl derer, von denen im Mittelalter angenommen wurde, dass sie ins Himmelreich gelangen würden, ist eher gering. Das beruht auf der Lehre von der Erbsünde. Menschen sind ihrer moralischen Natur nach verdorben durch die ererbte Ursünde von Adam und Eva. Während im Katholizismus durch die Beichte immerhin ein gewisser Freiraum zur Korrektur durch moralisches Handeln eingeräumt wird, ist der Protestantismus hier weitaus radikaler. Nach Luther können Werke überhaupt nichts zum Heil beitragen. Es ist nur der Glaube, der selig macht. Extremer noch formuliert Calvin, der vom Menschen als einem völlig verdorbenen Wesen ausgeht. Der Mensch sei bestimmt durch eine natura corrupta. Nur unaufhörliche Selbstbezichtigung der eigenen Sünden und harte Arbeit als Buße, frei von Vergnügen, biete eine Chance, den angeborenen Defekt etwas zu mildern, auch wenn er durch moralisches Handeln nicht zu beseitigen sei. Das war für den Kapitalismus eine durchaus passende Ideologie: Harte Arbeit für die Vielen, während der Zinsertrag der Reichen als Ausfluss göttlicher Gnade schon hier im weltlichen Leben galt. Warum das so gelten soll, wird nicht begründet. Nur der Glaube macht selig.
Zwei weitere Haltungen in den theistischen Systemen sind noch mit Blick auf die Moralbegründung zu berücksichtigen: Der Gedanke der Missionierung steht neben einer Elitevorstellung, der Exklusivität der eigenen Religion. Das findet sich auch im Hinduismus (Brahmanismus), demzufolge nur Angehörige einer höheren Kaste überhaupt im vollen Wortsinn moralisch aus Erkenntnis handeln können. Im Judentum gibt es eine ähnliche Vorstellung. Auch das Judentum ist eine exklusive Religion. Jude ist, wer eine jüdische Mutter hat. Der Glaube wird also vererbt. Zwar wurden auch Menschen durch Glaubensübertritt jüdisch (z.B. die Chasaren in Osteuropa). Doch insgesamt durchzieht das Judentum die Vorstellung einer exklusiven Religion, erkennbar an der Formel vom »auserwählten Volk Gottes«. Es werden im Judentum zwar andere Religionen respektiert, allerdings in engen Grenzen: Nicht von Gott verdammt wird – z.B. nach der Lehre des Noahidismus –, wer den sieben Regeln des Noah gehorcht. Dabei sind verboten: Gotteslästerung (also eigentlich: Ablehnung des Glaubens an einen Schöpfergott), die Verwendung von Götterbildern, besondere sexuelle Praktiken und einige Nahrungsmittel. Diese Toleranz bleibt also auf den engeren Umkreis einer theistischen Moral bezogen. Katholiken oder Hindus, die Götter- oder Heiligenfiguren verwenden, wären demnach schon fast verdammt.
Die Begründung der Moral in theistischen Systemen gehorcht einer einfachen Logik: Weil Gott in seiner Offenbarung diese oder jene Regel als gültig verkündet hat, muss sie jeder Gläubige auch befolgen. Nichtbefolgung wird bestraft, wie ein Verstoß gegen eine Rechtsregel. Dies allerdings gewöhnlich noch nicht im Diesseits, in der Welt (»Mein Reich ist nicht von dieser Welt«), sondern im Leben danach, nach dem Tod, im Jenseits. Dort finden sich dann Lohn und Strafe für die Taten, gemessen an den offenbarten Moralregeln. Da Gott der Schöpfer aller Dinge ist, gibt es auch eine gottgemäße Gesellschaftsordnung. Die Regeln für das menschliche Zusammenleben sind letztlich aus den Offenbarungsschriften zu entnehmen. Hier unterscheiden sich allerdings die theistischen Systeme deutlich: Im Hinduismus wird die Kastenordnung (eine Klasseneinteilung der Gesellschaft) mit vielen Regeln recht genau vorgeschrieben. Der Buddha hat das, wie bereits gesagt, nachdrücklich kritisiert. Auch im Islam gibt es aus dem Koran oder der späteren Tradition genaue Vorschriften, wie die Gesellschaft zu gestalten ist (vgl. Scharia-Gerichtsbarkeit). Im Judentum und Christentum sind eher nur einzelne Regeln zu finden, die zudem einer Interpretation bedürfen. Beispiel »Zinsverbot«: In der Thora, im Alten Testament, ist nur das Zinsnehmen vom jüdischen Bruder verboten; von Nichtjuden darf Zins genommen werden. Dieses Gebot wurde im Christentum – mit erheblichem theologischen Interpretationsaufwand – verallgemeinert, was sich in den Wucher-Gesetzen auch rechtlich normiert niederschlug. Später hat man durch andere theologische Deutungen (Calvin im Protestantismus im 16. Jahrhundert, Oswald von Nell-Breuning für den Katholizismus im 20. Jahrhundert) dieses Verbot wieder »aufgehoben«. Da die Vorschriften im Koran eindeutiger sind, gilt das Zinsverbot im Prinzip im Islam immer noch (in der Praxis aber mit vielen Ausnahmen durch finanztechnische Tricks). Eine genau formulierte Sozialethik gibt es in allen Offenbarungsreligionen nur in Ansätzen, die jeweils einer Interpretation bedürfen.
Die meisten Moralregeln, die aus den »heiligen Schriften« entnommen werden, haben einen tugendethischen Charakter – im Sinn der griechischen Definition. Das heißt, sie zielen zuerst auf die je individuelle Vollkommenheit. Diese Vollkommenheit des Lebenswandels kann im Christentum eigentlich nur durch eine Trennung von der säkularen Welt endgültig erreicht werden – in Klöstern oder im Priesteramt. Dieser Gedanke ist durchaus der frühbuddhistischen Vorstellung verwandt, dass eine wirkliche Befreiung nur in der »Hauslosigkeit«, also der Trennung vom alltäglichen Leben der Menschen gefunden werden kann: in der »Waldeinsamkeit« (wie es in den Pali-Schriften heißt) oder im Kloster. Die Regeln für die Alltagswelt sind in diesem Verständnis immer nur vorläufig oder unvollkommen. Durchbrochen wird dieser Gedanke in dem Zugeständnis, dass auch gewöhnliche Menschen ohne Trennung vom weltlichen Leben den Stand der Heiligkeit erlangen können, wenn auch eher selten. Die Regeln für das menschliche Zusammenleben haben stets den Charakter des Vorläufigen, der nur der erste Schritt hin zur vollständigen Abkehr vom säkularen Leben ist. Dies ist ein ursprüngliches Dilemma aller religiösen Moralbegründungen. Der Islam macht hier eine gewisse Ausnahme. Er fordert in seiner fundamentalistischen Form keine Abkehr vom weltlichen, säkularen Leben, sondern dessen völlige Verwandlung gemäß der überlieferten religiösen Moral (Scharia). Es ist keine Moral für das säkulare Leben, sondern dessen völlige religiöse Überformung, weshalb Bewegungen wie der Wahabismus oder der Salafismus eine fast rein politische Form annehmen. Daneben dürfen im Islam die Ansätze zu einer säkularen Modernisierung gerade nicht übersehen werden.
Nun befindet sich eine theistische Moralbegründung allerdings noch in einem weiteren, sehr spezifischen Dilemma. Es gibt ja mehrere »Offenbarungen« Gottes. Teils beziehen sie sich aufeinander (wie Neues und Altes Testament), teils sind sie nur äußerlich beeinflusst (wie der Islam durch Judentum und Christentum), teils sind es ganz eigene Traditionen (Zoroastrismus, Brahmanismus). Trotz einiger wichtiger Übereinstimmungen in moralischen Fragen gibt es hierbei auch große Unterschiede, die durchaus praktische Konsequenzen haben. Einige Traditionen fordern, Ehebrecher zu steinigen – wie die Thora bzw. die Bibel (Lev 20,10; Dtn 22,22), auch der Steinigungsvers im Hadith, der vermutlich ursprünglich zum Koran gehörte (Sure 33). Dies widerspricht durchaus diametral der Botschaft von Liebe und Mitgefühl im Neuen Testament (Joh 8,1-8,11). Und das ist nur ein Beispiel. Hier unterscheiden sich die theistischen Systeme teils gravierend. Nicht nur hat der jeweilige Schöpfergott einen anderen Namen (Isvara, Jehova, Vater, Allah), er äußert sich auch in seiner Offenbarung sehr unterschiedlich. Der Begriff »Schöpfergott« bringt nur den gemeinsamen Gedanken zum Ausdruck, dass die Welt die Tat eines von ihr getrennten personalen Wesens ist, das von der Welt auch getrennt bleibt. Setzt man »Gott« und »Schöpfung« gleich (wie Baruch Spinoza), so wird dies als Pantheismus von den traditionell-theistischen Systemen allgemein abgelehnt.
Welcher Offenbarung soll man also folgen? Solange Völker völlig isoliert lebten, war dies eine Scheinfrage: Es gab in einer Region eben nur eine Offenbarung. Doch gerade das säkulare Leben, besonders der Fernhandel, brachte die Menschen bereits früh in Kontakt zueinander und führte damit für die Moralbegründung zu einer zentralen Frage: Welcher Offenbarung soll man vertrauen? Da die Religionen den Anhängern einer je anderen teilweise die ewige Verdammnis oder Mord und Totschlag androhen, wird die Wahl der Religion zum Glückspiel. Die Gläubigen einer anderen Religion sind für die Anhänger der eigenen eben Ungläubige; deshalb drohen sich diese Religionen wechselseitig auch offene Gewalt dafür an, dass andere an eine andere Offenbarung glauben.{37}
Das ist für eine säkulare Ethik ein fundamentales Hindernis, wenn man auf die Toleranz der religiösen Systeme setzt. Da mit den göttlichen Strafen zugleich die abstoßendsten Vorstellungen verbunden sind, liegt hier das Haupthemmnis für eine interreligiöse Verständigung. Es gibt hier – neben unschönen aktuellen Beispielen aus vielen Ländern – eine durchaus vielfältige unheilvolle Tradition. Das christliche Abendland hat keinen Grund, mit dem Finger auf andere Religionen zu zeigen, auch nicht das reformierte Christentum des Protestantismus: Bekannt sind Luthers Drohungen gegen die Juden und seine Forderung nach einem »Kriege wider die Türken« (d.h. den Islam). Es lassen sich viele Stellen der katholischen und protestantischen Theologie anführen, die sogar das Mitgefühl der Erlösten mit den Verdammten ausdrücklich verbieten.{38} Auch wenn viele kritische Theologen aus allen religiösen Systemen ihre Tradition nicht mehr in diesem Geist auslegen, so liegt hier doch ein prinzipielles Hemmnis für eine säkulare Moralbegründung vor: Wenn die Moral nur aus einer Offenbarung abgeleitet wird, wenn ferner die Entscheidung, welcher Offenbarung man vertraut, nicht seinerseits begründet wird, dann befindet sich eine Moralbegründung aus dem Glauben in einer säkularen Welt in der Sackgasse: Es gibt da innerhalb der theistischen Systeme keinen Ausweg.
Eine auf den ersten Blick raffinierte Begründung, weshalb man dennoch der Offenbarung vertrauen soll, hat Blaise Pascal entwickelt. Als Philosoph und Mathematiker war er mit dem Glücksspiel vertraut. So versuchte er, die Entscheidung für den Glauben an die Offenbarung durch ein Glückskalkül, die berühmte Pascal’sche Wette, zu begründen. Der Gedanke ist einfach zu skizzieren: Pascal betrachtet die Entscheidung, zu glauben oder nicht zu glauben, als eine Entscheidung unter Unsicherheit. Sich für oder gegen den Glauben zu entscheiden ist aber kein Abwägen von gleichartigen Gütern, meint er.{39} Die Kosten, der Aufwand, den die Moral von uns verlangt, sind relativ niedrig. Aber der zu erwartende Lohn, die ewige Seligkeit, ist ein unendlicher Gewinn. Wenn es nun auch nur – das wird auch ein Skeptiker zugeben – eine winzige Chance gibt, dass die Offenbarung wahr ist, dass die versprochene Seligkeit als Lohn für moralisches Handeln unendlich ist, dann ist der erwartete Gewinn immer noch unendlich. Denn: Eine noch so kleine Wahrscheinlichkeit mit einer unendlichen Größe multipliziert, ergibt immer noch eine unendliche Größe. Die Waagschale schlägt also eindeutig zugunsten des Glaubens aus. Selbst wenn man nicht überzeugt ist – Pascal vertritt eine Morallehre, die nur auf das faktische Handeln, nicht die innere Überzeugung blickt –, so ist der Lohn überragend. Ist das Gegenteil der Fall, trifft also das offenbarte Versprechen der ewigen Seligkeit nicht zu, so hat man kaum etwas verloren. Im Gegenteil. In diesem Argument liegt Pascals säkular-ethische Konsequenz aus seiner Wette. Er sagt zu einem Gesprächspartner, dem er seine Wette schmackhaft machen will: Falls Sie die Wette verlieren (es gibt keine ewige Seligkeit), dann besteht immer noch ein positiver Nutzen.
»Sie werden treu, ehrbar, demütig, dankbar, wohltätig, ein aufrichtiger und wahrhafter Freund sein. In Wahrheit: Sie werden sich nicht mehr in verpesteten Vergnügungen aufhalten, in der Ruhmsucht, in den Genüssen (…). Ich sage Ihnen, Sie werden in diesem Leben dabei gewinnen; und Sie werden bei jedem Schritt, den Sie auf diesem Wege tun, Ihren Gewinn so sicher und Ihr Wagnis so nichtig sehen, bis Sie schließlich erkennen: Sie haben um etwas Sicheres, Unendliches gewettet, für das Sie ein Nichtiges hingaben.«{40}
Pascal nimmt hier eine utilitaristische Argumentation vorweg (vgl. Kapitel 2.5). Seine Wette hat somit eine doppelte Bedeutung: Einmal soll sie durch Nützlichkeitsabwägungen zum Glauben, wenigstens zur Glaubenspraxis auch ohne innere Überzeugung überreden. Hier schlägt die Waage durch das Wahrscheinlichkeitsargument scheinbar eindeutig dafür aus, den Glauben einfach anzunehmen, ohne weiter nachzufragen. Zum anderen aber sagt Pascal, dass jemand, der die christliche Moral annimmt, dadurch selbst einen Vorteil hat – und damit auch die ganze Gesellschaft: Man wird treu, ehrbar, demütig, dankbar und wohltätig. Auch hier argumentiert Pascal rein funktional: Es ist unwichtig, ob man den Sinn dieser Handlungsweise einsieht. Man entdeckt bei sich selbst einen Vorteil, einen höheren Nutzen darin, moralisch zu handeln. Damit wird aber vorausgesetzt: Wer moralisch handelt, der erfährt in seinem Leben ein höheres Glück, einen größeren Nutzen.
Nun möchte ich Letzteres keineswegs bestreiten, im Gegenteil. Doch von Pascal wird die Moral für etwas anderes funktionalisiert. Moralische Werte sind aus Vernunftgründen nicht direkt erkennbar. Sie erhalten ihren Sinn, ihren Wert durch die Funktion, die sie erfüllen. Hier verfällt Pascals Argument jener Kritik, die ich in Kapitel 2.5 noch genauer darstellen werde. Pascals Grundgedanke lautet also: Wer auf Gott wettet, der kann nur gewinnen. Aus dieser Überzeugung auch moralisch zu handeln ist nur ein Teil der Wette und darin nur ein Nebenprodukt. Moral hat hier keinen Eigenwert.
Doch Pascals Argument leidet an einem fundamentalen Denkfehler: Er setzt voraus, dass es nur eine Offenbarung Gottes gibt. Wenn man sich für den Islam entscheidet und Christen als Ungläubige bekämpft, vielleicht sogar (wie zitiert) tötet, dann wird man ewig verdammt, falls der christliche der wahre Glaube ist. Ist der Islam dagegen die wahre Offenbarung, dann gewährt der andere Gott (Allah) einem ewige Freuden im Paradies. Der Wahrscheinlichkeit einer unendlichen Seligkeit aus einem Glauben stehen also als »Kosten« nicht nur gegenüber, sich moralisch verhalten zu müssen. Es besteht prinzipiell die durchaus nicht kleine Wahrscheinlichkeit, dass man den falschen Glauben gewählt hat und dafür eine unendliche Strafe erleidet. Es stehen sich also zwei unendliche Größen zur Abwägung gegenüber. Eine rationale Entscheidung für einen Glauben kann nicht mehr getroffen werden.
Pascals Wette ist eine Illusion. Mehr noch: Gott sieht nach dem Zeugnis vieler religiöser Texte gar nicht die äußere Handlung als moralisch relevant an, sondern ausschließlich die Motivation des Handelns – man vergleiche das berühmte »Scherflein der Witwe« (Markus 12,41-44). Wer dann aus reinem Wettkalkül Nutzen und Kosten abwägt und nur den äußeren Anschein eines moralischen Handelns praktiziert, der kann sich in dieser Perspektive gerade umso mehr versündigen: Er hat dann aus einer berechnenden Haltung äußerlich moralisch gehandelt, während seine Motivation reine Gier nach Seligkeit war. Aus Pascals Wette ist deshalb nur ein Gedanke mitzunehmen: Durch eine berechnende Haltung kann man weder »die richtige Offenbarung« auswählen noch kann man sicher sein, dadurch spirituell überhaupt etwas zu erreichen.
Implizit formuliert Pascal eine funktionale Moral die man so beschreiben kann: Wenn man den bloßen Anschein der Moral seinem Handeln zugrunde legt, so wird man die natürliche Disposition zum Moralischen in sich aufwecken, darin geläutert und das Glück in der Moral selbst finden. Voraussetzung für dieses Argument ist aber eine Annahme, die so lautet: ›Menschen wollen glücklich sein; wahres Glück findet man aber nur im moralischen Handeln.‹ Wenn man diese Regeln zunächst gleichsam nur experimentell übernimmt, so wird sich dennoch früher oder später die Erfahrung des darin liegenden Glücks einstellen. Man kann diese These auch bezüglich des sozialen Aspekts der Ethik so formulieren: Auch wenn jemand ohne innere Überzeugung moralisch handelt, so erfüllt sein Handeln sozial, für die Gesellschaft eine nützliche Funktion. Solch ein Handeln ist dann zwar nicht tugendethisch motiviert, aber durch seine äußere Wirkung dennoch objektiv moralisch. Die Kant’sche Pflichtethik kann man in diesem Sinne interpretieren. Auch Kant meinte, dass man auch gegen eigene Leidenschaften und Empfindungen moralische Regeln einfach aus Vernunftgründen als eine Pflicht betrachtet. Hier zeigt sich, dass der Versuch, durch ein rationales Kalkül einen Gottesglauben begründen zu wollen, zwar gründlich schiefgeht, die Begründungsweise gleichwohl Fragestellungen offenbart, die sich auch für die Diskussion einer säkularen Ethik als hilfreich erweisen. Die Pascal’sche Wette kann aber das entscheidende Dilemma nicht auflösen: Welche Offenbarung soll ich wählen? Soll ich überhaupt an eine Offenbarung glauben?
Nun haben Theologen oder Philosophen auch abseits von Pascals Kalkül mit der ewigen Seligkeit versucht, dennoch einen Ausweg aus diesem Dilemma zu finden. Dieser Ausweg besteht immer darin, dass man über der Offenbarung eine allen Menschen gemeinsame Vernunft akzeptiert, dass man also die Philosophie als Vernunftwissenschaft vor jedem religiösen Bekenntnis anerkennt. Averroes, einer der wichtigsten Philosophen im Islam, argumentierte durchaus auf diese Weise: Er sagt sinngemäß, dass die religiösen Aussagen alle durch die Philosophie begründet werden könnten; der Koran mit seinen Bildern und Geschichten sei für »die breite Masse«, die keinen Zugang zur Philosophie habe.{41} Die christlichen Philosophen gingen nicht so weit – und falls doch, wurden sie oft als Ketzer verdammt. Sie anerkannten aber dennoch durchaus die Autorität der Philosophie, seit dem 13. Jahrhundert vor allem die des Aristoteles. Damit fanden in theistischen Systemen für die Moralbegründung philosophische Argumente der griechischen Tradition Eingang und eröffneten so auf längere Sicht doch eine Verständigungsmöglichkeit. Ramon Lull hat um die Wende vom 13. zum 14. Jahrhundert sogar ein logisches System entwickelt, das alle religiösen Aussagen der theistischen Systeme beinhalten sollte, und sie so in ein Gespräch miteinander gebracht.{42} Nikolaus von Kues knüpfte daran an und versuchte sich gleichfalls an einem interreligiösen Diskurs auf philosophischer Grundlage.{43} Die Mystiker – jüdische, christliche und islamische – gingen noch einen anderen Weg. Sie bauten zwar auf der je eigenen Religion auf, vertraten aber die Auffassung, dass man durch mystische Praktiken auch direkten Zugang zu Gott, zu einer Gotteserfahrung gewinnen und aus solch einer Erfahrung selbst erkennen könne, was moralisch richtig oder falsch sei.
Ein Anknüpfungspunkt, der weit über die theistischen Systeme hinausreicht, ist die Intellekttheorie, die – ausgehend von Aristoteles – von Avicenna, Averroes, Thomas von Aquin, Dietrich von Freiberg, Meister Eckhart und anderen übernommen und ausgebaut worden ist. Diese Theorie besagt, dass jeder Mensch neben seinem gewöhnlichen Denken über einen allgemeinen, also nicht individuierten reinen Intellekt verfügt. Diesen reinen Intellekt schrittweise zu erkennen ermögliche, an die Quelle des Schöpferischen selbst zu gelangen. Diese Lehre bietet exzellente Anknüpfungspunkte für die buddhistische Tradition, in der dieser allgemeine Intellekt als Grundlage aller geistigen Prozesse wahlweise reines Bewusstsein, Achtsamkeit, Buddhanatur, ālaya (Sanskrit) oder rigpa (Tibetisch) genannt wird. Hier ergibt sich eine unmittelbare Diskussionsgrundlage zwischen West und Ost. Und vom reinen Intellekt führt dann ein direkter Weg zu den Ideen der Aufklärung, die diesen Begriff mit »Vernunft« übersetzt haben.