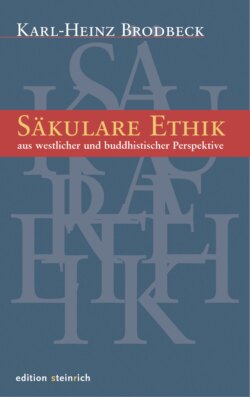Читать книгу Säkulare Ethik - Karl-Heinz Brodbeck - Страница 6
EINLEITUNG
ОглавлениеSeine Heiligkeit der Dalai Lama hat mehrfach eine säkulare Ethik angeregt.{1} Nun gibt es im Abendland neben einer spezifisch religiösen Moral durchaus zahlreiche Ethikentwürfe, die sich an der Philosophie und nicht unmittelbar am Christentum orientieren. Im Buddhismus andererseits findet sich neben spirituellen Aussagen ein breiter Gedankenstrom, der rationale Argumente ins Zentrum rückt. Die rein ethischen Aussagen allerdings bleiben fast immer mit einer spezifisch religiösen Bedeutung verbunden – etwa in der Lehre von Karma, Wiedergeburt und Erleuchtung. Hier zeigen sich große Differenzen zur abendländischen Moralphilosophie einerseits, zum Christentum andererseits. Man kann aber – diese Überzeugung liegt dem nachfolgenden Text zugrunde – religiöse, philosophische und wissenschaftliche Perspektiven dennoch miteinander in ein Gespräch bringen. Das gelingt, falls man sich vor allem auf die vorgebrachten Argumente konzentriert, also darauf, wie jeweils moralische Aussagen begründet werden. Ich stimme Damien Keown zu, der den wohl bislang einflussreichsten westlichen Versuch einer buddhistischen Ethik vorgelegt hat, wenn er sagt:
»Ich glaube nicht, dass die Prinzipien der buddhistischen Ethik absolut einzigartig sind oder sui generis, noch akzeptiere ich, dass sie exklusiv in ihrer eigenen Terminologie verstanden werden können.«{2}
Die Idee einer säkularen Ethik, wie sie der Dalai Lama versteht, fordert auch eine Begründung, die sich nicht von religiösen Fundamenten abhängig macht. Er formuliert Vorschläge zur Entwicklung eines »neuen Ethiksystems«, das von der gemeinsamen Voraussetzung ausgeht, die das menschliche Leben überhaupt kennzeichnet. In diesem Horizont, so der Dalai Lama, gilt es, »eine Basis für unsere inneren Werte zu schaffen, die keiner Religion widerspricht, aber auch, und das ist von entscheidender Bedeutung, von keiner Religion abhängig ist.«{3} Für die westliche Tradition bestand die Schwierigkeit in der Moralphilosophie in jüngerer Zeit stets darin, nicht in eines der Extreme zu verfallen, die in der Moderne nahe liegen. Die Kritik der christlichen oder anderer theistischer Traditionen hat mit Friedrich Nietzsche schließlich jegliche Moral als Illusion und Projektion eher niederer Triebe zu entlarven versucht. Die theistischen Traditionen (Brahmanismus, Judentum, Christentum, Islam) sind durch das Festhalten ihrer jeweiligen Offenbarung charakterisiert. Sie reduzieren die Moral auf religiöse Gebote, die jeweils ihrer heiligen Schrift (Veda, Thora, Bibel, Koran) absolute Geltung zusprechen. Dieser Fundamentalismus findet sich in allen Traditionen, und er hat auch säkulare Nachfolger gefunden – z.B. im Historischen Materialismus oder in der neuen atheistischen Bewegung.
Es gibt aber in allen Morallehren neben direkten Vorschriften für das Handeln (= normative Ethik) auch Versuche, die jeweiligen Aussagen zu begründen. Diese Versuche bleiben oft rudimentär. Eine systematische Moralbegründung hat sich nur im säkularen Raum entwickelt, in der Philosophie Griechenlands, später in der Aufklärung, die sich von der religiösen Überlieferung emanzipierte. Als Motto für eine säkulare Ethik und ihre Begründung kann der Satz des Aristoteles aus seiner Nikomachischen Ethik gelten:
»Sittliche Einsicht hat der, welcher die Fähigkeit zu richtiger Überlegung besitzt.«{4}
Man kann mit etwas Wohlwollen auch in den theistischen Traditionen, wenn auch eher selten, die Aufforderung zur kritischen Prüfung der Glaubenswahrheiten finden. Avicenna übersetzt den letzten Satz von Sure 59.2 des Koran in diesem Sinn:
»Überlegt, o ihr, die ihr Einsicht habt.«{5}
Und Paulus sagt im Thessalonicherbrief, 5,21:
»Prüfet aber alles, und das Gute behaltet.«
Beide Aussagen lassen sich als Aufforderung zur rationalen Grundlegung der Ethik interpretieren. Eindeutig äußert sich hier der Buddha in seiner Rede an die Kālāmer, die ich im dritten Teil noch genauer darstellen werde – hier sei nur der letzte Satz zitiert:
»Wenn ihr aber, Kālāmer, selber erkennt: ›Diese Dinge sind unheilsam, sind verwerflich, werden von Verständigen getadelt, und, wenn ausgeführt und unternommen, führen sie zu Unheil und Leiden‹, dann o Kālāmer, möget ihr sie aufgeben.« (AN 3.66){6}
In der Kālāmer-Rede kann man nicht nur für den Buddhismus, sondern auch im allgemein philosophischen Kontext das Muster für eine rationale Moralbegründung erkennen, deren eindeutige Fragestellung erst im 18. Jahrhundert in der Aufklärungsphilosophie wieder erreicht wurde. Diese Rede des Buddha liefert mir auch die Hintergrundfolie der nachfolgenden Argumentation für eine säkulare Ethik. Sie belegt, dass es tatsächlich die buddhistische Tradition ist, die das große Potenzial zu solch einer Ethik bietet und damit ein Gesprächsangebot an andere religiöse Systeme darstellt, die der Vernunft eine zentrale Rolle einräumen. Die beiden kleinen Hinweise aus dem Koran und dem Thessalonicherbrief können hier als Zeichen für eine interreligiöse Verständigung in der Sprache der Philosophie dienen.
Vom Altertum bis in die Gegenwart haben europäische Philosophen (von Diogenes Laertius bis Martin Heidegger) immer wieder behauptet, dass es nur so etwas wie eine europäische Philosophie gebe. Definiert man »Philosophie« – damit auch die Moralphilosophie – als in Griechenland begründetes Denksystem, dann ist diese Aussage trivial »wahr«. Meint man damit aber, dass das Nachdenken über Formen der Moralbegründung außerhalb Europas nicht stattgefunden habe, dann ist man einfach unwissend. Es gibt hier nicht nur viele Berührungspunkte, sondern auch viele Gemeinsamkeiten. Diese Tatsache ist mehrfach dargestellt worden.{7} Dennoch verbleiben auch charakteristische Unterschiede gerade zur buddhistischen Philosophie – Unterschiede, die besonders für die Begründung einer säkularen Ethik bedeutsam werden. Darin liegt der besondere Beitrag einer aus dem Geist der buddhistischen Philosophie formulierten Ethik.
Ich möchte nachfolgend (ausführlich im dritten Teil) zum Vergleich an die buddhistische Philosophie und hier besonders an die Schule des Mādhyamaka (Nāgārjuna und seine Nachfolger) anknüpfen. Mit dem Begriff »buddhistische Philosophie« fasst man im Allgemeinen zahlreiche, teilweise höchst unterschiedliche Systeme zusammen.{8} Aus einer westlichen Perspektive finden sich in verschiedenen buddhistischen Traditionen: Materialismus, Idealismus, metaphysischer Pluralismus sowie ein strikter Determinismus neben der Lehre vom reinen Illusionscharakter alles Wirklichen. Bezüglich der normativen Ethik, d.h. der Regeln, die zur Erlangung des spirituellen Heilsziels (nirvāna) führen, herrscht vielfach Einigkeit. Doch man betrachtet auch dies unterschiedlich: Während im frühen Buddhismus ein völlig asketischer, von der Welt getrennter Lebenswandel (als Nonne und Mönch im Kloster oder in der »Waldeinsamkeit«, in der »Hauslosigkeit«) als oberstes Ideal und als Voraussetzung für die Erleuchtung gilt, erweitert man in späteren Systemen die Möglichkeiten einer spirituellen Praxis auch auf den Bereich außerhalb der Klöster. Im Tantrismus werden die verschiedensten menschlichen Leidenschaften als »geschickte Mittel« zum Erlangen der Erkenntnis verwendet. Tibet, China und Japan kennen jeweils in ihren Traditionen die Figur des »heiligen Narren«, der sich an keine Moralregel hält und dadurch gerade seine Schüler aus ihren körperlichen und geistigen Gewohnheiten aufzuwecken versucht. Im nun immerhin schon etwa seit einem Jahrhundert sich ausbreitenden westlichen Buddhismus ist das Ideal eines mönchischen Lebens weitgehend in den Hintergrund gerückt. Buddhistische Praktizierende führen gewöhnlich ein »normales« Alltagsleben, mitten unter allen anderen Menschen.
Auf diese Aspekte der praktischen Ethik gehe ich nachfolgend nicht näher ein, sondern bleibe bei den Prinzipien zur Begründung moralischer Aussagen. Allerdings, das werde ich im letzten Abschnitt zeigen, weist auch eine säkular orientierte Ethik schließlich über sich hinaus und bietet Anknüpfungspunkte an die Spiritualität. Die buddhistische Lehre (Sanskrit Dharma; Pali Dhamma) stellt hier eine eigenständige Grundlage bereit, die als einzigartig gelten kann – besonders die Lehre vom Bewusstsein. Ich werde hierbei auch das kritische Gespräch mit den Neurowissenschaften und den Naturwissenschaften suchen.
Es sei noch ergänzt, dass im nachfolgenden Text das Augenmerk auf die Begründung von moralischen Urteilen, also eine allgemeine, säkulare Ethik gerichtet ist. Verschiedene Fragen der Ethik für jeweils besondere Handlungsformen (Bereichsethiken) werde ich nur als Beispiele anführen. Sie gehören zur angewandten Ethik. Gerade hier gibt es auch im Buddhismus bereits zahlreiche Darstellungen.{9} Sie firmieren in jüngerer Zeit meist unter dem Stichwort »sozial engagierter Buddhismus«. Ich habe dazu ebenfalls Beiträge geschrieben und den Versuch einer buddhistischen Wirtschaftsethik vorgelegt. Die dort schon behandelten Fragen greife ich deshalb hier nicht mehr auf.{10} Das Thema dieses Buches ist die Begründung einer säkularen Ethik. Dies erfolgt im Vergleich der buddhistischen Ethik mit wichtigen, im Westen entwickelten Argumenten.
Hierzu werde ich zunächst – nach einigen einleitenden Begriffsbestimmungen – verschiedene Erklärungsansätze aus der abendländischen Tradition diskutieren. Dass die hier getroffene Auswahl nicht vollständig sein kann, versteht sich von selbst.{11} Im dritten Teil versuche ich dann, aus der buddhistischen Philosophie eine säkulare Ethik zu gewinnen, in der zunächst alle weiter tragenden, also spirituellen Vorstellungen ausgeklammert werden. Die buddhistische Ethik an einen Diskurs mit den westlichen philosophischen und wissenschaftlichen Traditionen heranzuführen, gelingt nicht ohne Klärung wichtiger Aussagen im Buddhismus selbst. Vor allem die Karmalehre bedarf nach meiner Auffassung einer gründlichen Reform, will man auf den darin liegenden, durchaus für eine säkulare Ethik zu destillierenden Gehalt nicht völlig verzichten. Auch bin ich der Auffassung, dass die im Buddhismus gebräuchliche Trennung von »absoluter und relativer Wahrheit« selbst wiederum relativ, nicht absolut ist. Das will besagen: Auch die Lehren aus der »dritten Drehung des Rades« im Buddhismus (die Lehre von der Buddhanatur = tathāgatagarbha), gewöhnlich in einer Argumentation um alltäglich-moralische Fragen ausgeklammert, scheinen mir für eine säkulare Ethik aus dem buddhistischen Geist durchaus relevant. Man beschneidet die buddhistische Lehre, wenn man z.B. Aussagen über die Leerheit nur als eine innerbuddhistische Frage behandelt, die in einem säkularen Diskurs keine Rolle spielen darf.{12} Ich habe gerade in der Geldtheorie zu zeigen versucht, wie wichtig auch für rein wissenschaftliche Fragestellungen die Erkenntnisse sind, die Nāgārjuna gewonnen hat. Die Erfahrung der Leerheit und Scheinhaftigkeit aller Phänomene, besonders der Ich-Illusion, scheint mir für die Formulierung einer diskursfähigen Ethik unerlässlich. Die Kritik der »Ich-Illusion« im Buddhismus (An-Ātman) ist inzwischen keine rein buddhistische Überzeugung mehr, wie der gleichnamige Buchtitel des bekannten Hirnforschers Michael Gazzaniga belegt.{13} Ethik ist eigentlich – aus dem Geist der buddhistischen Philosophie, aber auch im Horizont vieler abendländischer Morallehren – Kritik des Egos. Erst auf dieser Grundlage können sich Fragen des Gemeinwohls, der Ökologie, aber auch einer Wirtschaft jenseits von Geldgier und Konkurrenzneid fundiert beantworten lassen.
Gerade als Kritik der Ich-Illusion eröffnet sich – das werde ich im Schlusskapitel zu zeigen versuchen – eine Gesprächsmöglichkeit auch über die Themen, die in der buddhistischen Tradition zu den »Unsagbarkeiten« zählen und bei deren Erwähnung westliche Wissenschaftler bislang schon von vorneherein kopfschüttelnd den Diskurs abbrechen. Hier kann gerade im Gegenzug durch einen Blick auf die blinden Flecken in den Natur- und Neurowissenschaften eine neue Gesprächsbasis eröffnet werden, die schließlich über ethische Fragen hinausweist in das ureigene Terrain aller spirituellen Traditionen: der Frage nach dem Sinn von Geburt und Tod und der Natur des Bewusstseins. Ich hoffe, hierzu einige neue Perspektiven gerade in einem sehr genauen Blick auf das zu gewinnen, was im wissenschaftlichen Weltbild übersehen wird. Es gibt durchaus so etwas wie Tatsachen des Bewusstseins, auch als Grundlage jeder Moral. Nur findet man sie nicht mit weißem Kittel in einem Labor beim Blick auf diverse Messgeräte. Warum das so ist, auch diese Frage wird zu klären sein – sowohl aus einer westlichen (vgl. Kapitel 2.7) als auch aus der buddhistischen Perspektive (vgl. den dritten Teil).
Es ist wichtig, noch zu ergänzen, dass der durchaus kritische Geist, der im Buddhismus zuhause ist und von Nāgārjuna sehr subtil kultiviert wurde, immer nur auf Denkformen abzielt, nie auf Personen, die solchen Denkformen anhängen. Das gilt natürlich auch und besonders für meine Kritik der tradierten Karmalehre (vgl. Abschnitt 3.3.4), die einige lieb gewonnene, leider allzu einfache Vorstellungen als unhaltbar erweisen wird. Ich schlage generell vor, das Karma zunächst als Argument in der moralischen Beurteilung von Handlungen, sozialen Institutionen oder Ereignissen einfach zu streichen. In moralischen Urteilen funktioniert der Begriff »Karma« entweder als Ausrede oder als Drohung – beides ist unter einer ethischen, keineswegs nur säkular-ethischen Perspektive unhaltbar. Im Gegensatz zu moralischen Urteilen, die an ein – im Zweifel dann doch unerkennbares – Karmagesetz anknüpfen, lässt sich das Mitgefühl aus der gegenseitigen Abhängigkeit aller Phänomene in der Begründung einer säkularen Ethik durchaus rational rekonstruieren. Meine Kritik am Karmabegriff möchte nur unsinnige, daran geknüpfte Vorstellungen beseitigen, gleichwohl aber auch einen durchaus vernünftig einsehbaren und wichtigen Kern herausarbeiten (vgl. Abschnitte 3.3.5 und 3.4.3). Man kann aus dem ursprünglichen Sinn von Karma als »Handlung«, in Verbindung mit dem Gedanken an Handlungsgewohnheiten (samskāra), durchaus an die Ethik im aristotelischen Sinn anknüpfen, denn »Ethik« bedeutet nach Aristoteles ursprünglich Gewohnheit. Insofern lässt sich für die säkulare Ethik der Karmabegriff so rekonstruieren, dass er für einen Diskurs mit abendländischen Traditionen anschlussfähig wird. Das gilt auch für die im Buddhismus eher unklare Stellung des Begriffs der »Freiheit«, der andererseits doch jeder Vorstellung von Befreiung zugrunde liegt. Auch hier kann durch eine Klärung, um nicht zu sagen: Reinigung, der überlieferten buddhistischen Vorstellungen eine Position gewonnen werden, die sich problemlos an die europäische Tradition anschließt.
All dies möchte ich in einem kritischen Diskurs mit der westlichen Wissenschaftstradition darstellen. Das methodische Grundprinzip der abendländischen Wissenschaften unterstellt, dass ihre Erkenntnisse moralfrei sind. Das wird sich als Illusion erweisen: Wissenschaft ist eine Form des menschlichen Bewusstseins. Die Wissenschaft vom Bewusstsein geht also jeder anderen Wissenschaft voraus. Und es ist gerade eine Eigenart des Buddhismus in all seinen Schulen, eine Wissenschaft des Bewusstseins zusammen mit der Ethik (śīla) zu kultivieren. Dies gilt ebenso für eine theoretische Wissenschaft in der buddhistischen Philosophie des Mittleren Weges (Mādhyamaka) wie in vielfältigen Meditationssystemen als praktische Philosophie. Von hier aus ist dann, das versuche ich im letzten Kapitel, 3.4, zu zeigen, auch eine Perspektive über eine säkulare Ethik hinaus möglich. Sie greift Themen auf, die hinter dem blinden Fleck der modernen Wissenschaft unsichtbar bleiben, darin zugleich aber eine Gesprächsgrundlage für andere spirituelle Systeme bieten können. Hier gewinnt eine säkulare Ethik den Sinn, auch eine interreligiöse Basis zu bieten.
Was ich im nachfolgenden Text versuche, ist vielleicht nicht nur für mich, sondern auch für die Leserinnen und Leser ein kleines Abenteuer des Denkens. Dies stets nach dem Motto, das der Buddha und knapp zweieinhalb Jahrtausende später Kant so formuliert haben: »Sapere aude! Ihr müsst selber erkennen.« Vielleicht kann so auch ein wenig vom Glück der philosophischen Erkenntnis durchscheinen, das Aristoteles in den Morgenstunden der abendländischen Philosophie folgendermaßen formuliert hat:
»Denn selbst wenn jemand alles besäße, aber in der denkenden Seele hoffnungslos krank wäre, so wäre ihm das Leben nichts Wählenswertes, weil auch seine sonstigen Vorzüge keinen Nutzen brächten. Darum meinen alle Menschen, soweit sie mit der Philosophie in Berührung kommen und von ihr zu kosten vermögen, dass die übrigen Dinge nichts wert seien; aus diesem Grund würde es keiner von uns aushalten, bis zum Ende des Lebens im Zustand der Trunkenheit oder ein Kind zu sein.«{14}
Die Ethik kann aus dieser Trunkenheit, die im Buddhismus Verblendung heißt, aufwecken, durch ein richtiges Tun, vor allem aber durch richtiges Erkennen. Denn moralisch zu handeln ist gut. Die Gründe für moralisches Handeln zu kennen ist aber besser. Denn es offenbart dem Verständigen auch die Schönheit und das Glück eines mitfühlenden Lebens. Ethik weist immer über die eigenen Ich-Schranken hinaus. Sie ist deshalb auch ein bleibender Stachel, eine Welt mit weniger Leiden zu verwirklichen – eine Welt, die trunken ist und, durch Gier und Aggression getrieben, heillos dahintreibt. Wenn sich aus der Ethik dann noch Perspektiven über das Handeln in der Welt hinaus eröffnen, dann erfüllt sich der Sinn eines gelingenden Lebens.