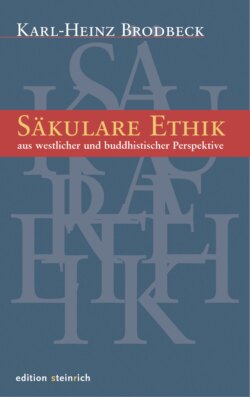Читать книгу Säkulare Ethik - Karl-Heinz Brodbeck - Страница 11
2.4 KANT’SCHE ETHIK
ОглавлениеImmanuel Kant hat die Tugendlehre der griechischen und mittelalterlichen Philosophie abgelehnt. Die aristotelische Forderung, die rechte Mitte zu halten, betrachtet Kant als Tautologie.{44} Er betont dagegen die Pflicht als Ziel und Maß des Handelns (deontologische Ethik). Eine Tugend hängt immer ab von dem Ziel, dem sie dient. So begreift er die vier Kardinaltugenden Weisheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Mäßigung nur als Eigenschaften von Handlungen, nicht als deren Ziel: Die Tapferkeit z.B. kann die Tugend eines Verbrechers wie die eines Arztes in Krisengebieten sein. Kant setzt der Tugend die Pflicht entgegen, wobei die Pflichten vernünftig begründbar sein müssen. Sein kategorischer Imperativ als Norm der Moral nimmt dabei gelegentlich fundamentalistische Züge an. Deshalb lehnt er den aristotelischen Gedanken ab, das Handeln sei eine Mitte zwischen Extremen. So sagt er, dass es zwischen Wahrheit und Lüge keine Mitte gebe. Wenn es die Tugend sei, einer Pflicht zu folgen, so kenne dies kein Maß des Zuviel oder Zuwenig.
»Denn gar zu tugendhaft, d.i. seiner Pflicht gar zu anhänglich, zu sein, würde ungefähr so viel sagen als: einen Circel gar zu rund, oder eine gerade Linie gar zu gerade machen.«{45}
Doch Handlungen sind keine Objekte wie mathematische Gegenstände. Der Begriff »Mitte« hat in der Moral nur die Bedeutung, Extreme beim Handeln zu vermeiden. Kants Kritik an Aristoteles ist hier ein Kategorienfehler: Aussagen über Handlungen haben immer einen situativen, d.h. einer Auslegung bedürftigen Charakter. In der Geometrie ist das anders: Ein Kreis befindet sich nicht in einer Situation. Es gibt hier kein Maß wie »zu rund«, auch wenn es beim Zeichnen als Handlung durchaus solch ein Maß an Genauigkeit gibt. Beim Handeln gibt es also immer ein Maß, z.B. ein Übermaß an Mut, das in Leichtsinn umschlägt. Wo genau der Übergang liegt, das zu erkennen bedarf einer Handlungsklugheit, die kein mathematischer Verstand ist. Es ist also nicht sinnlos, wie Kant meint, beim Handeln eine Mitte einzuhalten, einem mittleren Weg zu folgen. Es ist sogar unerlässlich. Aristoteles und der Buddha sagen hier genau dasselbe.
Doch Kant hat nicht immer zur Ableitung seiner Ethik einen Rigorismus der Pflichterfüllung vertreten. Er teilt durchaus die Auffassung des Aristoteles, dass die moralische Formung (Begrenzung) irrationaler Leidenschaften letztlich durch die Vernunft bestimmt wird. Und es ist dieser Gedanke, der die Kant’sche Ethik für jede Diskussion über moralische Fragen unverzichtbar macht. Die These, dass moralische Regeln vernünftig eingesehen werden können, dass sie aber nur aus Freiheit angenommen und eingehalten werden, wurde von Kant in mehreren Anläufen seines Systems ausführlich diskutiert. Kant betrachtet den Menschen als ein Doppelwesen. Er steht hier in der Tradition von René Descartes. Descartes hat postuliert, dass die Welt gleichsam aus zwei völlig unterschiedlichen Formen oder Seinsweisen besteht: Eine Welt der äußeren Körper (res extensa) und eine Welt der Subjektivität, des Geistes, deren Haupteigenschaft ihre Erkenntnisfähigkeit ist (res cogitans). Die Welt der Körper ist völlig kausal determiniert. Die Welt des Geistes wird durch vernünftige Erkenntnis bestimmt. Kant sagt nun in dieser Tradition, dass der Mensch als Körper den Gesetzen der Mechanik, der Kausalität unterworfen ist. Hier erscheinen menschliche Handlungen durch Naturgesetze bestimmt. Doch von innen erscheint dies dem Bewusstsein völlig anders, nämlich als Freiheit im Handeln. Körper und Geist stehen zueinander aber nicht in einer kausalen Beziehung; die Kausalität gilt nur für die Welt der Körper.{46} Wenn wir vom Menschen, von der Moral sprechen, können wir uns nur auf die Vernunft und die Freiheit beziehen. Niemand kann die Bedeutung einer Entscheidung, z.B. die, Nein! zu sagen oder eine völlig neue Idee zu besitzen, kausal aus der körperlichen Verfassung eines Menschen äußerlich ableiten. Wir können also nicht Handlungen mechanisch erklären. Das ist übrigens eine Einsicht, die in den modernen Neurowissenschaften wieder verloren gegangen ist.
Wie kommen wir nun rein aus dem Geist der Freiheit zu einer vernünftigen Erkenntnis von Moralregeln und ihrer Geltung? Kant hat darauf in verschiedenen Lebensphasen verschiedene, teils leicht differierende Antworten gegeben, auf die ich hier nicht näher eingehen kann. Ich greife für das Verständnis eine frühe Form seiner Moralphilosophie auf, die noch nicht durch den Rigorismus seiner späteren Schriften gekennzeichnet ist – die frühe »Vorlesung über Ethik«{47}. Zunächst stellt Kant hier die einfache Regel auf:
Man muss »den Menschen kennen, ob er auch das tun kann, was man von ihm fordert.« (S. 12)
Moral kann also nur verlangen, was ein Mensch auch tatsächlich kann. Freilich ergibt sich bereits hier eine Schwierigkeit: Denn gerade Ökonomen neigen dazu zu sagen, dass der Mensch in seinem Wesen eben egoistisch geformt sei, weshalb es unsinnig sei, von ihm ein weiter gehendes moralisches, soziales oder ökologisches Verhalten zu fordern. Man müsse den Menschen deshalb von außen – wie ein Versuchstier – durch »Anreize« steuern. Wenn man diese sehr weit verbreitete Vorstellung hegt, so ist für eine wirkliche Ethik der Wirtschaft kein Platz. Da jede Moral auf einer letztlich in der menschlichen Freiheit gründenden Entscheidung beruht, kann man jemand, der solche – in meinen Augen inhumane – Überzeugungen hegt, nicht einfach eines Besseren belehren. Letztlich erweist sich aber der Gedanke, dass Menschen einer moralischen Erziehung nicht zugänglich seien, auch nur als eine andere moralische Überzeugung. Die Versuche, auf dieser Grundlage tatsächliches Handeln der Menschen zu erklären und zu prognostizieren, haben sich schlicht als Irrtum erwiesen.
Wo liegt hier der Fehler? Der Versuch, das Handeln der Menschen durch kausale Faktoren (wie Gehirn, Genom, Umweltreize usw.) zu erklären, verkennt die von Kant gewonnene Einsicht, dass es zwischen der Kausalität des Körpers – die es zweifellos gibt – und der moralischen Begründung eben keine kausale Beziehung geben kann. Die Freiheit der Entscheidung ist auf keine erfahrbare Weise determiniert – sonst wäre es ja gar keine Freiheit; wie immer man dies in einer reinen Außenperspektive auch deuten mag. Aber diese Freiheit der Vernunft kann durch Argumente selbst dazu gelangen, moralischen Regeln zuzustimmen. Hier kommt Kants Ethik ins Spiel. In der ihm eigentümlichen Sprache betont er die Unauflösbarkeit der menschlichen Freiheit:
»Die menschliche Willkür ist ein arbitrium liberum, indem sie nicht per Stimulus necessitiert wird.« (S. 38)
Das heißt, freie Entscheidungen sind ebenfrei, nicht durch »äußeren Stimulus« gesteuert. Der Mensch ist kein homo oeconomicus, kein bloßes Versuchstier, sondern vernünftigen Argumenten zugänglich – das ist der zentrale Gedanke Kants (wie schon 2400 Jahre zuvor der Gedanke der Kālāmer-Rede).
Welches ist nun das zentrale Argument, das Menschen zur Annahme moralischer Regeln bewegt und davon überzeugt? Hier werden die Antworten von Kant vielgestaltig; in der zitierten frühen Vorlesung aber sind sie sehr transparent, weshalb ich darauf zurückgreife. Kant sagt etwa Folgendes: Die Moral »zwingt« einen Menschen nicht äußerlich, nicht – wie er sagt – »pathologisch«, sondern durch innere Motive.
»Moralisch zwinge ich einen durch motiva objektive moventia, durch Beweggründe der Vernunft mit seiner größten Freiheit ohne allen Antrieb.« (S. 40)
Die Ethik formuliert Regeln, die Gehorsam verlangen und insofern als »Befehle« wirken. Doch zu jedem Befehl kann man Nein! sagen; es gibt keinen »pathologischen Zwang«, ihm zu folgen. Gewiss, ein Moralverstoß mag negative Konsequenzen in einem bestimmten sozialen Umfeld haben. Das Prinzip aller Moral beruht aber auf der Zustimmung des Individuums aus vernünftigen Gründen:
»Das oberste Principium aller moralischen Beurteilung liegt im Verstande, und das oberste Principium des moralischen Antriebes, diese Handlung zu tun, liegt im Herzen« (S. 46).
Doch welches Argument bietet man dem Verstand hier an? Kant kehrt das Argument um und fragt: Was ist eine unmoralische Handlung? Und hier antwortet er:
»Das ist also eine unmoralische Handlung, deren Intention sich selbst aufhebt und zerstört, wenn sie zur allgemeinen Regel gemacht wird. Moralisch ist sie aber, wenn die Intention der Handlung mit sich selbst übereinstimmt, wenn sie zur allgemeinen Regel gemacht wird.« (S. 53)
Das ist der Kern dessen, was Kant später in seinen moralphilosophischen Schriften kategorischen Imperativ nennt. Welche Handlungen heben sich auf, wenn sie »zur allgemeinen Regel gemacht werden«, wenn sie also von (fast) allen Menschen befolgt werden? Es sind dies Handlungen, die die menschliche Gesellschaft insgesamt zerstören. Würden alle der Regel »Du sollst töten!« folgen, so wäre die menschliche Gesellschaft rasch verschwunden und hätte sich selbst umgebracht. Dass sie das übrigens im Angesicht von weltweiten Bürgerkriegen und der unvermindert drohenden atomaren Gefahr dennoch tun kann, dass die Menschheit insgesamt sich durchaus auch selber zerstören kann, das ist damit als Möglichkeit nicht ausgeschlossen. Nur moralische Regeln, die also der Erhaltung, der langfristigen Reproduktion der ganzen Menschheit dienen, sind in diesem Sinne vernünftig. Denn unvernünftig ist jede Handlung oder jeder hinführende Gedanke, der letztlich auch die Vernunft selbst (also die Menschen) aufhebt.
Nun werden nur wenige Menschen diesen Gedanken von Kant unmittelbar nachvollziehen. Der kategorische Imperativ ist zwar von Kant durchaus praktisch gemeint, nicht nur als bloße Theorie der Moral:
»Der wirkliche Wert des Kant’schen Prinzips der Universalität ist praktisch, nicht theoretisch; es ist ein Trick, wie wenn man einem ärgerlichen Kind sagt, es soll in den Spiegel blicken.«{48}
Aber das Handeln der Menschen ist vielfach durch Gewohnheiten bestimmt, der Vor- oder Frühform dessen, was in seiner griechischen Herkunft »Ethos« heißt. Das sieht natürlich auch Kant. Es gibt, sagt er, noch so etwas wie »das moralische Gefühl« (S. 54). Menschen haben, durch ihre Kindheit, die Schule, durch ihre Charakterbildung also, d.h. durch die Ausbildung von sozialen Gewohnheiten, auch so etwas wie ein Gefühl für das moralisch Richtige entwickelt. Die Moral steckt in der gesellschaftlichen Tradition. Man folgt ihr einfach, auch wenn man den Sinn bestimmter Regeln nicht durchschaut. Hier sieht Kant durchaus die positive Rolle religiöser Traditionen. Wenn Menschen einer Religion folgen und dadurch moralische Regeln übernehmen, beruht die Begründung für diese Regeln nur auf einem Glauben. Doch damit erfüllen die Religionen zugleich eine durchaus hilfreiche Rolle, indem sie das verwirklichen, was die Kraft der Vernunft nicht in jedem Menschen zu wecken vermag. Kant drückt diesen Gedanken so aus:
»Der Mensch hat nicht solche feine Organisation, durch objektive Gründe bewogen zu werden, es ist keine Feder von Natur, die da könnte aufgezogen werden, solches hervorzubringen. Allein wir können doch einen habitum hervorbringen, der nicht natürlich ist, aber doch die Natur vertritt, der durch die Nachahmung und öftere Ausübung zum habitu wird.« (S. 55)
In eine modernere Sprache übersetzt: Die meisten Menschen lassen sich in ihrem Handeln nicht durch vernünftige Gründe, sondern durch Gewohnheiten (habitum) leiten. Gewohnheiten sind keine natürlichen Ursachen (z.B. bedingt durch die Gehirnstruktur oder das menschliche Genom), keine – wie Kant sagt – »Feder von Natur«. Sie werden durch die Erfahrung ausgebildet und können insofern gesteuert oder verändert werden. Darin liegt die Möglichkeit einer moralischen Erziehung.
Menschen stehen in der Moderne viele Informationen zur Verfügung. Auch wenn die Religionen weiterhin wichtig bleiben, spielen sie in der Ausbildung von kulturellen Gewohnheiten keine zentrale Rolle mehr – wenigstens in Europa. Die moralische Erziehung übernehmen vielfach Medien, die Vorbilder erzeugen und Gewohnheiten durch Moden, durch Nachahmung ausbilden. Dennoch – die bessere Schulbildung der Menschen in der Neuzeit ist dafür prinzipiell ein Garant – bleiben auch die Vielen, die »breite Masse« der Menschen, Argumenten zugänglich. Man muss ihnen diese Argumente allerdings auch anbieten. Argumente setzen Informationen voraus, auch Kenntnisse und Erfahrungen. In einer Gesellschaft, die sich damit schmückt, eine »offene Gesellschaft« zu sein, ist wenigstens prinzipiell der Gedanke verwirklicht, dass Argumente Priorität vor allen Anreizsystemen haben.
Allerdings ist hier kritisch anzumerken, dass dieses Ideal nicht nur weltweit nicht realisiert ist, sondern auch in Demokratien immer mehr unterminiert wird – durch Lobbyismus, politische PR, die an Propaganda erinnert, durch allmächtige Geheimdienste und eine Fülle medialer Lügen. Wer darauf abzielt, die argumentative Ebene bewusst zu umgehen, wer von vorneherein Menschen nur als Anreizobjekte betrachtet, ihnen faktisch also durch sein Handeln Vernunft abspricht, der ignoriert das, was Menschen zu Menschen macht. Was ist der – sehr große – Unterschied zwischen moralischer Erziehung und PR oder Propaganda? Eben das wenigstens prinzipielle Vertrauen auf die Vernünftigkeit aller Menschen. In der moralischen Erziehung werden auch schrittweise Gewohnheiten erzeugt, die zu unbewussten Handlungen führen – man denkt nicht mehr über die Begründung nach, wenn man Menschen hilft, gerecht zu sein usw. Doch diese unbewusst gewordenen moralischen Verhaltensweisen sind jederzeit begründbar und sollten in einer ethischen Schulerziehung auch für jedermann begründet werden. Die PR erzeugt durch die Verknüpfung von Gefühlen und Bildern unbewusste Reaktionsweisen. Die Werbung nutzt diese bedingten Reflexe systematisch aus, neuerdings durch die Hilfe des Neuromarketings. Doch hier werden Verhaltensweisen implementiert, die einem bestimmten privaten Ziel dienen (meist der Gewinnmaximierung). In der Politik dienen PR-Techniken oft gleichfalls den Interessen einer regierenden Elite, in der Gegenwart vielfach der Finanzelite.
Nicht dass im Sinn von Kant moralisches Handeln auch als unbewusst wirkende Gewohnheit anerzogen wird, ist also zu kritisieren. Vielmehr, dass die Methode zur Erzeugung von Gewohnheitsmustern für fremde, nicht moralische Zwecke verwendet wird, ist das Unmoralische daran. Das Kriterium bleibt, dass eine Regel wirklich universalisierbar, also vernünftig zu begründen ist. Das, was durch PR die unbewussten Handlungen formt, ist nur dann »moralisch« zu nennen, wenn die entsprechenden Handlungsweisen langfristig, auf die ganze Menschheit und die umgebende Natur bezogen, nachhaltig umsetzbar sind. Fördert man die Gier der Anleger, die blinde Gehorsamsbereitschaft von Soldaten, ein unkritisches, für soziale und ökologische Nebenwirkungen blindes Konsumstreben durch Kaufanreize – dann sind diese Verhaltensweisen gerade nicht universalisierbar, sind also im strikten Sinn unmoralisch. Sie tragen wenigstens langfristig zur Störung oder gar zur Zerstörung der menschlichen Gesellschaft und der Ökosysteme bei. Kants kategorischer Imperativ ist insofern auch als moralische Übersetzung des Begriffs »Nachhaltigkeit« zu interpretieren.
Fasst man Kants Gedankengang zusammen, so ist zu sagen: Die Moral lässt sich nicht durch natürliche Ursachen begründen, damit naturwissenschaftlich auch nicht kritisieren oder widerlegen. Moral beruht letztlich auf freien Entscheidungen, auf der vernünftigen Einsicht. Wenigstens dies, dass man zu moralischen Regeln immer Nein! sagen kann, ist ein unmittelbarer Beleg für diese Tatsache. Gleichwohl ist es unvermeidlich, dass als richtig erkannte moralische Vorschriften auch als Gewohnheiten in der Erziehung verankert werden. Die Vernunft besitzt nicht immer, unter allen Umständen und für alle Menschen eine lenkende Kraft. Prinzipiell ist aber nach Kant davon auszugehen, dass alle Menschen in einer offenen Gesellschaft vernünftigen Argumenten zugänglich sind. Und in ethischen Streitfragen kann ohnehin nur das bessere Argument siegen. Inhaltlich kann man mit Kant fordern, dass eine Regel dann moralisch ist, wenn ihre allgemeine Befolgung das Leben aller Menschen – und, wie ich hinzufügen möchte, auch anderer Lebewesen auf unserem Planeten in einer intakten Umwelt – erhält oder fördert. Jede Regel, die dagegen das langfristige Zusammenleben stört oder zerstört, ist als unmoralisch abzulehnen.