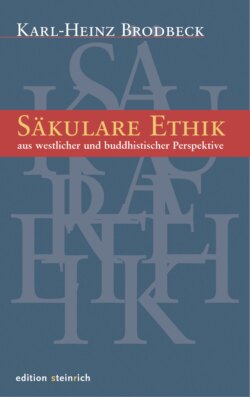Читать книгу Säkulare Ethik - Karl-Heinz Brodbeck - Страница 9
2.2 ARISTOTELISCHE TUGENDETHIK
ОглавлениеDie Philosophie Griechenlands, später adaptiert durch die römische Akademie und die Stoa, hat unterschiedliche Moralsysteme hervorgebracht. In der vorsokratischen Philosophie wurden menschliche Handlungen in diversen Gottheiten idealisiert. Dennoch haben Philosophen den Götterglauben nicht nur verteidigt, sondern durchaus auch kritisiert. So hat Xenophanes die griechischen Götter, wie sie bei Homer geschildert werden, als menschliche Projektionen bezeichnet. Auch Demokrit meinte, dass der Götterglaube nur aus Furcht vor Himmelserscheinungen entstanden sei. Heraklit betonte – wie bereits zitiert –, dass die Menschen im Logos (im gemeinsamen Sprechen) miteinander verbunden sind, obgleich sie glauben, ein Denken für sich allein zu haben. Diese Ansätze wurden von den Sophisten zu der Vorstellung verallgemeinert, dass jede Perspektive, also auch alle Moral, durch die Menschen gesetzt wird. Der berühmte Homo-Mensura-Satz des Protagoras lautet in seiner Kurzform: »Der Mensch ist das Maß aller Dinge.« Gemeint ist der Einzelmensch, der sich jeweils in einer konkreten Situation entscheiden muss. Ein anderer Sophist – Gorgias – bestreitet die Möglichkeit einer allgemeingültigen Erkenntnis. Falls sie doch möglich sei, könne sie nicht mitgeteilt werden. Deshalb betonen die Sophisten – die in der späteren Philosophiegeschichte eher einen schlechten Ruf haben – die Wichtigkeit der Situation, in der Menschen handeln.{27} Die Situation richtig zu erkennen und dann die richtige, passende Entscheidung zu treffen wurde in dem Wort kairós (»der richtige, entscheidende Augenblick«) ausgedrückt. Aristoteles kennt gleichfalls diesen Begriff, der in den frühgriechischen Dichtungen (Hesiod, Pindar) eine wichtige Rolle spielte. Alle Handlungen haben ihre rechte Zeit. Sie zu beachten, kann man als Erbe der sophistischen Morallehre betrachten: Es gibt für Gorgias keine allgemein gültigen Regeln oder Begriffe. Richtiges Handeln bedeutet, in jeder Situation dieser gemäß den richtigen Augenblick zu erkennen. Es lässt sich hier ein ähnlicher Gedanke bei Sartre, aber auch in den Lehren des Buddha finden, der Abstraktionen als Einseitigkeit für die Beurteilung von Situationen ablehnt (vgl. AN 5.189).
Mit Sokrates beginnt dagegen die abstrakte, theoretische Philosophie, auch in der Morallehre. Platon – hierin Schüler des Sokrates – stellt die Frage nach dem Wesen des Guten. Das Gute ist eine Idee, die prinzipiell in jedem Menschen angelegt ist. Durch einen systematischen Diskurs kann diese Idee ins Bewusstsein gehoben werden (durch sokratische Mäeutik = Geburtshelferkunst). Das Gute ist die höchste aller Ideen. Platon deutet die Lehre der Sophisten als egoistische Morallehre. Er bekämpft diese Lehre und rückt die Rolle des Staates und der Gemeinschaft in den Mittelpunkt. Er konstruiert in seinem Dialog Politeia einen utopischen Idealstaat durch rein vernünftige Überlegungen, worin jeder Mensch eine besondere Rolle zugeteilt bekommt.
Ein vergleichender Einschub kann das vielleicht illustrieren: Diese Vorstellung Platons erinnert an das Kastensystem Indiens, das der Buddha bekämpfte. Dieses System wird gerade durch die Karmalehre ideologisch stabilisiert: Eine soziale Reform ist sinnlos, weil Benachteiligte durch gehorsames Einfügen in die bestehende Ordnung als moralische Tugend in einem künftigen Leben in höhere Kasten aufsteigen und damit den Lohn für die Leiden als sozial Unterprivilegierte erhalten. Diese Vorstellung ist einer der Gründe, die Karmalehre einer gründlichen Revision zu unterwerfen (vgl. Abschnitt 3.3.4). Auch kann man im Konfuzianismus ähnliche Moralvorstellungen, dort ohne eine Wiedergeburtstheorie, finden. Moralisch handelt, wer sich in eine tradierte Ordnung widerspruchsfrei einfügt. Gleichzeitig sieht Konfuzius aber – darin liegt eine Nähe zum Buddhismus – moralisches Handeln »in der Pflege zwischenmenschlicher Beziehungen« verwirklicht.{28} Dieser Gedanke taucht in Platons Staat durch die am hierarchischen Lebensstil von Befehl und Gehorsam orientierten Vorstellungen vom Handeln in der Gemeinschaft nicht auf.
Platons Konstruktion eines Idealstaates unterscheidet sich allerdings in einem wichtigen Punkt von der indisch-brahmanischen und der konfuzianischen Vorstellung. Denn der Staat bei Platon soll gelenkt werden durch Intellektuelle (Philosophen). Deren Handeln wird aber philosophisch begründet; es leitet sich nicht einfach aus einer übernommenen Tradition (z.B. die Vorstellung vom »Goldenen Zeitalter« bei Konfuzius) ab. Allerdings entsteht die Moral bei Platon nicht aus dem Diskurs der Vielen auf dem Marktplatz (ágorá). Gegen Gorgias betont Platon, dass die bloße Rhetorik zur Bildung der Moral nicht ausreicht. Alle Moral gründet im sittlich Guten, das nicht durch anderes bedingt ist und als reine Idee geschaut werden müsse. Um die Ideen zu erkennen, dazu bedarf es der Philosophen. Die moralische Ordnung des Staates wird also durchaus philosophisch begründet; doch dies nur durch eine soziale Herrschaft der (männlichen) Philosophen, nicht durch die Einsicht vieler Menschen. Sklaven, Frauen und Fremde{29} bleiben von jeder Einspruchsmöglichkeit ausgeschlossen – was übrigens auch noch für Aristoteles gilt und ein bleibender dunkler Fleck in dessen Philosophie ist.
Die Ethik als Wissenschaft wird erst durch Aristoteles begründet. Seine Morallehre wird gemeinhin als klassische Form einer Tugendethik betrachtet. Das griechische Wort, das Aristoteles für Ethik verwendet, lautet ēthos (ἦθος) und bedeutet »Charakter« und »Sitte«, im Griechischen eng verwandt, dennoch unterschieden von ἜθΟς, »Gewohnheit«.{30} Beide Bedeutungen werden sich im Folgenden noch genauer in ihrer inneren Verbindung zeigen. Kurz gesagt: Man kann einmal vom ēthos als der vereinzelten Gewohnheit im menschlichen Handeln sprechen, zum anderen aber ist ēthos auch die soziale Institutionalisierung solcher Gewohnheiten (Sitten, Erziehungssysteme, Normen). Ēthos ist also eine Qualität an menschlichen Handlungen (Praxis), die sie privat und sozial formt. Aristoteles folgt Platon in dessen Kritik der Sophisten, indem er ausdrücklich die Lehrbarkeit des sittlichen Handelns betont. Es gibt, wie auch Platon sagt, mehrere »Seelenvermögen«, die den Charakter eines Menschen ausmachen. Die nicht vernünftigen Seelenvermögen sind jene, in denen der Mensch seiner Lust folgt (hēdonē). Aristoteles lehnt mit Platon die Lehre jener ab, die ausschließlich die Lust als moralischen Handlungsantrieb behaupten (Hedonismus). Die vernünftige Überlegung kann zwischen Lust und Unlust abwägen und so Entscheidungen treffen. Hier führt Aristoteles den Begriff der Tugend ein.
»Tugend« (aretê) bedeutet allgemein eine Vollkommenheit, die einer Handlung zukommt. Insofern ist die Tugend eine Vollendung jeder Handlung. In der Ethik ist die Tugend eine Art Superlativ: das Beste, das Äußerste und das dem Gutsein nach Höchste, die beste Haltung. Aristoteles betont, dass man für tugendhaftes Handeln soziale Anerkennung findet und deshalb auch gelobt wird. Die Tugend ist ein Gegenstand von Lobreden und wird in der Dichtung oder im Theater gleichsam modellhaft vorgeführt. Das Vortrefflichste beim Menschen, die höchste menschliche Tugend, ist in der Vernunft zu suchen. Je nach der Stellung eines Menschen in der Gesellschaft spielen unterschiedliche Tugenden eine vorrangige Rolle. Platon hatte die menschliche Seele in drei Teile eingeteilt, die man kurz mit Vernunft, Wille und Leidenschaft übersetzen kann. Aristoteles verwendet nur eine Zweiteilung. Er unterscheidet zwischen einem rationalen und einem irrationalen Seelenteil. Verstand und Vernunft werden gelehrt und in der Erziehung geübt. Die Tugenden, die den irrationalen Seelenteil, den Willen und die Leidenschaften formen, heißen bei Aristoteles die ethischen Tugenden. Sie formen das Ungeformte am Menschen. Während man Erkenntnisse durch die Vernunft, den Intellekt erwirbt, werden die ethischen Tugenden durch Gewohnheitsbildung anerzogen. Im Unterschied zu den ethischen Tugenden kennt Aristoteles auch die sogenannten dianoetischen Tugenden, die unmittelbar auf den Intellekt bezogen sind: Wissenschaft (epistêmê), Wohlberatenheit (euboulia), Klugheit (phronêsis), Weisheit (sophia), Verstand (synhesis) und Kunstfertigkeit (technê).
Die ethische Tugend formt gleichsam die ungebändigte Natur im Menschen (Wille und Trieb) und verwandelt ihn dadurch in ein soziales Wesen. Die Tugend bildet die Brücke zwischen den irrationalen Leidenschaften des Individuums – die vielfach egoistisch sind – und der menschlichen Gesellschaft. Aristoteles definiert »Tugend« als eine Kunst der Mitte:
»Es ist mithin die Tugend eine Gewohnheit (habitus) des Wählern, der die nach uns bemessene Mitte hält und durch die Vernunft: bestimmt wird, und zwar so, wie ein kluger Mann ihn zu bestimmen pflegt. Die Mitte liegt zwischen zwei fehlerhaften Gewohnheiten, dem Fehler des Übermaßes und dem Fehler des Mangels.«{31}
Die Tugend findet den Ausgleich, die Mitte zwischen den Extremen. Sie ist »ihrem Wesen nach Mitte«.
Das oberste Ziel allen menschlichen Handelns, das zu verwirklichen auch alle Tugenden letztlich dienen, ist das Glück oder die Glückseligkeit (eudaimonia; lat. beatitudo). Wörtlich bedeutet dieser Begriff bei Aristoteles: von einem guten (eu) Geist (daimon) begünstigt oder beseelt zu sein. Das Glück ist das höchste Ziel aller persönlichen oder politischen und sozialen Praxis.{32} »Glück« ist kein mehrdeutiger Begriff. Er kann aber unterschiedlich erläutert werden, etwa als »das gute Leben« oder »das Wohlergehen«. Allerdings wünscht sich jeder Mensch je nach der konkreten Lebenssituation etwas anderes. Glück findet man durch mehrere Bestimmungen, die sich nicht ausschließen müssen: Wohlergehen; Selbstgenügsamkeit; das angenehme, mit Sicherheit verbundene Leben und ein reicher Besitz. Dieses Glück hängt an drei Gütern: äußeren, körperlichen und seelischen. Der Glückliche muss alle drei besitzen. Wahres Lebensglück ist aber für Aristoteles letztlich ein geistiges Gut. So sagt er, dass »allein Philosophen das Lebensglück zukommen wird«, denn alle anderen Glücksformen hängen am Geist (Intellekt). Wenn auch Aristoteles die Tugenden recht pragmatisch am alltäglichen Leben orientiert, so gibt es doch auch eine gleichsam höhere Sichtweise auf die Welt. Er erkennt letztlich die Vergänglichkeit und Nichtigkeit des Daseins:
»Darum heißt es auch mit Recht, dass der Mensch ein Nichts sei und dass nichts von den menschlichen Dingen Bestand habe. Denn Kraft, Größe und Schönheit sind zum Lachen und nichts wert; sie erscheinen uns nur so, weil wir nichts genau zu sehen vermögen.«{33}
Hier nähert sich Aristoteles der buddhistischen Auffassung, eine Nähe, die durch die theistische Rezeption seiner Schriften im Mittelalter kaum ins allgemeine philosophische Bewusstsein getreten ist. Man könnte sagen, die aristotelische Morallehre orientiert sich an der Praxis der Gesellschaft, des alltäglichen Lebens. Dafür lehrt sie die Tugenden als Vollendung des Handelns, um dadurch jeweils in allen Situationen den mittleren Weg zu wählen. Letztlich ist aber eine moralische Vervollkommnung des Menschen nicht von der Welt, der Gesellschaft her zu interpretieren, sondern aus der Erkenntnis des eigenen Geistes, der eigenen Seele. Aristoteles sagt:
»Ehre und Ansehen, Dinge, die man mehr als das übrige zu erstreben pflegt, sind voll unbeschreiblichen Unsinns; denn wer etwas vom Ewigen erblickt hat, der findet es einfältig, sich um solche Dinge Mühe zu machen. Was ist langlebig oder dauerhaft unter den menschlichen Dingen? Nur wegen unserer Schwäche, so meine ich, und wegen der Kürze unseres Lebens scheint uns auch dieses groß. Wenn man dies in Betracht zieht, wer würde dann noch meinen, er sei glücklich und selig – wer von uns, die wir alle gleich von vornherein (wie es heißt, wenn man in die Mysterien eingeweiht wird) von Natur her entstanden sind, als ob wir zu büßen hätten? Denn göttlich ist der Spruch der Alten, wenn sie sagen, dass die Seele Buße zu zahlen habe und dass wir zur Strafe für irgendwelche großen Verfehlungen leben.«{34}
Was Aristoteles hier den »Spruch der Alten« nennt (er denkt vermutlich an Anaximander{35}), lässt sich auch als Einfluss der indischen Karmalehren auf die griechische Philosophie interpretieren. Die Lehre von der Wiedergeburt der Seele ist im alten Griechenland weit verbreitet. Gewöhnlich wird ihr Ursprung Pythagoras zugeschrieben; sie findet sich aber auch bei Pindar. Des Weiteren wurde diese Lehre von Empedokles und später von Platon vertreten und war im Neuplatonismus allgemein verbreitet. Gewöhnlich wird Aristoteles als Gegner des Reinkarnationsgedankens betrachtet. Er lehnte die individuelle Unsterblichkeit der Seele ab, sagte aber stets, dass beim Lernen und Erkennen die Menschen an ein vorher existierendes Wissen anknüpfen. So beginnt seine Schrift Analytica posteriora mit dem Satz: »Alles vernünftige Lehren und Lernen geschieht aus einer vorangehenden Erkenntnis.« Man kann deshalb sagen, dass die Reinkarnationslehre als moralische Lehre gleichwohl von Aristoteles akzeptiert wurde, wie der oben zitierte Text (Protreptikos) nahelegt. Es war wohl vorwiegend die theistische Aristoteles-Rezeption im Mittelalter, die alle Hinweise auf Reinkarnation als ein Moment der Erkenntnistheorie und der Morallehre auszublenden versuchte. Mit Blick auf die buddhistische Ethik kann ich abschließend Damien Keown über das Verhältnis zu Aristoteles zitieren:
»Die Parallele zwischen buddhistischer und aristotelischer Ethik ist, wie ich glaube, in vielerlei Hinsicht sehr eng. Die Ethik des Aristoteles scheint die nächste Analogie zur buddhistischen Ethik, und sie ist ein erhellender Führer zu einem Verständnis des buddhistischen Moralsystems. Sie ist umso wertvoller, weil die Exegese der aristotelischen Ethik ein anspruchsvolleres Niveau erreicht hat als die Ethik im Buddhismus.«{36}