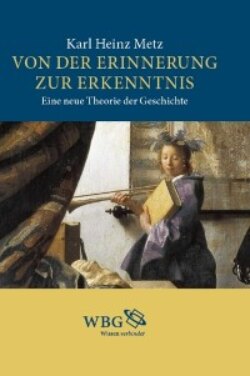Читать книгу Von der Erinnerung zur Erkenntnis - Karl Heinz Metz - Страница 22
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Gewalt als Prozess: Geschichte
ОглавлениеDer Mensch ist fähig, den Tod zu denken, und er ist fähig, überlegt zu töten. Das ist ein Ausgangspunkt aller Menschengeschichte. Die Frage nach der Gewalt wird damit zur Urfrage des Menschen. Daher durchzieht die Frage nach dem Ursprung der Gewalt die Ursprungsmythen der Völker, vom Sündenfall oder der Gabe des Prometheus zum Kains-Mord und dem Elendsgeschenk der Pandora. Daher auch ist die Zähmung der Gewalt der Beginn aller Herrschaft, die nur so lange Bestand hat, wie sie die Gewalt »zähmen«, d.h. ihr befehlen kann. Daran hängt im Ersten wie im Letzten ihre Legitimität, mit der sie sich des Gehorsams versichert. Im Ersten, indem sich Herrschaft dadurch gründet, dass sie sich als überlegen gewaltfähig erweist, im Letzten dadurch, dass sie jeder Herausforderung ihrer Gewaltüberlegenheit standhält. Im »Dazwischen« herrscht Friede, d.h. die Anerkennung der gegebenen politisch-sozialen Ordnung aus Gewohnheit oder Einsicht. Gesellschaft ist damit Ordnung der Gewalt durch Auswahl jener, die gewaltberechtigt sind, also der »Krieger«, die Gewalt organisiert, regelhaft ausüben. Durch ihre Gewaltfähigkeit bzw. Gewalterlaubnis wie durch ihre Bereitschaft, für die Gemeinschaft zu sterben, bilden sie eine Rangordnung in ihrer Gruppe aus, werden sie zur ersten Elite. In ihnen verbindet sich das Friedensgebot: »Du sollst nicht töten« (2. Mose 20,13) mit dem Kriegsgebot: »Der Herr, euer Gott, ist es, der mit euch in den Kampf wider eure Feinde zieht, um euch den Sieg zu verleihen« (5. Mose 20,4). Das Friedensgebot gilt nur innerhalb der Gemeinschaft, wo die Blutschuld des Mordes, d.h. der unberechtigten Gewalttat als todeswürdiges Verbrechen gilt (5. Mose 19, 1–7, 10–13). Das Kriegsgebot gilt jenseits der sozialen Grenze der Gemeinschaft, gegen jene anderen, die als Feinde benannt werden, und es ist so absolut wie das Friedensgebot: »Von den Städten dieser Völker, die der Herr, dein Gott, dir zum Eigentum übergibt, sollst du überhaupt kein Wesen am Leben lassen« (5. Mose 20,16). Die Gewalt, diese Möglichkeit und dieses Schrecknis des Menschen, wird symbolisch der Gottheit übertragen, um dann von ihr zurückerhalten zu werden, in jener Absolutheit, wie sie der Gewalt und der Gottheit gleichermaßen eigen ist. Der Krieg ist ein von der Gottheit gesegneter, wenn er der Eroberung eines Landes dient, das Gott seinem Volk zur Beute gegeben hat. Die Gewalt, durch die Kains-Tat unter die Menschen gekommen, spaltet sich damit in jene des Verbrechens, eben des Mordes »unter Brüdern«, und in die des gottgerechten Tuns, im Töten der Feinde, jener, die nicht in die eigene Gemeinschaft gehören, der Fremden, aber auch jener, die aus dieser Gemeinschaft gefallen sind, der Verbrecher, wie derer, die von Gott abfielen (5. Mose 32, 15–42, 2. Mose 32, 25–29).
Die Bücher Mose erzählen exemplarisch die Geschichte der frühen Gewalt und ihrer symbolischen Verarbeitung. Es ist die Geschichte der Sesshaftwerdung nomadisierender Stämme durch Eroberung und ihres Zusammenwachsens zu einem Volk im Kontext von Territorium, Herrschaft und Kult (ca. 1450–1250 v. Chr.). Der Kult spaltet die Gewalt in verbotene und gebotene, er organisiert sie um die Krieger und verbindet diese zugleich mit den Nichtkriegern zu einer Gemeinschaft. Die Gewalt »nach außen« stärkt den sozialen Zusammenhalt und ermöglicht erst das Entstehen und Fortbestehen einer »politischen« Gemeinschaft durch Landnahme und territoriale Verteidigung. Sie erschließt dem Leben Ressourcen und sichert es durch Verteidigung und Friedensgebot ab. Dabei nimmt die Gewalt den symbolischen Umweg über den religiösen Kult, weil sie ihren Ursprung im Menschen hat. Die theozentrische Wende, vollzogen am radikalsten bei den Israeliten und von ihnen fortgetragen auf die anderen monotheistischen Religionen, sucht die Gewalt durch ihre Rückbeziehung auf die Gottheit sozial kommunizierbar zu machen, bis hin zu Konsequenzen einer Gewalt, »die Gott will«. Krieg wird hier zu einem Auftrag Gottes und die ihn führen, tun sein Werk. Ein solcher Krieg kann nur absolut, eliminatorisch geführt werden und wer ihn nicht nach Gottes Befehl führt, wird von ihm verworfen (1. Samuel 15). Diese Vorstellung des Gotteskrieges ist elementar für die Rechtfertigung der Gewalt in den großen monotheistischen Religionen. Einen Krieg total zu führen, einer weltanschaulichen »Sache« wegen und nicht nur irgendwelcher zu erbeutender »Sachen«: Das ist ein Gedanke, der bleiben wird, bis zu den Kreuzzügen, den Weltanschauungskriegen der Moderne. In der antiken Bürgergemeinde, die nicht den Befehl des einen Gottes kennt, nur vielerlei Götter, die zu befragen und zu bestechen sind, oft uneins unter sich wie die Menschen selbst, wird der Mensch als Verursacher und Träger der Gewalt ungleich bewusster. Steht bei den Israeliten die »Stadt« der Kanaaniter und Baals gegen das »Land« der Juden und Jahwes, so wird in der Antike die Stadt zum Zentrum der Herrschaftsbildung, die Stadt als sozialer Raum der Kommunikation, des Tausches, des Gewerbes. Die Mauer der Stadt bildet die reale wie zeichenhafte Grenze zwischen dem Gebot des Friedens und der Möglichkeit des Krieges, die beide politische Kategorien sind. »Frieden« ist hier das, was eine Grenze hat, metaphorisch wie ganz real. Das althochdeutsche Wort »fridu« bezeichnet den abgegrenzten Wohnbezirk einer Sippe, innerhalb dessen ein absolutes Gewaltverbot herrscht, und es verbindet sich mit den Bedeutungen eines »einfriedenden« Zaunes, des Zustands gesicherten Rechts. Griechen und Römer erleben die Gewalt als Ausdruck des menschlichen Willens nach Macht und Besitz. Die Griechen zerstören sich durch Gewalt. Die Römer hingegen bauen ein Reich. Ihre imperiale Gewalt kennt keine Hybris, nur das »ceterum censeo« des Cato, das Fortgehen der Eroberung bis an den Rand des Erdkreises. Gerade deshalb, weil die Gewalt politisch geworden ist, entwickelt Rom ritualisierte Formen ihrer Bindung und Entbindung. Das Politische der antiken Gewalt erweist sich in diesen Akten der Bindung und Entbindung, aus denen sich die herrschaftliche Ordnung erst konstituiert.
Das Theologische als der Ordnungsgedanke einer sich aus und vor Gott rechtfertigenden herrschaftlichen Gemeinschaft und das Politische als der Ordnungsgedanke einer sich aus und vor den Bürgern rechtfertigenden Verfassung der Herrschaft stehen damit als Alternativen am Beginn der Geschichte Europas. Sie formen wiederkehrende Muster, deren Zentrum der Umgang mit der Gewalt ist. Als der Bürgersoldat dem Söldner, als die bürgerschaftliche Gewaltteilung dem militärischen Gewaltmonopol Platz zu machen begann, zerbrach die Res publica und wich einem Imperium, dessen Essenz der militärische Befehl war. Rom überdauerte den Kollaps der Bürgergemeinschaft, weil es in Jahrhunderten der Kriegsgewalt diese längst in seine Institutionen eingebunden hatte.
Im Konflikt mit dem Gewaltwesen Roms formt sich das Christentum, stellt ihm das Martyrium, die gewaltlose Selbstauslieferung entgegen und erliegt doch zunehmend jener Versuchung der Herrschaft, die allein über eine Teilhabe an der Gewalt zu haben ist. Die Vorstellung des »Heiligen Krieges« schien hierfür eine Rechtfertigung zu bieten, im Gedanken eines von Gott gewollten Krieges gegen seine Feinde. Die Gewalt ereignet sich nunmehr auf der physischen Ebene so gut wie auf der metaphysischen, auf der Gott bzw. Christus und Satan gegeneinander kämpfen, bis die Zeit im schwarzen Loch der Apokalypse verschwindet. Alle spätere Ideologie hat von hier ihren Ausgang genommen und mit ihr die Vorstellung von der rettenden Gewalt. Allerdings zeigt sich die unaufgebbare Spannung zwischen Kreuzigung und Kreuzzug, Gewaltlosigkeit und Heilsgewalt im gleichzeitigen Auftreten von Kreuzzugs- und Gottesfriedensbewegung im 11. Jahrhundert. Das Kriegsgebot erzwingt das Friedensgebot wie bereits in der Antike, wie überall, wo eine politische Gemeinschaft sich zum Krieg rüstet und daher mehr denn je um den inneren Frieden besorgt sein muss. Die Abgrenzung der Nichtkämpfenden von den »Kombattanten« und die Beschränkung rechtmäßiger Gewalt auf das Handeln zwischen Kämpfenden allein versucht sich am Paradox eines Friedens inmitten des Krieges. Die – berechtigte – Gewaltfähigkeit trennt die Geschlechter wie sie innerhalb der Männer trennt zwischen den einen, denen die Gewaltfähigkeit als soziales Eigentum zusteht, und jenen anderen, denen sie verwehrt bleibt. Jeder »Bürger« ist zugleich Kämpfer für seine Stadt und wo er es nicht mehr sein kann, schwindet auch der politische Gehalt seines Bürgerseins, dessen politische Partizipation in der Gewaltteilhabe ihre Wurzel hat. Dieses Prinzip regiert auch das mittelalterliche Fehdewesen. Mit der Erklärung der »Fehde«, d.h. »Feindschaft«, suchten die legitim Gewaltfähigen ihr »Recht« durchzusetzen bzw. Vergeltung für dessen Verletzung zu üben. Das Recht wurde gewalttätig gesucht, nicht kommunikativ. Gottesfriede wie Landfriede bezogen dagegen Stellung, erfolglos, bis das Aufkommen der Pulverwaffen den Kriegerstand der Ritter durch den plebejischen Söldner ersetzte und die Fiskalisierung des Tötens erneut den Aufstieg des Einen zur absoluten Herrschaft ermöglicht hat. Aus den vielen Gewaltfähigen, den Grafen, Rittern, Städten, wurden wenige, die Fürsten des entstehenden Absolutismus. Herrschaft und Land, regnum und terra, wurden eins. Dementsprechend zerfiel die Partizipation, hörte die ständische Repräsentation auf, noch von Bedeutung zu sein. Der Raum des Politischen schrumpfte, verschwand aber nicht, weil in allen Gesellschaften des Westens die Vielfalt der sozialen Gruppen erhalten blieb, deren Eigenständigkeit sich nie gänzlich auflöste. Diese absolutistische Gewaltreduktion war gekennzeichnet durch Zentrierung im Anstaltsstaat, der den mittelalterlichen Personenverband mit seinem feudalen Beziehungsgeflecht zwischen vielen gewaltberechtigten Status-Gruppen ablöste. Das personale wird durch ein bürokratisches Verhältnis ersetzt und die Gewaltfähigkeit folgerichtig in einer bürokratisierten Organisation zentralisiert, dem stehenden Heer. Aus Söldnern rekrutiert, dem im 15. bis 17. Jahrhundert vorherrschenden Zugriff der Kriegsunternehmer entzogen, wird es zum Felsen, auf dem die absolutistische Staatlichkeit gründet. Die mit der Fiskalisierung der Gewalt einhergehende Absurdität »heiliger« oder auch nur »gerechter« Kriege mündet im Verschwinden der Kriegsrechtfertigung. An seine Stelle tritt das »Recht im Krieg«, also Normen der Kriegsführung, an die sich die kriegsführenden Parteien wie Schachspieler zu halten haben. Im Absolutismus sind Kriege die Gewalttätigkeit zwischen den verbliebenen großen Gewaltfähigen, den Souveränen, deren »Souveränität« eben diese Gewaltfähigkeit ist. Die Kriegsführung wird zur »Kunst«, der Krieg zum Mittel der Politik bzw. der Herrschaft, zu einem durchaus ernsten Spiel, doch nicht »bis zur letzten Patrone«. Manövrieren, Festungsbau und Belagerung, Logistik erfordern den »Künstler«, nicht den Schlächter. In der Französischen Revolution büßt die absolutistische Herrschaft beides ein: den Respekt der Anerkennung als Autorität und die Furcht der Bestrafung durch die Gewalt. Ohne sie vermag keine politische Ordnung zu bestehen. Das Theologische, von Machiavelli und Hobbes als Antinomie zum Politischen erkannt und ausgestoßen, kehrt als Ideologie zurück. Der absolute Gott wird durch den absoluten Menschen ersetzt, wie er sich in jenen wenigen inkarniert, die als »Vorhut« die Menschheit in einen »Endzustand« zu treiben suchen, vor dem erneut der Endkrieg steht. Die Gewalt wird eliminatorisch. Mit dem Bastille-Sturm liegt sie »auf der Straße«. Das Volk ergreift sie und füllt dann die langen Reihen der in einen Krieg ziehenden Kolonnen. Die Furcht vor dem Bürgerkrieg, die als Folge der konfessionellen Spaltung den »leviathanischen Staat« als Gewaltmonopolisten begründet und legitimiert hatte, war verschwunden. Der Bürgerkrieg war als »Revolution« in die Gesellschaft zurückgekehrt, euphorisch begrüßt. Die Euphorie des Bürgerkriegs ist immer die Ideologie, die Kennzeichnung der sozialen Verhältnisse als Kriegsverhältnisse, die Kennzeichnung der Kriegsverhältnisse als apokalyptisch, die Kennzeichnung des eigenen Sieges als millenarisch. Unter solchen Vorstellungen wird die Gewalt unter Mitbürgern zu einer Kraft, die rettet, indem sie vernichtet. Halluzinatorisches und Traumatisches stoßen dabei in einer Situation aneinander, in der die Vorstellung persönlicher Verantwortung nicht länger gilt. Man tut, was vordem verboten war. Man tut es mit vielen, in der Menge. Man darf »alles«, weil es Redner gibt, »Demagogen«, welche die Gewalt in die Sprache bringen. Die Kommunikation zerfällt, wo die Begriffe nur noch nach »Freund« und »Feind« sortiert werden dürfen, wo der hermeneutische Sinn des miteinander Redens, d.h. Verstehen und Verständigung, abhanden gekommen ist. Im Gewaltmoment ist das der Fall. Die Redner räumen das Bewusstsein frei von allen Begriffen der alten Sprache und setzen jene neuen an ihre Stelle, deren genauere Bedeutung durch Kommando festlegbar ist und deren Bedingung in der Vernichtung des Vorhandenen besteht. Solche Gewaltmomente hat es immer wieder gegeben, in denen die Gewalt zuerst in die Kommunikation, dann auf die Straße stürzt. Mit der Französischen Revolution jedoch sind sie konstitutiv geworden für jene europäische Moderne, die politisch von ihr den Ausgang nimmt.
Die Revolution ist selbst ein totalitäres Experiment, das erste, mit noch ungenügenden technischen Mitteln. Diese werden durch zwei fortwirkende politische Erfindungen ersetzt, den Terror als System und die Demografie als militärischer Faktor. Der neue Krieg ist als »Volkskrieg« eines Volksstaates die Pflicht aller körperlich Wehrfähigen. Er verpflichtet gleichzeitig alle Nichtkämpfenden zur Kriegsanstrengung durch Arbeit und weltanschauliche Bedingungslosigkeit, was das Verbot jeglicher »Kollaboration« und die Benennung des Gegners als eines absoluten Feindes nach sich zieht. Mit dem Volksheer öffnet sich die Bevölkerung als nahezu unerschöpfliches »Menschenmaterial« für eine Kriegsführung, die auf »Schlachten« setzt und letztlich im Ausbluten des Feindes, seinem physischen und moralischen Kollaps, ihr Ziel findet. In der Gewalt verwirklicht sich die Totalität der Moderne zuerst, bildet eine Struktur, zu der auch die Figur des Partisanen gehört, für den zwischen Politik und Gewalt gleichfalls kein Unterschied besteht. Damit wird der revolutionäre Krieg vom Ende des 18. Jahrhunderts zum totalen Krieg des zwanzigsten. Der Faktor Technologie, d.h. die Vernichtung von Massen durch Massenvernichtungsmittel, radikalisiert die revolutionäre Totalität. Krieg ist zum Massengeschehen geworden, vor wie hinter einer Front, die zunehmend parallelisiert wird durch eine Heimatfront und eine Partisanenfront. Technische und ideologische Anonymisierung des Feindes greifen ineinander. Die Paralysierung der Heimatfront, die demografisch wie industriell Ressourcen für die Kriegsfront bereitstellt, wird zum als kriegsentscheidend erachteten Ziel, das so pauschal durchgeführt wird wie die Vernichtung der Partisanenfront auf Seiten der Besatzer. Die massenhafte Herstellung von Kriegsgerät und der massenhafte Transport zu jedem Punkt der Erde, die Nutzung der Wissenschaft zur raschen Herstellung totaler Vernichtungsmittel, führen zum ersten »Welt«-Krieg (1939–1945), der nahezu alle Nationen betraf und auf zwei Kontinenten mit riesigen Verlusten an Menschenleben ausgefochten wurde. Dass die wechselseitige Ausrottungskapazität den dritten, diesmal atomaren Weltkrieg letzten Endes verhindert hat und dass infolge einer rasant wachsenden Weltbevölkerung der Anteil der gewaltsamen Todesfälle proportional im 20. Jahrhundert zurückgegangen ist, hat nichts mit einem universalhistorischen Rückgang der Gewalt zu tun, ist vielmehr einer universalhistorisch einzigartigen demografischen Wucht zuzuschreiben. Hunger und Seuchen haben stets die Todeswucht der Gewalt vervielfacht: Noch gegen Ende des Ersten Weltkriegs sind mehr Menschen an einer durch Hunger vorbereiteten Grippewelle gestorben als im Krieg gefallen. Die Demografie glich alles aus, weil durch Medizin und bessere Ernährung immer mehr Neugeborene überlebten. Der Menschenmangel früherer Jahrtausende hat einer Menschenflut Platz gemacht, in der die vom Krieg Getöteten im Verhältnis »wenige« bleiben, es sei denn, man würde sie mit dem »A, B, C« multiplizieren, jener Logik technologischer Vernichtung, die der demografischen Massenwucht widersteht. Das ist (bisher) nicht geschehen, doch darf man nicht unterschlagen, dass es mehr als einmal angedacht worden ist.
Als Grundformen solcher Gewalt im 20. Jahrhundert kann man demnach den demografischen, den technologischen, den Partisanen- und den totalen Krieg nennen. Diese Formen sind miteinander verflochten. Der demografische Faktor ergibt sich aus der Bevölkerungsrevolution zwischen dem späten 18. und dem späteren 19. Jahrhundert (als Menschen von einem Knappheits- zu einem Überschussgut geworden waren). Krieg und Sieg sollten nun durch die Ausbeutung der großen Zahl als Ressource gewonnen werden. Der technologische Faktor ist das Resultat der industriellen Revolution, welche die Herstellung von Waffen auf das Fließband übertragen hat. Seine Totalität gewinnt er durch die Verbindung mit wissenschaftlicher Forschung. Der Partisanenkrieg wiederum realisiert Totalität als Ideologisierung der Vernichtungstätigkeit, die keine »Grenzen« mehr anerkennt. Letztlich sind alle diese Faktoren bereits totale Kriege. Der sog. totale Krieg fügt sie nur zu einer Gesamtheit zusammen. Seine Konsequenz ist die tatsächliche Auflösung der Unterscheidung von Kombattanten und Nichtkombattanten. Auf dem Höhepunkt des zivilisatorischen Humanismus zeigt sich die kriegerische Gewalt als blicklose Vernichtung. Die Blicklosigkeit des modernen Kriegers ist die des Blicks auf den Bildschirm eines Rechners. Kein Blick mehr auf das brennende Troja, nicht einmal einer auf das brennende Hiroshima aus der Höhe des Bombers. Die militärische Gewalt ist mathematisch geworden, bzw. sie operiert mit mathematisch organisierten Vernichtungsmitteln. Ein neuer Typ des Soldaten ist entstanden, ein Ingenieur-Soldat, der mit spezialisierten Programmen und großen Rechnerkapazitäten im »Cyberspace« einen vernetzten Krieg führt, über Satelliten bewaffnete Drohnen steuert (ab 2002) oder über Schadprogramme feindliche Netzwerke attackiert (ab 2010). Entscheidend ist dabei stets der möglichst rasche Zugang zu Informationen, wobei Satelliten im »Weltraum« als Übertragungs- und Spionage-Vorrichtungen unentbehrlich geworden sind. Die Zerstörung feindlicher bzw. der Schutz eigener Satelliten wird somit zu einer militärischen Aufgabe von zentraler Bedeutung, ausgeführt an Computern, gesteuert von »armchair warriors« oder ihren Nachfolgern, automatisierten Vernichtungssystemen. Die kriegerische Gewalt sitzt im »Lehnstuhl«. Doch sie kehrt in der Asymmetrie des Terrors nackt zurück.