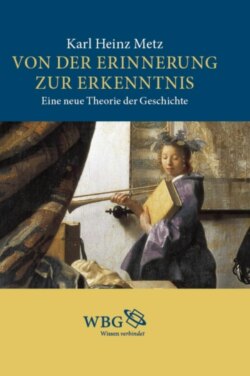Читать книгу Von der Erinnerung zur Erkenntnis - Karl Heinz Metz - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Erinnerung
ОглавлениеGeschichte ist das, was übrig bleibt, in physischen Resten, im kollektiven Bewusstsein. Wenn alles, was Menschen tun, eine kommunikative Bedeutung besitzt und nur diese, dann wird alles zum Rätsel, wenn die seine Bedeutung kommunizierenden Menschen verschwunden sind. Oder es wird weniger als das, es wird gleichgültig, versinkt im Wüstensand, ist überwuchert vom Urwald. Nahezu alles, was Menschen tun, wird vergessen, hinterlässt nicht einmal mehr Reste, die Rätsel aufgeben. Die Erinnerung ist ein dünner Faden, der ständig reißt. Und doch ist die Erinnerung das Einzige, was der Mensch der Zeit entgegenzusetzen vermag, der Zeit und ihrer Vernichtung des Lebens durch den Tod. In der Abfolge der Generationen widersteht der Mensch der Zeit, indem er sich in den Zyklus beugt. In der Abfolge der Generationen entsteht die Überlieferung, als Bericht von den Ahnen, die immer weiter zurückreichen und eine lange Dauer schaffen, etwas, das der Zeit widerstanden hat und deshalb Legitimität erzeugt. Dauer gilt hier als Ausweis des Wahren. Sie trotzt der zerstörerischen Macht des Todes, wie es sonst nur die Götter vermögen. Die Unsterblichen herrschen über die Sterblichen, weil sie nicht dem Tod unterliegen. Erinnerung schafft ein Stück Unsterblichkeit, das ist ihre Magie. Deshalb ist die Vernichtung der Erinnerung stets das größte Siegeszeichen geblieben, von der »damnatio memoriae« der Römer bis Kaliningrad. Eine solche Vernichtung ist nur durch das Verschwinden der Menschen zu erreichen, die sich erinnern können. Was an Ruinen bleibt, ist dann gleichgültig, und die Welt ist voller Ruinen, die erst entdeckt, z.T. metertief ausgegraben werden, wenn ihnen erneut kommunikative Bedeutung zugewiesen wird. Aus Resten, auch solchen der Erinnerung, wird Überlieferung, und der neue Blick auf sie benennt sie als Bruchstücke und sucht nach einem Zusammenhang, der von einem hergestellt wird, der nicht mehr im Zusammenhang der Erinnerung steht. Der Historiker, wie er hier auftritt, ist einer, der »Zorn und Eifer« einer Erinnerungsgemeinschaft hinter sich gelassen hat und zwar die Bedeutungen verstehen will, die sie ihren Handlungen zugemessen hat, sie aber nicht wie selbstverständlich teilt. Er schafft eine neue Bedeutungsebene jenseits davon und damit zugleich auch eine neue Form der Kommunikation. Der erste Historiker in diesem Sinn ist Thukydides (460–399). Er erzählt die Geschichte des Peloponnesischen Krieges, eine Geschichte seiner Zeit, aus der Perspektive des Exils, eines symbolischen wie realen. Es ist eine Wende, welche die Überlieferung von der Erinnerung trennt, in der Chronologie eine sich entfaltende Logik wachsender Zwänge erkennt, die jedoch nicht in Fatalismus endet, sondern durch ihre Darstellung zu Erkenntnis führt. Aus dem Wissen über einen Krieg soll Wissen über den Krieg schlechthin werden, ein Wissen für alle Zeiten.
Der Weg von der Erinnerung zur Erkenntnis ist der Weg der Kritik. Sie meint alle Menschen, erstrebt den Nachvollzug ihrer Einsichten durch alle und nicht nur durch eine sich über die Erinnerung ihrer Gemeinsamkeit versichernde Gruppe. In ihr weicht der Mythos der Ahnen, der Götter, der Gottheit, die nur für die eigene Gruppe Bedeutung haben, vor einer Endlosigkeit zurück, in der die Menschen mit sich alleine bleiben. Kritik entsteht da, wo die Homogenität der Erinnerungsgemeinschaft bricht. Daher ist der Weg der Erinnerung, die Identität stiftet und eine Ganzheit des Wissens wie des Zusammenhangs vorgibt, stets anziehender gewesen als jener, der von einer Überlieferung der Reste ausgeht, die lediglich konstruierend zusammengesetzt werden können. Der Mensch der Historie lebt in der Radikalität der Zeit, aus der ihn nichts mehr rettet. Die Erinnerung hingegen widersteht der Radikalität der Zeit und dem Chaos, weil sie sich einen Zusammenhang fabuliert, den sie für die Wirklichkeit hält. Sie vermag dies deshalb, weil sich im Akt des Erinnerns das gespeicherte Vergangene mit der Gegenwart des jeweiligen Erinnerns verbindet, d.h. an Wirklichkeit zunimmt. Je öfter also etwas erinnert wird, desto wirklichkeitskräftiger wird es, desto mehr entfernt es sich von dem, was es ursprünglich benennen wollte. In diesem Zusammenhang gibt es keine Leerräume gewussten Nichtwissens und also gibt es »Sinn«. Das trifft für die individuelle Erinnerung ebenso zu wie für die kollektive, die im Erzählen und Nacherzählen fortgereichte Erinnerung einer Gruppe. Daher ist die Skepsis der Kritik nirgends so stark wie da, wo ihr die Erinnerung als Wahrheitsanspruch entgegengestellt wird, als Augenzeugenberichte, als Memoiren: Authentizität, die in die Jahrzehnte gekommen ist, Arbeit am Gedächtnis, um Rechtfertigung vor dem Heute bemüht. Die Erinnerung ist wie ein Webstuhl, auf dem die Fäden verschiedensten Wissens in einem dichten Zusammenhang verbunden werden, und je länger diese Erinnerung weben kann, desto unerkennbarer wird das Ereignis, von dem die Rede ist. Die Erinnerung schließt nicht nur Lücken durch das Zusammenziehen ganz unterschiedlicher »Fäden« des gespeicherten Wissens. Sie schafft auch verborgene Lücken durch Vergessen dessen, was nicht in das »Muster« passt, ein Muster, das im Rückblick Rechtfertigung erzeugt. Sie ist die Dauer der Zeit im Bewusstsein, d.h. die einzige Zeit, die bleibt, vor der Gegenwart, deren Realität gerade dadurch unbezwingbar wird, dass sie ständig entschwindet. Die Gegenwart ist die einzige Art von Zeit, in der wir handeln können, eben weil sie sich unentwegt in Vergangenheit auflöst. In der Vergangenheit hingegen handeln wir nur fiktiv, indem wir erinnern, erfinden, vergessen. Die verlorene Zeit ist die einzige, die wir dauerhaft besitzen. Die Erinnerung ist das Versprechen, die Zeit zu überstehen. Daher ist sie vor aller Historie da. Erinnern erweist sich damit als anthropologische Größe. Sie ist so konstitutiv für das Menschsein wie die Gewalt, d.h. die bewusste Gewaltregulierung, die Technik, d.h. die mit Werkzeugen umgehende, Artefakte herstellende Arbeit, die Sprache, d.h. die Kommunikation durch Zeichen jenseits bloßer Laute bis hin zur Schrift, die Sicherheit, d.h. die soziale Verbindung als Vertrauensbeziehung gründende Erwartbarkeit wechselseitigen Beistands. Mehr als das: Die Fähigkeit zu erinnern liegt all den anderen Kategorien zugrunde. Ohne das Erinnern wären sie gar nicht vorhanden. Ohne Erinnerung, als Gedächtnis gespeichert, gibt es unter Menschen weder Gesellschaft noch Individualität, weil niemand zu sagen vermöchte, wer er ist, als Einzelner wie als Teilhaber am Sozialen, besäße er keine Erinnerung. Identität gibt es nur, wo Erinnerung ist.
Auch Tiere können sich erinnern, vor allem, wenn sie im sozialen Verband leben, in dem die Regeln des Verhaltens immer mehr gelernt werden müssen, je komplexer der Verband wird. Erinnern speichert ab, erzeugt Langfristigkeit des Wissens, aber keine Endlosigkeit. Eben darin besteht seine kulturelle Macht. Dass das Erinnern als langfristige, doch bewegliche Tätigkeit zu einer flexiblen, Vergessen und Neulernen aktiv verbindenden Kraft geworden ist, hat vermutlich zwei Ursachen. Eine davon besteht in der menschlichen Vorstellung der Sterblichkeit. Im Wissen um den eigenen Tod als tiefste Verletzbarkeit des Lebens entfaltet sich das Totengedenken, das im Ahnenkult sich der Gemeinschaft als Dauer vergewissert und im religiösen Kultus nach der Unsterblichkeit forscht. Man entfernt die Toten aus dem umgrenzten Bezirk der »Stadt«, in dem der Tod keinen Ort haben soll, weil ihm stets etwas Gewaltsames zueigen bleibt, Gewalt gegen das Leben, dessen Sicherheitskreis die Gemeinschaft ist. Man legt ihre toten Körper »vor den Mauern« ab, welche die Lebenden schützen, und holt sie dann symbolisch, d.h. erinnernd zurück.
Die Toten sind die »Größeren«, Erhabenen, den Göttern ähnlich, die »maiores«, wie die Römer sie ehrfurchtsvoll nennen. Bei den Griechen wird die Erinnerung selbst vergöttlicht, als »Mnemosyne« dem Zeus nahegerückt und als Mutter der Musen gefeiert. In der ehrenden Erinnerung ihrer Vorfahren gewinnen die Nachfahren Anteil an etwas Überzeitlichem, so wie im Dienst der Musen der Erinnerer, der Sänger, Dichter gleichfalls einen solchen Anteil gewinnt. Der Tod verlischt, die Erinnerung überwältigt ihn. Erst mit dem Christentum ändert sich das, mit der Vorstellung einer körperhaften Auferstehung und dem Wartezustand der Seelen in einem Zwischenreich, später »Fegefeuer« genannt. Damit ändert sich zugleich die Weise des Totenerinnerns vom Polis-Erinnern, das den Verstorbenen ein Dasein »in der Stadt« ermöglichen soll, zum Sünden-Erinnern, das ihnen – durch nachgereichte »gute Werke« – die Sündenstrafen verkürzen soll. Die Anwesenheit des toten, doch auf seine Auferstehung wartenden Körpers im geweihten Grund des Kirchhofs und das Totengedenken im sündenmindernden Weiheraum der Kirche verbinden sich.
Technik und Kult bilden die ersten Zeichen, die der Mensch gegen seine Schwäche setzt, physisch wie metaphysisch. Die Technik sichert die Präsenz der Lebenden, doch die Erinnerung sichert die Präsenz der Toten. Der Unwille, sich den Tod als etwas Endgültiges vorzustellen, mit seiner typisch menschlichen Geste, den Leichnam nicht einfach liegen zu lassen, vielmehr ihn in irgendeiner Weise zu bestatten, hat zur Folge, die Toten in der Gemeinschaft halten zu müssen, durch Rituale der Erinnerung, auch um sich vor ihrer möglichen Rachsucht zu schützen, dachte man sich doch die Toten als Geister weiterhin wirksam. Rituale, Feste der Erinnerung bleiben unentbehrlich, weil sie die Erinnerung mit Gefühlen der Gemeinsamkeit verbinden, aber auch, weil sie Konformität erzwingen. Rituale fixieren und erneuern die in der Erinnerung legitimierten Normen, weshalb die Zerstörung der Rituale bzw. der sie feiernden Feste die Bedingung einer Zerstörung der Erinnerung gewesen ist, die eine neue Erinnerung durch das Setzen neuer Feste, Festtage zu erreichen sucht, von den Festkalendern des Christentums bis zu denen der Französischen Revolution, bis heute. Erst wenn die Toten in der Tradition keinen Platz mehr finden, weil die Lebenden darin keinen mehr finden können, erhebt die Historie Anspruch auf den sozialen Platz der Erinnerung, indem sie alles in Überlieferung zu verwandeln sucht, als Distanz zu den Toten wie den Lebenden. Gesellschaftlich wirksam wird der Tod des Todes seit dem 18. Jahrhundert mit der Skepsis der Aufklärung, den Brüchen der Großen Revolution, dieser Apotheose der Zerstörung. Eine neue Zeit setzt ein, buchstäblich, mit der Setzung des Jahres »Eins« und der Streichung der 1793 christlichen Jahre davor, d.h. einem neuen Kalender, der mit der Gründung der Republik und der mit ihr vollzogenen »Weltrevolution« beginnt. Das Davor, die Erinnerung also, soll nichts sein und ihre Reste ebenfalls, die Klöster, Kirchen, die Bastille, die Körper der Toten, der eben noch Lebendigen, aber Guillotinierten, wie der lange Verstorbenen, die man aus ihren Gruften reißt und wegwirft, zur finalen Zerstörung in ungelöschtem Kalk. Seitdem haben Revolutionen immer wieder über den Tod gesiegt, ohne ihn je zu überwinden. Die Sterblichkeit bleibt an den Menschenleib gebannt, so sehr man sie durch die Unsterblichkeitserklärung eines Kollektivs und einer die Geschichte zurücklassenden Endzeit, Endgesellschaft zu relativieren sucht. In ihr verschwindet der Einzelne so vollständig im Kollektiv, dass sein Tod bedeutungslos wird, ohne Erinnerung bleibt. Er stirbt so, wie ein Stein zur Erde fällt. Alle Totalitarismen, und das ist ihr Unterschied zu aller Religion, lassen den Einzelnen hinter sich, erinnerungslos. Er verschwindet, in Kalkgruben, Massengräbern, Feueröfen.
Der Tod der Erinnerung ist die Finalität des Todes. Die Römer etwa wussten es in ihrem geradezu verzweifelten Flehen um Gedenken, um Anwesenheit im Bewusstsein der Lebenden. Das Christentum ist in anderer, doch kaum weniger intensiver Weise von der Erinnerung besessen. Sich als Christ an die Toten erinnern heißt entweder, sich an sie als Heilige zu erinnern, um Fürsprache bei Gott zu bitten, oder sich ihrer als Sünder zu erinnern, die Fürsprache brauchen, um der Verdammnis zu entrinnen. Vom Ahnengedenken über das Ruhmesgedenken bis zum Gebetsgedenken spannt sich der Bogen einer Erinnerung, in der das Totengedenken alles auf sich zieht. Wer sich seiner erinnert, über seine Geschichte verfügt, behauptet sich als eigenständig, sei es als Person oder als Gruppe. Herrschaft ist immer auch Befehl, was zu erinnern, was zu vergessen ist. Deshalb ist die früheste und wirksamste Form einer Herrschaft über das Bewusstsein das Ruhmesgedenken, eines Helden wie der zu Helden erklärten Toten, zu denen Kämpfer zählen, aber auch Märtyrer. Der Beruf des Erinnerers entsteht. Barden, Sänger speichern Erinnerung stellvertretend ab, tragen sie der Gemeinschaft vor, geben sie weiter. Sie tun es von den Hallen hellenischer Fürsten des 7. Jahrhunderts v. Chr. bis zu denen schottischer Clanführer des 17. Jahrhunderts n. Chr., bis zu denen der afrikanischen Ashanti-Könige. Bleibt hier die Erinnerung in einer Person aufbewahrt, an das Leben gebunden, so verlässt sie dieses mit der Schrift, die Totes zu Totem fügt und eben deshalb ungleich mehr aufzubewahren vermag. Lebendige und tote Erinnerung spalten sich. Ist in der lebendigen Erinnerung stets ein Vorgang des Veränderns und Vergessens wirksam, so bleibt in der toten alles erhalten, prinzipiell zumindest. Deshalb misstraut der Historiker jeder lebendigen Erinnerung und sucht die Toten im Toten, in Texten, Überresten, in dem also, was unabsichtlich überliefert worden ist. In allem Absichtlichen ist Absicht, Rechtfertigung, Erzählung aus jenem Hinterher, in dem jeder »klüger« geworden ist.
Die Kritik tritt dazwischen. Sie will das Erinnern durch die Reflexion ersetzen. Sie erzeugt Fremdheit, wo zuvor Heimat war, indem sie jene Einheit der Zeitvorstellung auflöst, in der sich der Erinnernde überall zuhause fühlte, weil er vergisst, was stört, und Eindeutigkeit schafft, die man nur noch als Fremder zu überwinden vermag.