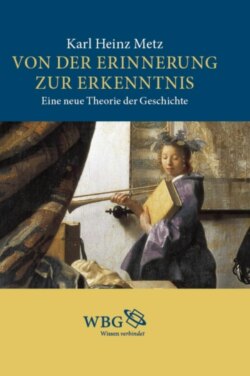Читать книгу Von der Erinnerung zur Erkenntnis - Karl Heinz Metz - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Gewalt als Entbindung: Krieg
ОглавлениеIm Gesicht des Soldaten verbindet sich unauslöschlich das Antlitz des Helden mit dem Schädel des Toten. Die politisch organisierte Gemeinschaft, die Civitas, der Staat, weist ihm das Töten als Aufgabe zu, fordert es als Bürgerpflicht immer wieder ein und trennt ihn gerade dadurch von ihrem gründenden Kern ab, in dem die Gewaltlosigkeit zu ihrem Zweck und Ethos geworden ist. Die Zweigesichtigkeit des »Soldaten« zeigt sich demnach in seinem Verhältnis zu dieser Gemeinschaft, die mit ihm der Gewalt eine Stelle zuweist und eben deshalb so sehr darum besorgt ist, sie in Regeln zu fassen. Dass der Weg aus dem Friedensraum der »Stadt«, der Gemeinschaft, in den Gewaltraum des Krieges zugleich ein Weg durch die Seele der betroffenen Menschen war wie einer durch die seelische Verfassung der Gemeinschaft, der nur rituell zu bewältigen ist, hat über Jahrhunderte hinweg das Verhältnis der Civitas zur kriegerischen Gewalt geprägt. Die Mauer um die Stadt umgrenzt den Friedensraum. Sie ist ebenso Symbol wie Bastion eines Friedens unter den Bürgern, der die Gemeinschaftlichkeit »nach innen« erhält, so wie er diese als Verteidigung »nach außen« zu sichern sucht. Deshalb ist die Gewalt zwischen den Bürgern, ist der Bürgerkrieg eine solche Katastrophe. Das »pomerium« der Römer trennt in diesem Sinne geografische wie mentale Räume und die Entschiedenheit, mit der dieses Kriegsvolk auf die Verbannung der Gewalt, ihrer Zeichen wie ihrer Götter, aus der Stadt achtete, verweist auf einen tiefen Begriff dessen, was Gewalt ist.13 Gewalt ist die Furcht des Menschen vor den anderen. Die tiefste Einsicht des Menschen in die Gewalt aber ist die Furcht vor sich selbst. Er überwindet sie durch Formen »pomerischer« Ritualisierung, mit denen er sich durch die Gesellschaft zu sichern sucht, und durch Formen »kameradschaftlicher« Kollektivierung, mit denen er sein Leben sichern will. Die Kameradschaft ist die Solidargemeinschaft der Kämpfer, in welcher ein sozialer Zusammenhalt nur entsteht, weil allein durch die Tötungsgemeinschaft eine Sicherung gegen das Getötetwerden gegeben zu sein scheint. Die Kampfeinheit als jene elementare Solidargruppe, in der das Überleben vom unbedingten Zusammenhalt abhing und in der das Funktionieren einer Befehlshierarchie jeder auflösenden Verunsicherung entgegenwirkt, lassen eine Truppe kämpfen. Der kriegerische Verband integriert demnach im Kontext des Gewalthandelns und also im Gegensatz zum politisch-sozialen Verband mit seinem grundsätzlichen Friedensgebot. Bleibt in der politisch verfassten Gemeinschaft die Gewalt ein Ausnahmefall, so wird sie in der Situation des Krieges und in der ihn exekutierenden Gemeinschaft zur Selbstverständlichkeit. Die Selbstverständlichkeit der Gewalt im Krieg und die Selbstverständlichkeit der Gewaltlosigkeit im Frieden miteinander zu verbinden, wird damit zur zweiten großen kulturellen Herausforderung. Ging es bei der ersten um die Versöhnung der Gottheit nach dem Raub des Todes, so geht es nun um die Versöhnung von Krieg und Frieden als der beiden Handlungsmöglichkeiten einer politischen Gemeinschaft. Dass eine Versöhnung von Leben und Tod ohne göttlichen Beistand unmöglich erscheint, prägte auch die Ritualisierung des Krieges, der Zeremonien, die ihn einleiteten und beendeten. Deshalb muss die Entdeckung, dass im Krieg nichts war als menschliche Gewalt, kein Gott, nur menschliches Totschlagen, etwas ungeheuer Erschütterndes gewesen sein. Thukydides hat den Peloponnesischen Krieg in dieser Weise verstanden, als Schicksal, das sich Menschen selber antun.14 In ihrer Gewalttätigkeit unterliegen sie einem »Zwang der Natur«, der in ihnen selbst verwurzelt ist. Daraus ergibt sich zugleich, »dass Recht im menschlichen Verkehr nur bei gleichem Kräfteverhältnis zur Geltung kommt, die Stärkeren aber alles in ihrer Macht Stehende durchsetzen und die Schwächeren sich fügen«.15 Man kann »schönklingende Worte« darüberschütten, von »Ehre«, den »Göttern«, von »Rechtsgründen« reden. Am Ende entscheidet allein die überlegene Gewalt. Wie erblindet taumelt sie durch die politischen Gemeinschaften, in denen Furcht, Ehre und Beute aufeinander einwirken und so etwas wie politische Macht entstehen lassen. Krieg und Bürgerkrieg gehen ineinander über, und mit derselben Erbarmungslosigkeit, mit der die jeweiligen Sieger die jeweils Besiegten vernichten, ihre Städte dem Erdboden gleichmachen und die Bewohner erschlagen oder versklaven, mit eben derselben Erbarmungslosigkeit schlachten sich die Bürger gegenseitig ab. Der Krieg als »pathologischer« Zustand zerstört alle moralischen Hemmungen, »denn in Frieden und Wohlstand leben Städte und Menschen nach besseren Grundsätzen, weil sie nicht in ausweglose Not geraten«.16 Der Krieg steht im Zentrum des politischen Handelns, er lässt soziales Handeln erst »politisch« werden, weil er über die Existenz einer Gemeinschaft entscheidet. Der thukydideische Mensch stürzt in den Abgrund, der er selbst ist und in dem niemand ihn erwartet, kein Gott, auch keine Civitas, die ihn heimführt in den Frieden.
Der Krieg realisiert die erste, elementare Möglichkeit des Menschen, nämlich die, gewalttätig zu sein. So sieht es Thukydides und er fügt seine auslösenden Faktoren hinzu: Furcht und Beute, dazu die Ehre. Die »Ehre« ist die rhetorische Floskel, hinter welcher der Wille steht, die eigene Macht zu erhalten und zu vermehren. Die »Furcht« ist eine Bewusstseinsreaktion auf das Wissen um die stete Möglichkeit kriegerischer Gewalt, die alles zerstört. Die »Beute« hingegen als Nutzen dieser Gewalt für den Sieger ist über jedes Plündern hinaus die Okkupation von Territorium. Die Forderung der Philosophen, kriegerische Gewalt sei nur zulässig, wenn sie sich gegen »Barbaren« richte, die als potenzielle Sklaven auf diese Weise in den wirklichen Zustand der Unterwerfung versetzt werden würden, zieht dann für die Epoche die Konsequenz aus den innergriechischen Kriegen und weist über sie hinaus auf das Grundmuster folgender Kriegsrechtfertigung, auf die kulturelle Minderwertigkeit »der Fremden«, die das Feindsein in neuer Weise begründet. Nicht zuletzt verstanden die Römer ihre Kriege derart als zivilisatorische Gewalt. Die lange Dauer Roms entwuchs einem juristischen Ethos der Normen, das sich auch ohne Götter zu erhalten vermochte. Durch die Verrechtlichung der Gewalt in formellen Akten und Zeremonien sollte die Regularität, die ein Zeichen des Friedens und der Gewaltlosigkeit war, mit der Erklärung des Krieges verbunden werden. Dieser rechtlichen Fixierung der kriegerischen Gewalt entsprach ihre politische Fixierung in der Einheit von Bürgerecht und Kriegspflicht. Nur dem Staatsbürger blieb kriegerische Gewalt erlaubt, als Pflicht und eben nicht als Willkür. In den despotisch organisierten Gemeinschaften hingegen suchte die sich in der Person des Herrschers ausdrückende Herrschaft diese Gewalt der Gemeinschaft zu entziehen, indem an die Stelle des Bürgerkämpfers der Soldkämpfer trat, der kein »politisches« Verhältnis zu dieser Gemeinschaft besaß, nur noch ein zeitweises, fiskalisches zur Herrschaft und zum Herren. Der Übergang vom Kriegsdienst als Teil der Bürgerpflicht, in welcher der »civis« zum »miles« wurde, zum Kriegsdienst als Bezahltätigkeit ist folgerichtig bei den Römern als Verfallsbeginn der »Republik« begriffen worden. Es war eine Lehre für die Jahrhunderte und zugleich eine Struktur. Die Lehre war die einer Wechselverbindung zwischen den Ordnungen der kriegerischen Gewalt und der politischen Herrschaft. Die entwaffnete Gesellschaft und die alleine waffenbesitzende Herrschaft standen einander in der Distanz von Ohnmacht und Macht gegenüber. Es war die Struktur der Despotie, der jedoch eine andere widersprach, wie sie für jenes »lange« Europa kennzeichnend geworden ist, das in der Antike einsetzt und von den selbstregierenden Städten, Stadtrepubliken geprägt ist. In Europa blieb die kriegerische Gewalt nie auf Dauer das Zeichen und Mittel der Herrschaft weniger oder des Einen. Sie wurde immer wieder Eigentum des »Volkes«, der vielen, von den Städten der Antike, des Mittelalters, bis zu den Revolutionen der Moderne, deren spezifisch politischer Charakter, über alle »rebellions of the belly« hinaus, sich wesentlich aus dieser »politischen«, partizipatorischen Prägung der kriegerischen Gewalt ergeben hat. Politische Freiheit und Wehrpflicht formen die beiden Seiten des europäischen Civis-Prinzips bis hin zu seinem Zerfall in Totalitarismus. Dass eine politische Ordnung beides sein muss, wenn sie Bestand haben will, dass sie ein Gebilde der Kommunikation ist, das zwischen den Polen der Autorität und der Gewalt vermittelt, und dass ein Kollaps der Kommunikation die Gewalt zur bestimmenden Kraft im politischen Geschehen werden lässt, zeigt sich auch in den Bedeutungen des Wortes »Krieg«. Wenn »war« von »Wirrnis, Verwirrung« bezüglich des richtigen Verhaltens abzuleiten ist, so verweist »Krieg« ursprünglich auf einen Streit um das Recht, der nicht gewaltsam ausgetragen werden musste. Erst die mittelalterliche Fehde-Berechtigung, also das Recht für Herren, sich ein behauptetes Recht gewaltsam zu sichern, verschiebt dann die Bedeutung. Krieg wird zur Gewalt von Herren, und je mehr der entstehende Fürstenstaat die feudalen Machthaber unterwirft, desto eindeutiger wird seine moderne Bedeutung als gewaltsame Auseinandersetzung zwischen Staaten. Das »Recht«, um das gestritten wird, verwandelt sich zum Recht, Gewalt auszuüben. Der zur Gewalt gewordene Krieg hatte als Rechtsbezug nur noch das »Recht zum Krieg« und allenfalls noch ein »Recht im Krieg«, vor allem in der Unterscheidung von Kombattanten und Nichtkombattanten. Das Recht zur Gewalt bzw. zum Krieg als seiner »äußeren« Form begründete damit die Politik als eigene Sphäre, grenzte sie ab vom Handeln jener, die dazu kein Recht besaßen. Politik und Gewalt blieben im Arkanbereich der Herren, während der soziale, kommunikative Bereich einer sein sollte, in dem es keine Gewalt gab, ein Bereich der Nichtkombattanten und der Untertanen. In ihm war die Herrschaft als Autorität vorhanden, die durch ihr – sakral sanktioniertes – Ansehen, aber auch durch den fallweisen Einsatz von Gewalt, den Frieden wahrte.
In den Berufskriegern der Antike kristallisiert sich die eigentümliche Macht des Militärischen als Gemeinschaft im Zeichen der Gewalt. Kompaktheit, Hierarchie, anonyme Tötungsbereitschaft verbinden sich mit der Legalität, d.h. dem »positiven«, rechtlichen Vorhandensein von Herrschaft. Die Legalität erst lässt die kriegerische Gewalt regelbar werden, weil die Herrschaft ohne Regeln jede Kontrolle verlieren würde. Die Regelung der Gewalt gegen den Feind, das Kriegsrecht, ist damit lediglich die Fortsetzung jeder Regeldisziplinierung der Soldaten. Der Drill als Mechanisierung der Regelhaftigkeit entpersonalisiert das Bewusstsein wie die Körperbewegungen. Sein Ziel ist die vollständige Anonymisierung der kriegerischen Gewalt und ihres Vollzugs, von den Legionen Sullas bis zu den Bomberpiloten des 20. Jahrhunderts. Diese Anonymisierung entspricht der Logik kriegerischer Gewalt. Technisierung und Ideologisierung totalisieren ihren Zweck, die Vernichtung des Gegners.
Die Technisierung der Gewalt zieht jene lange Linie aus, wie sie für die menschliche Gewalt kennzeichnend ist, für das menschliche Handeln überhaupt. Der erste Steinwurf, der erste Wurf einer Lanze, das erste Verschießen von Pfeilen realisieren die Waffe in ihren beiden Momenten, als Artefakt und als Energie. Der Mensch macht sich zum Menschen durch das Herstellen von Artefakten und er realisiert seine spezifisch menschliche Gewalttätigkeit durch die Waffe.17 Mit ihr verschafft er sich eine Zerstörungskapazität, welche radikal die beschränkten Möglichkeiten seiner Hände und Beine übersteigt. In jeder Waffe ist bereits eine Tötungsentscheidung enthalten, anders als in den »kampffähigen« Organen des Menschen. Die – wohl aus diesem Grund – fehlende Tötungshemmung anderen Menschen gegenüber wird durch das Vorhandensein der Waffe freigesetzt. Die Waffe ermöglicht das leichte Töten und die Energie der Fernwaffe fügt noch eine weitere Radikalität hinzu. Je entfernter der Gegner, desto einfacher seine Vernichtung, vorausgesetzt, man verfügt über ein Verfahren des Entfernungstötens. Die technisch vervielfachte Energie des Geschosses beginnt in der Verbindung von gespannter Bogensehne und Pfeil, eskaliert in der Verbindung von expandierendem Pulvergas und Kugel, eskaliert in der Verbindung von Flüssigtreibstoff, Rakete und Sprengkopf.18 Der Schritt von der Muskelenergie zur chemisch gespeicherten Energie bildet die Wendephase. Die Energie radikalisiert die Anonymität des Tötens, doch diese vollendet sich erst, wenn der zweite Effekt der Fernwaffen absolut geworden ist, der Effekt der Masse neben dem der Entfernung. Pfeile wie Gewehre wirken am besten massenhaft gegen Massen, was das Maschinengewehr zum Zielpunkt solcher Waffen hat werden lassen. Aber sie wirken auf immer noch sichtbare Körper. Mit den Kollektivwaffen des 20. Jahrhunderts, buchstabiert nach dem A (atomar), B (biologisch), C (chemisch), verschwinden auch die Körper aus dem entfernten Gesichtsfeld des Soldaten.19 Die Totalisierung der Vernichtungsgewalt ist daher das konsequente Ergebnis einer Totalisierung der Technologie, wie sie sich aus der Verwissenschaftlichung der Technik entwickelt hat. Der Krieg kann nun bis zur Vernichtung nicht nur des menschlichen Lebens, sondern auch der Möglichkeit solchen Lebens auf Erden geführt werden. Die amerikanische Atombombe von Hiroshima (1945), die sie an Sprengkraft 3500-mal übertreffende sowjetische Wasserstoffbombe (1961) formulierten eine Rationalität der Vernichtung in Begriffen, der keine Tragik mehr gewachsen ist. Der Tod im Krieg des 20. Jahrhunderts richtet sich gegen den Feind als Kollektiv, bei dem zwischen Zivilisten und Soldaten nicht länger unterschieden wird, so wenig wie zwischen Front und Hinterland. Die Vernichtung ist umfassend geworden. Sie erfasst Städte, Wohnhäuser, Kulturobjekte ebenso wie natürliche Lebensräume, Wälder, Felder, Tiere. Sie verbrennt, vergast, verstrahlt, was irgendwie dem Kollektiv des Feindes zugehört. Der Tod hat Zeit, das Töten nicht. In der »totalen Umgebung« des Kampfgeschehens werden die Soldaten wie zu »Schlafwandlern« der Gewalt.20 »Erwachen« sie, durch den Schock einer Verwundung, einer individuell erlebten Todesgefahr, droht der seelische Zusammenbruch. Moderne Armeen haben deutlich höhere Verluste durch psychische Schäden, durch »Kriegszittern«, als durch physische. In vormodernen Gesellschaften bemühte man sich, die in ihrer Seele verstörten Kämpfer durch religiös überformte Zeremonien zu beruhigen. In den modernen tritt die Psychiatrie an deren Stelle, die Behandlung einer materiell aufgefassten Psyche analog einem materiellen Organ durch Chirurgie.
Die Helden sind andere, eher wenige, und ihr Gewalthandeln geht nicht aus der Apathie hervor, sondern aus einer Art von Autismus, aus einer »kindischen« Vorstellung eigener Unverletzbarkeit, Unsterblichkeit, die sich bis zur Besessenheit steigern kann.21 Der »Held« wie der »Feigling« besitzen gleichermaßen keine kollektive Beziehung. Beiden sind die Mitkämpfer gleichgültig, ihr Leben wie ihr Sterben. Aber während der Held durch seine scheinbare Todeslosigkeit, d.h. seinen Mut, den Zweck der militärischen Gemeinschaft erfüllt, verneint der Feigling diesen Zweck und erinnert sie ständig an Verderben und Tod.
Wenn das Wesen des Krieges die Bedingungslosigkeit ist, die Verneinung der schieren Daseinsbedingung des Lebens, so ist es das Wesen der Politik, Bedingungen aufzustellen. Indem sie dem Krieg Bedingungen stellt, versucht sie, ihn »politisch« zu machen. Das Kriegsvölkerrecht ist der Versuch, der Tendenz kriegerischer Gewalt zu wehren, sich absolut zu setzen.22 Entscheidend wird dabei so etwas wie die Teilbarkeit des Feindes. Er ist dann weder der Feind »des Menschengeschlechts«, noch sind alle, die dem Feind zugehören, selber Feinde. Die Teilung des Feindes erst lässt Regelungen der kriegerischen Gewaltausübung zu, ermöglicht Verhandlungen und einen Frieden im »Dazwischen« der Politik, zwischen bedingungslosem Sieg und bedingungsloser Niederlage. Antike, insbesondere römische Versuche der Verrechtlichung, dann die Gottesfriedensbewegung des Mittelalters sind Bemühungen auf dem langen Weg zum Kriegsvölkerrecht, wie es seit dem 17. Jahrhundert intellektuelle und vertragliche Gestalt gewann und bereits im zwanzigsten wieder kollabierte, weil man weder die Teilbarkeit des Feindes anerkennen wollte noch das daraus folgende Prinzip, dass Rechtsgrundsätze für alle gelten, wenn sie denn als allverbindlich deklariert worden sind. Hier nimmt die kriegerische Gewalt zunehmend Züge der eliminatorischen an, die im Massaker kulminiert.23