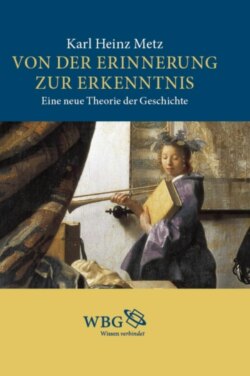Читать книгу Von der Erinnerung zur Erkenntnis - Karl Heinz Metz - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kritik
ОглавлениеDas historische Denken geht in zwei Richtungen: in die Tiefe der Zeit und in die Tiefe der Existenz. Die durch soziales Handeln gefüllte Zeit ist das, was allem Geschehen Ort und Bedeutung, »Kontext« zuweist. Die Existenz ist das, was jeden Menschen als Einzelnen aus allen Kontexten reißt und ihn im Bogen von Geburt und Tod Einzigartigkeit als radikale Endlichkeit zuweist. Aus den Tiefen der Existenz sucht der Mensch, wenn er davon nur ein Bewusstsein hat, zu entfliehen, indem er sich einem Ewigen, Göttlichen zuwendet oder indem er sich durch sein Tun in die Zeit einzuschreiben sucht, als einen, den man nie vergessen kann. Das Ringen um Erinnerung ist ein Verzweiflungsschrei der Existenz gegen die alles verschlingende Zeit, denn weil der Mensch der Zeit verfällt, sobald er mit dem Besitz der Erinnerung davon eine Vorstellung gewonnen hat, wird ihm die Überwindung der Zeit zum kulturschaffenden Bedürfnis. Das babylonische Gilgamesch-Epos (Beginn 1. Jahrtausend v. Chr.) etwa berichtet vom verzweifelten Streben des Helden, den Tod zu überwinden, das in der Einsicht endet, so etwas wie Unsterblichkeit sei nur unter Menschen erreichbar, die ihre Sterblichkeit in der Abfolge von Generationen weiterreichen, sie auf diese Weise überwinden. Indem er eine Mauer um seine Stadt baut, Kultur von Natur, Friede von Krieg abgrenzt, wird Gilgamesch zum Schöpfer unter den Sterblichen, in deren Erinnerung er fortlebt. Die ganze Kultur ist in ihren »überflüssigen« Symbolen, d.h. in ihren nicht materiell lebensnotwendigen, doch immateriell bewusstseinsnotwendigen Riten und Artefakten, ein unentwegter Versuch, die Tiefe der Existenz in Zeichen zu verwandeln, sie in ihnen zu bannen. Die Faszination der Erinnerung liegt in ihrer Fähigkeit, Existenz als Dauer erscheinen zu lassen. Ihre Wirklichkeit besteht im Akt des Erinnerns, nicht in der Richtigkeit des Erinnerten. Eben hierauf jedoch zielt die Kritik mit ihrer Auflösung der Erinnerung in drei Bedeutungsfelder, also in ein chronologisch-narratives, ein strukturell-generalisierendes, ein existenziell-philosophisches. Das moderne europäische Denken, wie es sich seit dem 18. Jahrhundert ausbildet, ist damit ein historisches, weil ihm die Elemente des vorherigen, eben Dauer und Ewigkeit, zerbrochen waren, weil die »Zeit« als rasende Folge von Neuerungen eine neue Art des Denkens erzwang. Dazu wird alles, was aus der Vergangenheit überkommen ist, als Überrest aufgefasst, d.h. als Bruchstücke von Vergangenem, die der Überprüfung auf wahr oder falsch bedürfen und deren Zusammenhang erst im Nachhinein erkannt werden kann. Die im Nachhinein erscheinende Zeitlinie aus Ereignissen wäre dann nur das Ergebnis eines Versuchshandelns im sozialen Raum eines vielfältig – auch anders – Möglichen, die der Historiker nachzeichnet. Es gibt keine eindeutigen Ursprünge, lediglich ein Netzwerk, dessen Ereignisknoten nicht vorhersagbar sind. Ereignisfolgen verändern diese Handlungsräume wie deren Wahrnehmung, sie determinieren aber nicht das weitere Handeln. Indem der Historiker sich bemüht, die Handelnden vergangener Epochen zu »verstehen«, ihre Wahrnehmung einer Situation so zu begreifen, wie sie es selber taten, versucht er, offene Erklärungen zu bilden. Es ist dies die Absage an jedes absolute Wissen und ein Bekenntnis zur Relativität. Es ist zugleich eine Art von hippokratischem Eid des Historikers, nämlich zu sagen, was gewesen ist, alles, ohne Rücksicht darauf, ob es unter den vorherrschenden Machtverhältnissen erwünscht oder unerwünscht sein mag. Denn nirgends ist die Moral schneidender, die Erkenntnis größer als da, wo man sich um Objektivität bemüht, d.h. auch das sagt, was man verschweigen sollte. Ein Geschichtsschreiber, insbesondere einer der Zeitgeschichte seiner Nation, der bei seiner Tätigkeit keinen Schmerz verspürt, nur Triumph und die Selbstgewissheit einer siegreichen Gegenwart, hat von Geschichte nichts verstanden. Das gilt für jede Nation und jede Epoche. Daher muss das Falsifikationskriterium, d.h. die Auseinandersetzung mit Fakten und Interpretationen, die der eigenen Konzeption widersprechen, durch ein Resistenzkriterium ergänzt werden, d.h. die Skepsis gegen das, was jeweils als politisch erwünscht, als »korrekt« angesehen wird. In der Suche nach Strukturen, nach Zusammenhängen über die Zeitenfolge hinaus, wird die Relativität ein Stück weit eingeschränkt. Hier wird eine andere Ordnungsform der kritischen Historie erkennbar. Strukturen sind das Ergebnis von Definitionen, nach denen Daten ausgewählt und in Beziehung gesetzt werden. Mit ihnen will man Zusammenhänge darstellbar machen, die über zeitliche Kontexte hinausreichen, die mehrfach auftreten, den Vergleich ermöglichen und erfordern. Strukturen ergeben sich demnach aus einem »idealisierenden« Vergleich, dessen Ergebnis eine »reine« Theorie des Zusammenhangs unter Abgrenzung des jeweils historisch Unvergleichbaren ist. Das Phänomen des politischen Terrors etwa entsteht mit der Französischen Revolution und bildet sich zur Struktur totaler Herrschaft, also einer Herrschaft, die auf die Herstellung eines »neuen Menschen« zielt und zwischen Freund und Feind nichts Weiteres kennen will. Die Ideologie ist damit die Bewusstseins- und Rechtfertigungsform des Terrors. Eine solche Struktur kann formuliert und auf andere, ähnliche Phänomene übertragen werden. In ihrer »reinen«, verallgemeinerten Gestalt kann sie als Modell des Verhältnisses von absolutem Wahrheitsanspruch und Bereitschaft zu absoluter Gewalt dienen.
Geschichte wird hier Theorie. Sie verwirklicht sich damit in ihrem kritischen Ansatz als vollendete Reflexion mit prognostischem Potenzial. Als Theorie der Revolution z.B. verweist sie darauf, dass diese »als ganze« Revolution dort siegreich wird, wo sie terroristisch geworden ist, bzw. da »eine halbe« bleibt, wo sie das nicht wurde. Sie verweist ebenso darauf, dass »ganze«, terroristische Revolutionen unfähig werden, selbsttragende politische Strukturen auszubilden, sie also nur so lange Bestand haben, solange sie Furcht erregen. Gewaltregime besitzen keine Spielräume für Abweichler, weshalb auch kleine Störungen rasch zu großen werden. Eine solche modellhaft gewonnene Struktur kann an einem bestimmten »Knotenpunkt« des soziokulturellen Netzwerkes angesetzt werden, sei es historiografisch als Erklärung, sei es als hypothetische Prognose, denn die letzte Unwägbarkeit menschlichen Handelns in Gesellschaft ist nie völlig zu beseitigen. Man kann sich Geschichte bzw. geschichtliche Abläufe als ein komplexes Netzwerk vorstellen, das nicht linear funktioniert, weil es keine völlig gleichbleibenden Ursachen, Handlungsbedingungen gibt, vielmehr diese steten Änderungen unterworfen bleiben. Denn die Ergebnisse von Handlungen wirken auf die Ursachen bzw. die Bewusstseinsumstände für weiteres Handeln zurück. Zudem handeln viele, sehr viele und auch ihre Handlungen wirken auf die Wahrnehmungen der anderen ein. Eine komplexe Wechselwirkung der Handlungen ist die Folge, d.h. diese Wechselwirkungen sind nicht linear, nicht genau vorhersagbar, nicht strikt kausal fassbar. Das Unvermögen der Historie, eine »strenge«, exakte Wissenschaft zu werden, hat daher nicht mit einem methodologischen Unvermögen zu tun, das überwindbar wäre. Es hat mit der Fragilität, Instabilität ihres Forschungsgegenstandes selbst zu tun als eines von Wechselwirkungen durchzogenen Gebildes nichtlinearer Beziehungen, in denen die Handlungsbedingungen unvorhersehbar veränderlich bleiben. Geschichtsgesetze wären also nur denkbar, wenn sich entweder die historischen Abläufe ständig wiederholen würden oder sich eine deterministische Abfolge von Entwicklungsstufen nachweisen ließe. In beiden Fällen wäre die Entstehung eines wirklich Neuen unmöglich, sofern darunter etwas zu verstehen ist, das im Vorhinein unbekannt war. Diese Annahme ist offenkundig unzutreffend, sei es logisch (Karl Raimund Popper), sei es empirisch. Alle großen Voraussagen, zyklische wie teleologische, haben lediglich den Bewusstseinszustand ihrer jeweiligen Gegenwart in die Zukunft übertragen, um dann aus der behaupteten Alternativlosigkeit ein entsprechendes Handeln im Hier zu erzwingen. Lineare Gesetzeskonstruktionen scheitern daher in ihren Bemühungen, die Geschichte zu erklären. Und wenn man politische Deduktionen daraus zu ziehen versucht, führt das unweigerlich in die Katastrophe, wie die bedeutendste dieser Konstruktionen, der marxistische Kommunismus, das exemplarisch gezeigt hat.
Was bleibt ist eine prozesshafte, multikausale Auffassung von Geschichte und die daraus folgende Bereitschaft, mit der Ungewissheit zu leben. Das ist das Gegenteil einer linearen, Kontinuität behauptenden Erinnerung wie ihrer intellektuellen Abbilder, die der Gegenwart den Befehl entgegenstellen. Eine Historie der letzten Ungewissheit blieb unannehmbar. Der auf Leopold Ranke zurückgehende Historismus1 nun formuliert eben diese als Zirkelbewegung historiografischen Verstehens, die im Prinzip unendlich ist und stets nur Näherungswissen, nie Absolutheit erbringt, und zwar nicht einfach deshalb, weil der Historiker in der immer bruchstückhaften Überlieferung des Vergangenen mit seinen Interpretationen Lücken schließt, von denen er kein faktisches Wissen besitzt, sondern mehr noch deshalb, weil er selbst im Netzwerk der Wechselwirkungen verstrickt bleibt, weil er den Ausgang vergangener Handlungen kennt, deren Interpretationen durch andere, weil er selbst Zeitgenosse ist, beeinflusst durch seine Gesellschaft. Der »verstehende« Ansatz des Historismus versucht deshalb eine doppelte Relativierung zu erreichen, indem er den Einfluss der eigenen Zeitgenossenschaft wie ihrer Werturteile zu vermindern sucht und zum anderen das Vergangene in seinen Handlungen und Werturteilen aus sich selbst heraus erfassen will. Auf diese Weise soll das Nichtlineare, Verschlungene, Netzwerkartige vergangener Geschehnisse zur Darstellung gebracht werden. Die klassische Relation von Subjekt und Objekt kann es damit nicht geben, denn das Objekt ist nichts, das in seinem So-Sein erkannt wird, es erhält seine bestimmte Gestalt erst durch den Vorgang des Erkennens, allerdings weder beliebig noch endgültig. Denn das zu Erkennende besitzt sowohl Faktizität wie Struktur, sonst wäre es nicht vorhanden. Da jedoch seine je erkannte Konkretheit stets vom geistigen »Import« des Erkenntnisinteresses abhängt, das selbst individuell wie epochal gebunden bleibt, ist auch eine Endgültigkeit des Erkennens unerreichbar. Eine solche Geschichtsschreibung rechtfertigt sich vor der Gegenwart dadurch, dass sie ihr von der Vielfalt des Menschseins berichtet, auch davon, was vor der Gegenwart war und in sie eingegangen, was verschwunden, fremd geworden ist. Ihr Bestehen auf der Individualität, Einzigartigkeit früherer Handlungen, Institutionen, Geschehnisse trübt ihr allerdings den Blick für Strukturen, d.h. Zusammenhänge, die mehrfach auftreten und in allgemeinen Begriffen fassbar sind. Dass man solche Zusammenhänge nur als Gesetze des strikt kausalen Typs zu fassen suchte und dabei scheiterte,2 hat die Beschäftigung mit ihnen »auf mittlerer Ebene« erschwert. Solche Strukturen bilden gewissermaßen flexible Argumentationsmuster, in denen man wie auf einer Treppe nach »oben« zu immer weiterer Verallgemeinerung oder nach »unten« zu immer dichterer Beschreibung fortschreiten kann, die in Historiografie endet. Bei allen jedoch handelt es sich um Modelle von dynamischen Netzwerken und eben nicht um Ein-Faktor-Lehren. Sie ermöglichen es, Geschichte und Theorie in Zusammenhang zu bringen und damit die Historie als kritisch-analytische Denktätigkeit zu Ende zu führen, d.h. von der philologischen Kritik der Überlieferung zur intellektuellen Rekonstruktion größerer Zusammenhänge vorzudringen.
Der Historiker gleicht einem Wanderer, der sich zwischen unzähligen Verzweigungen einen Weg sucht. Dabei muss er ständig entscheiden, welcher er jeweils nachgehen will. Was dabei entsteht, ist ein Text, als »Historie«, ist eine Folge von Verzweigungsentscheidungen, die als solche kaum merkbar sind, überdeckt von einer starken Kontinuität, in der die Logik der Zeitenfolge und die Logik der Interpretation sich wechselseitig verstärken und den Eindruck eines Unabdingbaren, Alternativlosen entstehen lassen. Der Historiker konstruiert mit seiner Darstellung, d.h. einer Selektion der Daten bzw. Geschehnisse entsprechend seiner Fragestellung, eine starke Linie durch das Netzwerk sich verzweigender Geschehnisse und Abläufe. Dass menschliches Handeln stets in einem Möglichkeitsraum sich ereignet, gerät dabei weitgehend aus dem Blick. Nimmt man Geschichte als mehrdimensionales Gebilde wahr, in dem sich ganz unterschiedliche Entwicklungslinien erkennen lassen, mit eigenen Zeitverläufen, die gleichwohl in unterschiedlich starken Wechselwirkungen zueinander stehen, wird der übliche chronologische Reduktionismus der Geschichtsschreibung problematisch. Der Laplace’sche Dämon verschwindet und es gibt auch keinen eschatologischen Sturm, der den Engel der Geschichte in die Zukunft treibt. Der Mensch ist mit seiner Verantwortung so allein wie der Historiker mit seinen Wegentscheidungen. Eine Theorie der Geschichte schreiben zu wollen, ist daher nur möglich unter der Voraussetzung ihrer Unvollständigkeit. Sie bleibt so vollständig und unvollständig zugleich wie die Festlegung der Küstenlinie Großbritanniens (Benoît Mandelbrot), deren Länge von einer Genauigkeit der Messung abhängt, die letztlich ins Unendliche geht. In vergleichbarer Weise wird eine Theorie möglich, wenn man die Voraussetzungen anerkennt, von denen her sie konzipiert wird. Sie ist der Versuch, die Wirklichkeit auf Begriffe zu bringen, nicht auf »den Begriff«, d.h. sie bemüht sich um einen argumentativen Durchgang, ohne die Verzweigungen zu unterschlagen, an denen sie vorbeigeht. Sie definiert Faktoren des historischen Prozesses als Begriffe, Begriffskonstrukte und fragt nach ihrem Zusammenhang im Netzwerk dieses Prozesses. Sie ist damit offener, bescheidener als die totalen Geschichtslehren früherer Zeiten, die »alles« erklären wollten, und zwar »für immer«, und sie ist nicht schlechter als andere Theorien der Sozialwissenschaften, die alle auf ewig dem Newton’schen Paradox verhaftet bleiben, dem zufolge – wie bei einer sich ausdehnenden Kreisfläche – der Umfang des Nichtwissens in dem Maße wächst, in welchem der Inhalt des Wissens zunimmt.
Damit ist die Tiefe der Zeit als Aufgabe des Denkens angenommen, die Tiefe der Existenz, in der alle Zeit gründet, nicht. Die historische Grundfrage: »Warum gibt es Geschichte und nicht einfach nur Leben?«, verweist auf die Anthropologie. Die historiografische Grundfrage: »Warum machen die Menschen ihre Geschichte nicht aus freien Stücken, wenn sie diese doch selbst machen?«, also warum gelingt es den Menschen nicht, ihre selbst gemachte Geschichte der Gewalt, Unterdrückung, Feindschaft hinter sich zu lassen und in eine friedlich-freundliche Nachgeschichte einzutreten: Diese Frage kann die Historie selbst beantworten. Es ist letztlich das nicht angenommene Newton’sche Paradox, die Weigerung zur Weitung des Wissens und der Anerkennung eines zunehmenden Nichtwissens, in dem sich Handeln und Demut verbinden.
Menschengeschichte besteht aus Menschengeschichten. In der »großen« Geschichte der Ereignisse, gar der Strukturen, sind zahllose kleine Geschichten, wie die allerletzten Verzweigungen des historischen Wegeraums, deren riesenhafte, meist anonyme Menge doch erst den »Stoff« der Geschehnisse ausmacht. Es sind Augenblicke, die an das Zeichenhafte des menschlichen Daseins rühren, Augenblicke, die zu einem Ereignis »in der Seele«, im Bewusstsein werden. Der Hund des Deserteurs Notter, der vor Verzweiflung heulend seinem Herrn auf dem Schafott beistehen will (24.6.1794), der müde Gang des Militärarztes Carossa vom rumänischen Totenberg herab (16.11.1916) oder auch nur jene Zärtlichkeit der Armut auf einem Bild des Adriaen van Ostade (1653), einer holländischen Bauernfamilie mit ihrem bescheidenen Essen: All das sind Minimalgeschichten, die den Schein des Ganzen, der historiografischen Kontinuität für einen Augen-Blick zerreißen und ohne die es keine historische Wirklichkeit geben kann. Denn diese gibt es erst da, wo der historiografische Blick »zur Wurzel« vordringt, und diese Wurzel ist der Mensch in seinem Körper, der isst und hungert, hasst und liebt, friert, zittert, stirbt. Jede Religion, jede Dichtung weiß das. Die Geschichtsschreibung weiß es nicht. Sie bedarf der »anekdotischen« Erinnerung, um sich nicht zu verlieren.3
Das Besondere, Einzigartige der kritischen Historie besteht darin, dass sie sowohl ihr Entstehen wie ihr Verschwinden denken kann. Kein anderes Denken vermag das. Geschichtsschreibung wäre dann der Versuch, den Toten in ihrer Gegenwart zu begegnen, nicht in unserer, in ihrer Fremdheit, nicht in jener Eindeutigkeit, die ihnen das Moralurteil des Hier und Heute zuweist: Wenn man durch die Geschichte geht, geht man durch Wüsten. Aber es gibt Oasen. Wenn die Geschichtsschreibung einen »Sinn« hat, dann den, jedem Menschen, jeder Generation zu sagen, dass sie weder die Ersten noch die Letzten sind. Verantwortung ist das, was dazwischen liegt, zwischen einer Zeit, in der »wir« noch nicht vorhanden waren, und einer Zeit, in der wir nicht mehr vorhanden sein werden.