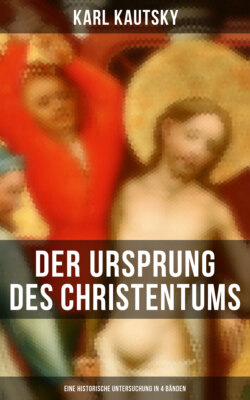Читать книгу Der Ursprung des Christentums (Eine historische Untersuchung in 4 Bänden) - Karl Kautsky - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
c. Der römische Staat
ОглавлениеAlle diese, jede aufblühende Handelsstadt des Altertums kennzeichnenden Kämpfe finden wir in Rom in vollem Gange, zu der Zeit, wo es in der Geschichte auftaucht.
Seine Lage macht es zu einem sehr geeigneten Stapelplatz. Es liegt ziemlich entfernt von der Meeresküste am Tiber, aber das bildete damals, bei der Kleinheit der Seefahrzeuge, kein Hindernis für den Seehandel, es war sogar ein Vorzug, da man tiefer im Lande drin vor Seeräubern und Wogengang geschützter war als an der Seeküste. Nicht umsonst sind so viele der großen älteren Handelsstädte nicht direkt am Meere, sondern an schiffbaren Flüssen ziemlich weit von deren Mündung gelegen – so Babylon und Bagdad, London und Paris, Antwerpen und Hamburg.
Die Stadt Rom bildete sich an einem Platz, wo an den noch schiffbaren Tiber zwei leicht zu befestigende Hügel herantreten, die den Magazinen für die aus- und einzuschiffenden Waren Schutz und Sicherheit gewährten. Die Landschaft, in der Rom entstand, war noch roh, rein bäuerlich, aber nördlich und südlich von ihr lagen ökonomisch hochentwickelte Landschaften, Etrurien und Kampanien, mit starker Industrie, ausgedehntem Handel und auch schon einer auf unfreier Arbeit beruhenden Landwirtschaft. Und von Afrika her kamen mit ihren Waren die Karthager, die auf gleicher Höhe der Entwicklung standen wie die Etrusker und die griechischen Kolonien in Süditalien.
Diese geographische Lage versetzte Rom in eine eigenartige Doppelstellung. Ihrer nächsten Umgebung, den Latinern und Volskern gegenüber, erschien die Handelsstadt als der Vertreter einer höheren Kultur; der weiteren Umgebung, den Etruskern und italischen Griechen gegenüber, traten dagegen die Römer als rohes Bauernvolk auf. In der Tat blieb die Landwirtschaft für die Römer der Haupterwerbszweig, trotz aller Zunahme des Handels. Vom Meere entfernt, verstanden sie nichts von Seefahrt und Schiffbau. Sie überließen es fremden Kaufleuten und Schiffern, zu ihnen zu kommen und ihren Handel zu treiben. Und das änderte sich nicht. Dadurch erklärt es sich teilweise, Warum zur Zeit Cäsars und seiner ersten Nachfolger, also zur Zeit der Entstehung des Christentums, die Juden eine so starke Kolonie in Rom bildeten. Sie hatten damals einen Teil des römischen Handels an sich gebracht. So liegt ja auch heute noch zum Beispiel in Konstantinopel der Handel vornehmlich in den Händen von Nichttürken.
Je mehr Rom durch seinen Handel aufblühte, desto mehr kam es in Konflikt mit seinen Nachbarn. Der Markt für Lebensmittel, den der Handel erschloß, erzeugte in den römischen Grundbesitzern den Drang, ihren Grundbesitz auf Kosten ihrer Nachbarn zu erweitern, indes diese wieder nach dem Reichtum der Stadt lüstern wurden. Andererseits entbrannten nun Konkurrenzkämpfe mit den etruskischen Städten. Es waren zahlreiche lange und harte Kriege, die das junge Gemeinwesen zu bestehen hatte, aber siegreich ging es aus ihnen hervor, dank seiner oben schon angedeuteten Doppelstellung. Über die Bauern siegte die höhere Technik und die geschlossene Organisation der großen Stadt; über die Etrusker wieder, die schon infolge der Verdrängung der freien Bauernschaft durch Zwangsarbeit an militärischer Kraft verloren hatten, siegte die Zähigkeit und Ausdauer der römischen Bauern.
Sobald aber Rom stark genug geworden war, mit den Etruskern fertig zu werden, erfuhr es dabei, welch vortreffliches Geschäft der Krieg werden könne. Weit mehr Reichtum als durch den Handel, den doch meist Ausländer trieben, und durch die Landwirtschaft, die bei kleinbäuerlichem Betrieb nur geringe Überschüsse im Jahre abwarf, war durch glückliche Kriege zu gewinnen, wenn sie gegen reiche Städte und Nationen geführt wurden, die man plündern und tributpflichtig machen konnte. Handel und Raub sind von Anfang an miteinander verwandt, aber wohl keine Handelsstadt hat so sehr das Räuberhandwerk in den Vordergrund gestellt und zu einer staatlichen Einrichtung, ja zur Grundlage der Größe der Stadt erhoben, so sehr alle staatlichen Institutionen darauf eingerichtet, wie Rom. Sobald es die etruskischen Städte erobert, geplündert und sich zinsbar gemacht hatte, wendete es sich gegen seine reichen Nachbarn im Süden, deren wachsender Reichtum ein Schwinden ihrer militärischen Kraft aus den schon öfter hier auseinandergesetzten Gründen mit sich gebracht hatte, so daß die Beute in demselben Maße begehrenswerter war, wie sie leichter zu gewinnen schien. Aber dieser Reichtum lockte gleichzeitig ein anderes Bauernvolk, die Samniten. Diese mußten erst aus dem Felde geschlagen sein, ehe man sich der griechischen Städte in Süditalien bemächtigen konnte. Bauernvolk rang gegen Bauernvolk, aber die Samniten hatten keine große Stadt, wie Rom, in ihrer Mitte, die den bäuerlichen Streitkräften eine zentralisierte Organisation gegeben hätte. So unterlagen sie, und damit war für Rom der Weg nach den reichen Städten Süditaliens offen, die nun geplündert und unterjocht wurden.
Von Süditalien war dann nur noch ein Schritt nach Sizilien, das, nicht minder reich wie das griechische Italien, die römischen Raubscharen ebensosehr anlockte. Da aber stießen sie auf einen gefährlichen Feind, die Karthager. Karthago, eine mächtige Handelsstadt in der Nähe des heutigen Tripolis, hatte, von dem gleichen Räuberdrang wie Rom ergriffen, sich die westliche Nordküste Afrikas und Spanien unterworfen und versuchte jetzt das gleiche mit Sizilien. Es war eine Kolonie der Phönizier, die durch die Beschaffenheit ihres Landes frühzeitig zur Seefahrt gedrängt worden waren und auf dem Gebiet der Seefahrt ihre große Überlegenheit erlangt hatten. Auch Karthago erlangte seine Größe und seinen Reichtum durch die Seefahrt. Es bildete Seefahrer, nicht Bauern. An Stelle der Bauernwirtschaft entwickelte es die Latifundienwirtschaft mit billigen, erbeuteten Sklaven und daneben den Bergbau. Es fehlte ihm daher an einem bäuerlichen Volksheer. Sobald es gezwungen wurde, von der Küste ins Innere des Landes vorzuschreiten, um seine Eroberungen festzuhalten, und eine Kriegsmacht zu Lande zu entfalten, mußte es zur Anwerbung von Söldnern greifen.
Das Ringen zwischen Rom und Karthago, die drei sogenannten Punischen Kriege, begann 264 v. Chr. und endete erst 146 völlig mit der Zerstörung Karthagos. Entschieden war es freilich schon nach der Niederwerfung Hannibals, die 201 zur Beendigung des zweiten Punischen Krieges führte. Diese Kämpfe wurden Kriege zwischen Söldnerheeren und Bauernheeren, zwischen dem Berufsheer und der Milizarmee. Oft siegte das erstere, es brachte Rom unter Hannibal dem Untergang nahe, aber das Milizheer, das den eigenen Herd verteidigte, erwies sich schließlich doch als ausdauernder und es zwang am Ende des furchtbaren Ringens den Gegner völlig nieder. Karthago wurde dem Erdboden gleich gemacht, seine Einwohnerschaft vertilgt. Sein ungeheurer Besitz an Latifundien, Bergwerken, unterjochten Städten, fiel als Beute dem Sieger anheim.
Damit war der gefährlichste Gegner Roms gefallen. Von nun an herrschte es unumschränkt im westlichen Becken des Mittelmeers. Und bald auch im östlichen Becken. Dessen Staaten waren auf dem Leidenswege der alten Kultur, der Verdrängung der freien Bauern durch Zwangsarbeit von Sklaven oder von Fronbauern und ihrer Ruinierung durch ewige Kriege, endlich der Ersetzung der Milizen durch Söldner, schon so weit vorgeschritten und militärisch geschwächt, daß sie den Heeren Roms keinen nennenswerten Widerstand mehr leisten konnten. Mit leichter Mühe warfen die römischen Heere eine Stadt nach der anderen, ein Land nach dem anderen nieder, um sie zu plündern und zu ständiger Zinsbarkeit zu verurteilen. Von nun an blieb Rom die Herrin der alten Kulturwelt, bis es den germanischen Barbaren gelang, ihm dasselbe Schicksal zu bereiten, das es selbst den Griechen bereitet hatte, trotzdem diese wissenschaftlich und künstlerisch hoch über ihm standen. Wie in der Ökonomie und Politik blieb Rom den Griechen gegenüber auch in Philosophie und Kunst stets nur der Plünderer. Seine großen Denker und Dichter waren fast durchgehends Plagiatoren.
Die reichsten Länder der damaligen Welt, in denen unzählige Schätze einer Jahrhunderte, ja, wie in Ägypten, Jahrtausende alten Kultur aufgestapelt waren, wurden der Plünderung und Erpressung durch Rom eröffnet.
Den enormen kriegerischen Kraftaufwand, der dieses glänzende Resultat zeitigte, hatte Rom aber nur entfalten können als Demokratie, als eine Stadt, an deren Existenz alle Klassen ihrer Bevölkerung, wenn auch nicht alle in gleicher Weise, interessiert waren. In langem und zähem Ringen vom sechsten bis zum vierten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung hatten die Neubürger, die Plebejer, den Altbürgern, den Patriziern, ein Vorrecht nach dem anderen zu entreißen gewußt, bis schließlich jeder rechtliche Unterschied der beiden Stände verschwunden war und die Volksversammlung sämtlicher Bürger über die Gesetze zu entscheiden und die höchsten Beamten, die Konsuln, Prätoren, Ädilen, zu wählen hatte, die dann, nach Bekleidung ihres Amtes in den Senat eintraten, der tatsächlich den ganzen Staat regierte.
Aber das römische Volk erlangte damit nicht die Herrschaft im Staate, sondern nur das Recht, sich seine Herren zu wählen. Und je mehr in der Stadt Rom das Lumpenproletariat vorherrschte, desto mehr wurde dies Recht der Demokratie ein Mittel des Erwerbes, ein Mittel, Unterstützungen und Vergnügungen von den Kandidaten zu erpressen.
Wir haben schon die Klienten kennen gelernt, die sich reichen Herren für alle möglichen Dienste zur Verfügung stellten. Besaßen sie das Stimmrecht, dann war unter den Diensten, die sie zu leisten vermochten, keiner wichtiger als die Abstimmung im Sinne des Schutzherrn, des Patrons. Jeder reiche Römer, jede reiche Familie verfügte so über zahlreiche Stimmen in der Gemeindeversammlung, die sie im Interesse der Clique dirigierten, der sie angehörten. Ein paar Cliquen reicher Familien behielten in dieser Weise die Regierung des Staates in der Hand, setzten immer wieder die Wahl ihrer Angehörigen in die höheren Beamtenstellen und damit in den Senat durch. Die Demokratie änderte darin nicht mehr, als daß sie nun auch reichen plebejischen Familien erlaubte, sich in diesen Kreis einzudrängen, der unter dem aristokratischen Regiment auf die Patrizier beschränkt geblieben war.
Die gewählten Konsuln und Prätoren hatten das erste Jahr ihrer Amtstätigkeit in Rom zu verbringen. Im zweiten Jahre übernahm jeder von ihnen die Verwaltung einer Provinz und suchte sich nun dort schadlos zu halten für die Kosten, die ihm die Bewerbung ums Amt verursacht hatte, und darüber hinaus noch einen Gewinn für sich herauszuschlagen. Denn ein Gehalt bezog er nicht. Die Ämter waren „Ehrenämter“. Andererseits war wieder die Aussicht auf den Gewinn, der in der Provinz durch Erpressung und Bestechung, mitunter durch direkten Raub zu holen war, ein Grund, die Bewerbung ums Amt möglichst nachdrücklich zu betreiben, so daß sich dabei die verschiedenen Kandidaten in ihren Leistungen für das Volk immer mehr in die Höhe steigerten.
Je größer aber durch die verschiedenen Methoden des Stimmenkaufs die Aussichten für die Lumpenproletarier wurden, aus dem Verkauf der Bürgerrechte Vorteil zu ziehen, desto mehr mußten sich jene Bauern, die das römische Bürgerrecht besaßen, getrieben fühlen, ihre dürftige und mühevolle, bedrängte Existenz auf dem Lande aufzugeben, um nach Rom zu ziehen. Das vermehrte wieder die Zahl der stimmberechtigten Lumpenproletarier und damit auch die Ansprüche, die an die Kandidaten gestellt wurden. Zur Zeit Cäsars gab es in Rom nicht weniger als 320.000 römische Bürger, die unentgeltlich Brotkorn vom Staate bezogen: ungefähr ebenso groß wird die Zahl der käuflichen Stimmen gewesen sein. Man kann sich denken, welche Summen eine Wahl verschlang.
Im Jahre 53 vor unserer Zeitrechnung verursachte der Stimmenkauf eine solche Nachfrage nach barem Gelde, daß der Kapitalzins stark in die Höhe ging und eine Geldkrisis eintrat.
„Die Nobilität (der Amtsadel) hatte schwer zu zahlen,“ bemerkt Mommsen. „Ein Fechterspiel kostete 720.000 Sesterze (150.000 Mark). Aber sie zahlte es gern, da sie ja damit den unvermögenden Leuten die politische Laufbahn verschloß.“
Und sie hatte sehr oft zu zahlen, denn jedes Jahr gab es neue Wahlen. Aber sie zahlte nicht aus idealem Ehrgeiz, sondern weil sie wußte, daß sie damit nur die Erlaubnis zu der weit einträglicheren Plünderung der Provinzen erkaufte und ein sehr gutes Geschäft dabei machte.
Die „Demokratie“, das heißt die Beherrschung der Bevölkerung des ganzen römischen Reiches mit etwa 50 bis 60 Millionen Einwohnern durch einige Hunderttausende römischer Bürger, wurde so eines der kräftigsten Mittel, die Ausraubung und Aussaugung der Provinzen aufs höchste zu steigern, indem sie die Zahl der Teilhaber daran erheblich vermehrte. und nicht nur die Statthalter taten das Möglichste an Erpressungen, sondern jeder nahm noch einen Schwarm von „Freunden“ mit, die ihm bei der Wahl geholfen hatten und nun auszogen, um dafür unter seinem Schutze zu stehlen und zu rauben.
Aber nicht genug damit, wurde auch das römische Wucherkapital auf die Provinzen losgelassen, wo es Gelegenheit fand, seine ganze vernichtende Macht zu entfalten und zu einer beherrschenden Größe anzuwachsen, die es nirgends sonstwo in der alten Welt erreicht hat.