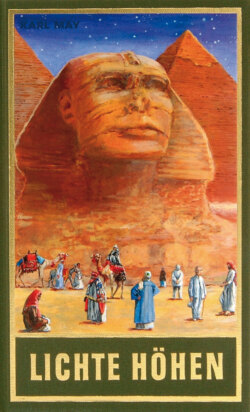Читать книгу Lichte Höhen - Karl May - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Ein Tropfen im All (1932)
ОглавлениеGrüß Gott, du liebes Tröpflein Tau!
Solch einen Schmuck gibt es sonst nimmer:
Von jedem Hälmchen auf der Au
glänzt es wie Diamantenschimmer.
Entstammt der Erde, harrst du froh
dem holden Morgenlicht entgegen,
tränkst deinen Halm und wirst ihm so
nicht nur zur Zierde, auch zum Segen.
Kommt dann aus gold-brokatnem Tor
die Königin des Tags gestiegen,
so strebst du sehnsuchtsvoll empor,
dich ihren Strahlen anzuschmiegen.
Du fühlst, du bist ihr untertan,
du kannst nicht ohne sie bestehen
und wirst gezogen himmelan,
in ihrem Kusse aufzugehen.
Dies kann man nicht als ‚Bearbeitung‘ im eigentlichen Sinne bezeichnen; die Bearbeiter sind mit äußerstem Feingefühl vorgegangen. In den weiteren beiden Strophen beschränken sich ihre Eingriffe sogar auf wenige orthografische und interpunktionale Änderungen, wie nun insgesamt die Rechtschreibung den ab 1901 gültigen Regeln angepasst wurde. Dagegen konnte besonders in der ersten Strophe der sprachliche Ausdruck, im Original etwas holprig, durch kleine Retuschen verbessert werden. Die außerhalb Sachsens eher unverständliche Wendung „Spitzt es wie Diamantenschimmer“ ist geschickt durch das hochdeutsche „glänzt“ ersetzt. Ähnliche Gründe gab es auch für die geplante Änderung des Titels. „Meine Legitimation“ – das klang 1932 wohl zu fremdwortbeladen, zu umständlich, zu gespreizt. „Ein Tropfen im All“ ist in der Tat fast schon der bessere Titel. Dennoch hat sich Roland Schmid, als er 1956 das Gedicht für die endgültige Fassung des Bandes 49 noch einmal vorsichtig überarbeitete, wieder für den alten Titel „Meine Legitimation“ entschieden, weil es in der Tat so etwas wie eine Rechtfertigung ist für das, was dann in den anderen „Himmelsgedanken“ folgt: naive, aber ehrliche Poesie, die sich als Tropfen im All begreift, nicht als Mittelpunkt der Schöpfung. Da Roland Schmid die erste Strophe des Gedichtes 1956 noch einmal etwas verbessert hat (wobei besonders die metrischen Unebenheiten beseitigt worden sind), sei diese Neufassung als ein Beispiel dafür zitiert, dass es den Bearbeitern nicht etwa um den eigenen Ruhm ging, sondern lediglich darum, den kostbaren Rohdiamanten der Mayschen Lyrik durch handwerklich geschickte Eingriffe ‚edler‘ zu fassen:
Grüß Gott, du liebes Tröpflein Tau!
Solch einen Schmuck gibt es wohl nimmer:
Von jedem Hälmchen auf der Au
glänzt es wie Diamantenschimmer.
Entstammst der Erde, harrest froh
dem holden Morgenlicht entgegen,
tränkst deinen Halm und wirst ihm so
nicht nur zur Zierde, auch zum Segen.
Freilich gibt es in der Sammlung „Himmelsgedanken“ auch manches, was durch solch vorsichtige Retuschen nicht ohne Weiteres zu ‚retten‘ war. Auch dafür sei ein Beispiel gegeben: Auf Seite 355f. der „Himmelsgedanken“ von 1900 findet sich das Gedicht „Oberflächlichkeit“. Ohne Zweifel ein tiefbewegendes Poem, von den Gedanken her, aber auch formal durch die Zeile „Denk nicht, das Leben sei ein Spiel!“, die die erste und die letzte Strophe eröffnet und so als Klammer wirkt. Leider sind Karl May in der zweiten Strophe die Metaphern durcheinandergeraten; „Blumenflor“ ist in einem Sumpf kaum vorstellbar und „Kletten“ wachsen nicht auf dem Moor. Die Bearbeiter von 1932 haben denn auch vor diesen Schwächen weitgehend kapituliert. Lediglich in der zweiten Strophe „Nur weil du seinen Blumenflor/Nicht als zum Sumpf gehörig kennst“ wurde eine sinnvolle Veränderung vorgenommen. In der Radebeuler Fassung steht, schon deutlich logischer: „Nur weil du seinen Blumenflor/nicht als ein Sumpfgewächs erkennst.“
In der dritten Strophe dagegen bezeichnet Karl May das Leben als „Rettung vor dem Tod“, was in Hinblick auf die Auferstehung Jesu Christi zu verstehen ist. Hier dürfte die Abwandlung in „ein Ringen mit dem Tod“ nicht ganz im Sinne Karl Mays – zumindest nicht in diesem Zusammenhang – gewesen sein. Aber die Bearbeiter waren selber mit dieser in den Fahnen von 1932 vorliegenden Neufassung nicht zufrieden, wie zahlreiche Randbemerkungen, vermutlich von der Hand Fritz Barthels, zeigen.
Barthel nahm zum Beispiel durchaus verständlichen Anstoß an der Formulierung „und glaubst was wunder zu verlieren“, die dialektal geprägt und wenig poetisch ist. In Barthels Randglosse heißt es wörtlich: „Gemeint ist wunder was, d. h., wer weiß, wie viel – ‚was wunder‘ bedeutet: Es ist kein Wunder. Änderung scheint mir notwendig. Vielleicht: ‚und glaubst wer weiß was zu verlieren‘ oder: ‚ein Großes zu verlieren.‘“ Auch die Zeilen: „wirst du gehalten von den Kletten, so sinkst du ein, musst untergehn“, beanstandete Barthel; sein Änderungsvorschlag: „es schlingt sich um dich wie mit Ketten und du sinkst ein, musst untergehn“, scheint zumindest besser als der holprige und in der Metaphorik ungeschickte Originaltext. Aber es wird auch deutlich, dass die Bearbeiter keine endgültige Lösung für dieses – zugegebenermaßen schwächere – Gedicht gefunden haben. Roland Schmid ließ es daher in der Ausgabe von 1956 weg.
Insgesamt wird man also feststellen müssen, dass die 1932 vorgesehene Bearbeitung der Gedichte sich erstens eng begrenzt auf das Ausmerzen ungeschickter Formulierungen, missglückter Metaphern und sprachlicher Irrtümer beschränkte und zweitens von dem Bemühen geprägt war, den Duktus und vor allem die Aussage der Originalgedichte so eng wie möglich beizubehalten. Wie sorgfältig dabei verfahren wurde, zeigen auch erhaltene Fahnen für die Ausgabe von 1956. Hier ist die alte Bearbeitung von Nixdorf, Barthel und Dr. E. A. Schmid in vielen Fällen verbessert und in manchen Punkten auf den Originaltext zurückgeführt worden.
Ein schönes Beispiel stellt das Gedicht „Ragende Berge“ dar. In der Fassung der „Himmelsgedanken“ von 1900 beeindruckt die Stärke seiner Bilder und die Schlichtheit der Sprache. Dagegen stört den empfindlichen Leser manche metrische und sprachliche Stolperstelle. Johannes Nixdorf hat das Gedicht daher für die geplante Ausgabe von 1932 wie folgt umgearbeitet:
Ich sehe Berge ragen
dort an der Steppe Rand.
Es soll mein Fuß mich tragen
hinauf ins bessre Land.
Dort lädt man, wie ich glaube,
zur süßen Ruh mich ein,
und von dem Wanderstaube
werd ich gereinigt sein.
Ich sehe Berge ragen
empor zum geistgen Ziel.
Es türmen sich die Fragen,
doch frage ich nicht viel.
Es wird ja doch beim Steigen,
halt ich zuweilen an,
sich ganz von selber zeigen,
wie weit ich schauen kann.
Ich sehe Berge ragen
bis in des Lichtes Rand.
Der Glaube wird mir sagen
den Weg ins Höhenland.
Dort find ich offne Türen,
ein Engel tritt heraus
und wird mich weiter führen
bis in mein Vaterhaus.
Diese revidierte Fassung geht sehr differenziert mit dem Text um; die zweite Strophe wird praktisch vollständig unverändert beibehalten, die (im sprachlichen Detail weniger gelungene) dritte umfassend bearbeitet. Nun hat sich Roland Schmid aber mit dieser Fassung von 1932 nicht zufriedengegeben. Vielmehr bat er einen seiner jüngeren Mitarbeiter, den damals 19-jährigen Hans Wollschläger, der seine berühmte May-Monografie elf Jahre später verfassen sollte, um Rat und Kritik. Das Ergebnis liegt vor in Form eines neunseitigen Briefes, datiert 13.11.1954. Zu „Ragende Berge“ schreibt Wollschläger konkret:
„Warum muß die Ruhe unbedingt wieder ‚süß‘ sein? Die ganze Sammlung ist es stellenweise schon viel zu sehr. Das ‚…dort ladet man mich ein…‘ ist phraseologisch. Wer lädt denn ein? Besser:
Bald find ich, wie ich glaube,
mich dort zur Ruhe ein,
und von dem Wanderstaube…
Es türmen sich die Fragen,
doch frage ich nicht viel.
Rhetorische Fragen lockern den allzu starren Aufbau auf. Also besser:
…doch wozu frag ich viel?
Ich sehe Berge ragen
bis in des Lichtes Statt.
‚Statt‘ (von ‚stehen‘) bezeichnet immer einen festen Punkt auf der Erde, auf dem man stehen kann (z. B. ‚Ruhestatt‘, ‚Lagerstatt‘ usw.). Das Licht ist nicht lokal gebunden, von einer ‚Statt des Lichtes‘ kann also keine Rede sein. Besser:
Ich sehe Berge ragen
bis auf zu lichten Höhn.
Der Glaube wird mir sagen
den Weg, dorthin zu gehn…
Aber auch diese Version ist matt und nicht gerade erhaben, obgleich durch die ‚lichten Höhn‘ der Anklang an den geplanten Gesamttitel des Werkes da ist, was ich für ganz vorteilhaft halte. Am besten ganz frei:
Ich sehe Berge ragen
bis auf zu lichten Höhn.
Nun will ich ruhig wagen,
den letzten Weg zu gehn…“
Es fällt auf, dass der junge Karl-May-Kenner Wollschläger bei seinen Änderungsvorschlägen durchaus nicht streng auf das Original zurückgreift. In der Tat klingen einige seiner Verse aber freier und besser als die Fassung von Nixdorf. Als Roland Schmid 1956 das Gedicht im Rahmen von Band 49 neu herausgab, hat er denn auch alle wesentlichen Vorschläge Wollschlägers berücksichtigt:
Ich sehe Berge ragen
dort an der Steppe Rand.
Es soll mein Fuß mich tragen
hinauf ins Höhenland.
Bald find ich, wie ich glaube,
mich dort zur Ruhe ein,
und von dem Wanderstaube
werd ich gereinigt sein.
Ich sehe Berge ragen
empor zum geistgen Ziel.
Es türmen sich die Fragen,
doch – wozu frag ich viel?
Es wird ja doch beim Steigen,
halt ich zuweilen an,
sich ganz von selber zeigen,
wie weit ich schauen kann.
Ich sehe Berge ragen
hinauf in lichte Höhn,
nun will ich ruhig wagen,
den letzten Weg zu gehn.
Dort find ich offne Türen;
mein Engel tritt heraus
und wird mich weiter führen
bis in mein Vaterhaus.
Mit den Überarbeitungen der „Himmelsgedanken“ verfolgten Dr. Schmid und seine Mitarbeiter also das Ziel, den gutgemeinten und vielfach sehr eindrucksvollen Versen des Dichters durch behutsame Korrekturen eine größere Wirkung zu verschaffen, und der Erfolg des Bandes „Lichte Höhen“ seit 1956 hat ihnen Recht gegeben.
Wenn wir uns dennoch entschlossen haben, in der vorliegenden Neuauflage des Bandes 49 die Gedichte und Sprüche der „Himmelsgedanken“ im originalen Wortlaut und in der Reihenfolge der Sammlung von 1900 wiederzugeben, so bedarf das einiger Erläuterungen. Wir sind zunächst einmal davon ausgegangen, dass der heutige Leser die Mayschen Gedichte anders liest als noch der von 1932. Die sogenante Nostalgiewelle der 1970er-Jahre hat ja manches wieder ans Tageslicht gefördert, was zuvor verpönt war: die Romane der Hedwig Courths-Mahler, triviale Gedichte von Friederike Kempner oder Agnes Günthers sentimentalen Liebesroman „Die Heilige und ihr Narr“. Hier wird deutlich, dass sich der Geschmack und die Einstellung insbesondere zu den Produkten des ‚fin de siècle‘, der Kunst des späten 19. Jahrhunderts, in den letzten zwanzig, dreißig Jahren nachhaltig verändert hat. Was noch in den 50ern für abgrundtief kitschig und trivial gehalten wurde, war nach 1970 plötzlich unter dem Modetitel ‚Nostalgie‘ interessant und aktuell. Ähnliches gilt etwa auch für die Jugendstilfassaden vieler Häuser aus den Jahren nach 1890, die man etwa noch um 1960 gerne von offizieller Seite der Architekten und Städtebauer als Stilblüten und geschmacklose Auswüchse geißelte und die nach 1970 plötzlich heißbegehrte Aufgaben für Restauratoren und Hausbesitzer bildeten.
Man kann sich durchaus vorstellen, dass 1932 – gerade auf dem Hintergrund des ‚Karl-May-Kampfes‘ – noch das eine oder andere vernichtende Urteil, der Bannstrahl eines strengen Kunstkritikers die im besten Sinne naiven lyrischen Gebilde der „Himmelsgedanken“ getroffen hätte. Heute, wo man sich auch für die Triviallyrik des späten 19. Jahrhunderts zu erwärmen versteht, scheint die Zeit reif zu sein, die „Himmelsgedanken“ wieder unverändert und in voller Länge (in der Ausgabe des Bandes 49 von 1956 ist ein gutes Drittel der Gedichte fortgefallen) aufzulegen.
Dabei wollen wir nicht so doppeldeutig verfahren wie die DDR-Ausgabe der „Himmelsgedanken“ von 1988, die sich zwar in optisch anspruchsvollem Gewand präsentierte, aber gleichzeitig mit einem herausgeberischen Kommentar versehen war, der sich geradezu herablassend-ironisch über Karl Mays lyrische Produkte ausließ und dabei ein gutes Stück unberechtigter Verachtung erkennen ließ.
Vielmehr soll sich nun Karl Mays Gedichtsammlung einfach so dem Leser darbieten, wie der Autor es 1900 gewollt hatte. Dabei werden sich gewiss die vielen tiefen Gedanken erschließen, die May hier – wenn auch auf manchmal schlichte Weise – in Reime und Sinnsprüche gefasst hat.