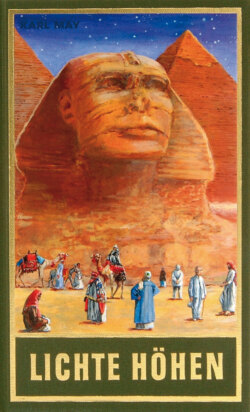Читать книгу Lichte Höhen - Karl May - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.
ОглавлениеDer vorliegende Band unterscheidet sich von der von Roland Schmid 1956 eingerichteten Ausgabe weiter dadurch, dass die Texte aus den Nachlassmappen, die Tagebuchaufzeichnungen und Kunstbriefe fortgelassen wurden; sie finden sich heute zusammen mit der Erstfassung des 2. Aktes von ‚Babel und Bibel‘ in dem ganz dem Spätwerk Karl Mays gewidmeten Band 81 „Abdahn Effendi“ in umfangreicherer Form und sorgfältig kommentiert. Aufgrund dieser Überlegungen erschien es sinnvoll, bei der Revision auf die Radebeuler Ausgabe der „Himmelsgedanken“ zurückzugreifen, die neben der Gedicht- und Gedanken-Sammlung von 1900 noch das Drama „Babel und Bibel“ enthielt. Mit diesem einzigen Schauspiel Karl Mays (die Entwürfe zu einer Posse mit Gesang „Die Pantoffelmühle“ sind Fragment geblieben und von dem in den 1890er Jahren von Karl May angekündigten Stück über den ‚Alten Dessauer‘ liegt noch nicht einmal eine Skizze vor) hat es insofern eine besondere Bewandtnis, als die „Arabische Fantasia in zwei Akten“ dem Dichter besonders am Herzen lag. Über zwei Jahre arbeitete May an dem Drama, wobei er auch historische und religionsgeschichtliche Studien betrieb. Als das Stück dann 1906 bei Fehsenfeld im Druck erschien, versprach er sich davon eine Wirkung auf „alle deutschen Bühnen“ hin, doch ist das Drama nie aufgeführt worden. Erst 1979 kam es anlässlich der Tagung der Karl-May-Gesellschaft in Hannover zu einer szenischen Lesung des vieldeutigen und rätselhaften Textes.
Karl May hat sich mit „Babel und Bibel“ viel Mühe gegeben; angefangen bei seiner intensiven Auseinandersetzung mit den Theorien des damals bekannten Assyriologen Friedrich Delitzsch, der die Ansicht vertrat, in der Bibel seien Stoffe aus babylonischen Mythen verarbeitet worden. Diese ‚Babel-und-Bibel-These‘ führte damals zu einem heftigen Streit unter den Theologen und Bibelforschern. Eine erste fragmentarische Fassung des Dramas (um 1905 entstanden) ist heute noch vorhanden, ebenso wie der – gleichfalls unvollendete – Entwurf eines „Vorspiels aus zwei Welten“, der ein wenig an den „Prolog im Himmel“ zu Goethes „Faust I“ erinnert.
Wie schon erwähnt, hat sich Karl May in jüngeren Jahren mehrfach mit dem Gedanken an die Abfassung eines dramatischen Textes getragen. Die erhalten gebliebenen Entwürfe zur Posse mit Gesang „Die Pantoffelmühle“ verraten, dass Mays theatralischer Geschmack in seiner Frühzeit stark geprägt war durch die singspielartigen Schwänke der Jahrhundertmitte in der Nachfolge des französischen Vaudeville. Umso erstaunlicher, dass sein einziges wirklich fertiges Drama im dramatischen Schaffen des 19. Jahrhunderts so gut wie keine Vorbilder zu haben scheint. Es ist ein ‚Lehrstück‘, wenn auch nicht im späteren Brechtschen Verständnis, so doch im Sinne des geistlichen Dramas des Mittelalters oder der Mysterienspiele – etwa des „Everyman“, den Hugo von Hofmannsthal 1919 neu bearbeiten sollte. Mit dessen „Jedermann“ hat Mays Drama manchen geistigen Grundzug gemeinsam, obwohl Mays Sprache härter ist als die volkstümlich geprägte, bewusst archaisierende Diktion bei Hofmannsthal.
May wählte eine, wie Martin Schenkel, einer der besten Kenner des „Babel und Bibel“-Stückes, urteilt, „eindringliche Lehr- und Predigtform“,7 um so einige der wichtigsten Themen seines Spätwerks in dramatischer Form darzubieten: die Wandlung eines Gewaltmenschen (Abu Kital, der ‚Vater des Kampfes‘) in einen Edelmenschen, die Suche nach dem wahren Geist der Kunst, aber auch nach dem Geist des Morgenlandes. Dabei gestaltet May eindrückliche Bilder und Personen, die zwar Träger einer Idee, aber dennoch individuelle Charaktere sind: Abu Kital, der Scheik der An’allah (was so viel wie „Ich bin Gott“ bedeutet) vertritt einen kriegerischen Gottesglauben und einen aggressiven Islam, der die Welt für seine Zwecke in Beschlag nehmen will. „Das Morgenland nur für das Morgenland!“, heißt seine Parole, was aber später im Stück verwandelt wird in: „Das Morgenland nur für die An’allah!“ und so den grenzenlosen Egoismus des Abu Kital und seiner Mannen aufdeckt.
Das Schachspiel mit lebenden Figuren, eines der Hauptmotive des Stückes, ist nichts anderes als ein Versuch, den Gegner (die Männer der Todeskarawane) zum Kampf zu provozieren. Dies aber gelingt nicht, weil der Scheik der Todeskarawane und die personifizierte Fantasie (alias Marah Durimeh) in Form eines Schattenspiels darstellen, wie der Kadi und der Imam einst Abu Kitals Frau Bent’ullah (die Bibel) und ihren Sohn (nun Ben Tesalah, der ‚Sohn des Friedens‘, verkleidet als Scheik der Todeskarawane) in der Wüste aussetzen ließen. Dieses Verbrechen war auch Abu Kital verborgen, nun wird das scheinbare Gaukelspiel der Fantasie zum Katalysator für die Läuterung des Scheiks. Am Ende verliert der Held des Dramas zwar seinen Körper – weil er nach Kulub, dem Ort der Geisterschmiede, geht, um dort zu einem Edelmenschen umgeschmiedet zu werden –, doch nur um der Verwandlung willen. Auch Jedermann im Mysterienspiel muss ja sterben; dass sein Weg nicht in die Hölle führt, liegt eben an jener Gewissenserschütterung und inneren Wandlung, die das Stück vorführt.
Anders als im mittelalterlichen und von Hofmannsthal erneuerten Mysterienspiel stattet May seine Gleichnisse mit handfesten, den Motiven seiner Abenteuerromane verwandten Zügen aus. Die Vorbereitung der Kampfhandlungen zwischen den An’allah und den Männern der Todeskarawane etwa erinnert nicht zufällig an jene rituellen Stammeskämpfe, die in Mays Orientromanen so oft vorkommen.
Einmal wird der Vorbeter gepeitscht, als er sich weigert, die Fat’ha zu beten, welche als Symbol für einen gewalttätigen, grausamen Glauben steht. Zwischen Abu Kital und Ben Tesalah, in dem Ersterer noch nicht seinen und Bent’ullahs Sohn erkannt hat, bahnt sich ein regelrechter Zweikampf an. Und auch das Motiv des Schachspiels ist zunächst eher äußerlich-spannender Antrieb der Handlung als Symbol. Gerade darin liegt nun die Stärke des Werkes, dass May aus den äußerlichen Spannungsmotiven geschickt innere Gleichnisse webt und dass die Figuren des Dramas als Personen leben, noch bevor sie der Leser als gleichnishaft erkennt.
Gleichnis ist freilich letztlich alles in diesem Drama: Babel ist nicht nur Ort der Handlung, sondern auch Personifizierung des weltfremden, materialistischen Wissenschaftlers, der den Bezug zum Göttlichen verloren hat. Bent’ullah repräsentiert die verkannte, verstoßene Weisheit der Liebe, die durch tote Gelehrsamkeit zugedeckt wurde; nicht umsonst spielt alles in der Nähe des Turms zu Babel. Dieser steht im Stück für die verschüttete und durch die Wissenschaft eher verstellte als enthüllte Weisheit des Altertums. Schefaka, Babels Tochter, verkörpert als Morgenröte das Prinzip Hoffnung; wenn sie im Gewand Bent’ullahs auftritt, regt sich erstmals das Gewissen im Scheik Abu Kital. Marah Durimeh, die als Fantasie auftritt, ist die Menschenseele, zugleich die Verkörperung der Urmutter, des Ewig-Weiblichen, des Prinzips der Liebe. Indem der Scheik sie zum Spiel, zum Schach herausfordert, hat er sich selbst bereits matt gesetzt; ihren Spielkünsten ist er nicht gewachsen, sodass am Ende die Liebe und Güte über Kital, den Drachen, wie es im Stück heißt, triumphiert.
Also ist „Babel und Bibel“ im tieferen Sinne auch ein Michaelsstück; der Kampf des Erzengels gegen den Drachen des Egoismus, des Materialismus, des Kampfes, ist auch der Kampf, den Marah Durimeh, Ben Tesalah und Bent’ullah führen. Mit Recht urteilt Martin Schenkel, dass die Menschheitsseele im Stück gleich durch drei Figuren repräsentiert wird: durch Marah Durimeh, durch Bent’ullah, die den Geist der Liebe verkörpert, der sich in der Bibel verbirgt, und durch Ben Tesalah, der Sohn des Friedens, der das Gegenbild zu Abu Kital (seinem leiblichen Vater im Drama) darstellt – den bereits geläuterten Edelmenschen, der den Drachen überwunden hat.
Durch den dreifachen Einsatz der Menschheitsseele gelingt es Abu Kital am Schluss des Dramas, zu seinem wahren Ich zu finden. Zwar wird seine Wandlung zum Edelmenschen nicht mehr geschildert, doch macht May deutlich, dass dies ein Prozess ist, der sich der Darstellung durch die Kunst verschließt. Ansonsten aber kommt der Kunst im Stück die wichtige Aufgabe zu, zwischen Religion und Wissenschaft zu vermitteln, damit diese zur wahren Religiosität und zur wahren Wissenschaftlichkeit aufsteigen können. Nur so kann der Forderung nach der Menschlichkeit und nach dem Völkerfrieden, nach der Versöhnung des Morgenlandes mit dem Abendland Nachdruck verliehen werden“.8
Dies klingt nun vielleicht arg theoretisch. Inwieweit es May gelang, seine Ideen nicht nur abstrakt, sondern auch dramatisch zupackend zu realisieren, das könnte nur eine Aufführung des Dramas beweisen.
In einem Punkt leider irrte sich May: Seine Form des Lehrtheaters war für das Jahr 1906 noch zu kühn und zu modern, die Zeit dafür noch nicht reif. Heute aber, nach unseren Erfahrungen mit dem Brechtschen Lehr- und dem Kipphardtschen Dokumentartheater (und dem des Peter Weiß) nimmt es freilich wunder, dass sich immer noch keine Bühne des Dramas „Babel und Bibel“ angenommen hat. Jede noch so gelungene Dramatisierung der Mayschen Romane, dies sei hier so kühn behauptet, kann doch dem einzigen Drama Mays nicht das Wasser reichen, von dem Hans Wollschläger im schon erwähnten Briefwechsel mit dem Karl-May-Verlag sagte: „Ich halte es nach wie vor für eins der großartigsten Bühnenwerke der Jahrhundertwende.“
Ob May ein genuiner Dramatiker war, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, da er sich nur noch einmal nach „Babel und Bibel“ (im Prolog zu dem nicht mehr geschriebenen „Kyros“-Stück) an dieser Form versucht hat. Die Wucht und Genauigkeit der Figuren, die Spannung und Präzision der Situationen sowie die Klarheit der Sprache beeindrucken jedenfalls auch bei der Lektüre. Dass May hier den klassischen Blankvers wählte, ist sicher eine Verbeugung vor Lessing, dessen Toleranzidee – in „Nathan der Weise“ und anderswo – May entscheidende Impulse für sein Spätwerk verdankte.
1956 hatte Roland Schmid, unter Berücksichtigung der Vorarbeiten seines Vaters Dr. E. A. Schmid und von dessen Mitarbeitern Johannes Nixdorf und Franz Kandolf, „Babel und Bibel“ in behutsam überarbeiteter Form herausgebracht. Wir haben uns dazu entschieden, nunmehr wieder auf den manchmal etwas unpolierten, aber präzisen Wortlaut der Erstausgabe von 1906 zurückzugreifen, und hoffen damit auch den Wünschen der Leser nachzukommen.
Schließlich wird die Neuausgabe abgerundet durch jene Skizze zu „Babel und Bibel“, welche May am 1. Oktober 1906 für einen Schriftleiter der „Münchner Neuesten Nachrichten“ verfasste, der um Unterlagen zu dem Stück gebeten hatte. Die Originalhandschrift Mays trägt den Vermerk: „In Eile nur so hingeschrieben. Ist also nur Entwurf. Konnte es nicht erst noch durchlesen, da soeben Ihre Karte kommt. Also bitte, Flüchtigkeiten verzeihen.“ In der Tat weist der handgeschriebene Text manche sprachliche Nachlässigkeit auf, die May nicht mehr korrigiert hat. Auch daher hat Roland Schmid, als er die Erläuterungen des Dichters zu seinem Drama in Band 49 aufnahm, in vielen stilistischen Details nachgebessert. Dennoch soll der Text fürderhin so wiedergegeben werden, wie er sich schon im Karl-May-Jahrbuch 1921 fand. Max Finke folgte dabei fast wörtlich Mays Manuskript und merzte nur einige Flüchtigkeitsfehler aus. Wir denken, dass in diesem Fall Authentizität den Vorrang hat vor absoluter Fehlerlosigkeit und dass Mays Diktion für sich spricht.
Vervollständigt wird der Band schließlich durch verschiedene Fassungen des für May so wichtigen „Weihnachtsgedichts“ und durch den variantenreichen Entwurf zu „Des Buches Seele“, das May 1902 für die Dresdener Buchhandelsvereinigung „Bastei“ verfasste.
Als Roland Schmid 1956 sein Nachwort zu Band 49 abschloss, tat er es mit folgenden Worten: „Früher mochte es Zweifel über die Lebensfähigkeit des Mayschen Werkes geben, heute ist dieser Sieg entschieden. Denn es ist der Sieg, den jeder Kampf für das Gute als Keim in sich trägt.“ Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, außer vielleicht, dass wir Mays lyrische und dramatische Versuche, wie sie sich heute wieder in ihrem unveränderten Gewand der Öffentlichkeit darstellen, als „Wege zum Gipfel“ betrachten mögen (so war in der früheren Fassung von Band 49 ganz trefflich der Abschnitt mit den dramatischen Bruchstücken überschrieben): zwar noch nicht als absolute Gipfelstücke Mayschen Könnens, aber doch als wichtige Meilensteine auf dem Weg dorthin. Möge dies sich auch den Lesern des neugestalteten Bandes mitteilen.
Christoph F. Lorenz