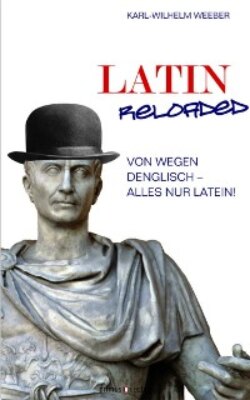Читать книгу Latin Reloaded - Karl-Wilhelm Weeber - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Jakob und seine Scheiben – auch als «DJ» bekannt
ОглавлениеOder Sie wählen die Audio-Variante, die sich freilich auch bequem von der couch aus operaten lässt (operari, «arbeiten»): Sie werfen eine compact disc nach der anderen in den CD-player und stylen sich als häuslicher mini-size-DJ. Das hat was – zumindest was Lateinisches. Denn alles, was mit disc zu tun hat, ist eine runde Sache. Der griechische diskós und der von den Römern abgekupferte discus sind «runde Scheiben», und die CD ist auf Lateinisch ein discus compactus, eine «gedrungene», «feste Scheibe». Der Infinitiv dazu ist compingere, «zusammenfügen». Das anspruchsvoll klingende styling verdankt seinen Ursprung einem schlichten «Griffel», stilus. Das Wort diente allerdings schon den Römern dazu, eine bestimmte Schreib- und Darstellungsweise zu kennzeichnen, den «Stil». Damit war der Weg zum umfassenden Selbstdarstellungs-Stil auch im Sinne tendenziell eher peinlichen stylings vorgezeichnet. Peinlich? Ein interessantes deutsches Lehnwort aus dem Lateinischen – darin steckt poena, die «Strafe». Die Engländer haben aus der poena eine pain («Schmerz» oder eben «Pein») gemacht. Das freilich gehört (noch?) nicht zum Denglisch-Bestand.
Die size, «Größe», sollte bei Kleidungsstücken möglichst gut «sitzen» – so wie das zugrunde liegende lateinische Wort assidere ein «nahes Dabei-Sitzen» bezeichnet. Mini ist spätestens seit der einschlägigen Rock-size populär geworden, eine Abkürzung von minimus, «der kleinste», «sehr klein». Bliebe noch der jockey. Das ist eine Variante zu Jack, der seinerseits dem französischen Jacques nachgebildet ist. Und der wiederum ist mit dem lateinischen Iacobus identisch.
Sie können das Ganze noch durch ein passendes outfit (factus, «gemacht») wie z.B. einen Haus- oder Trainingsanzug tunen (tonus, gLw, «Spannung einer Saite», «Ton») sowie durch kulinarische accessories (accedere, «hinzukommen») wie chips und beer can. Die Etymologie der chips ist unsicher; manche Forscher bringen den lateinischen cippus ins Spiel, eine «Spitzsäule» aus Stein oder Holz. Wir sind skeptisch.
Der can dagegen stammt zweifelsfrei von der canna (ursprünglich: «kleines Rohr») ab, die auch im deutschen Lehnwort «Kanne» weiterlebt. Das kühle beer ist sprachgeschichtlich ein ziemlich heißes Eisen. Auch wenn die ganze germanische Welt aufschreit, wenn man den Namen ihrer «heiligen» Rauschgetränk-creation (creare, «schaffen») den weinseligen Römern zuschreibt, schlagen wir uns unerschrocken auf die Seite derer, die beer und «Bier» von lateinisch bibere ableiten. Das heißt schlicht «trinken» und erhöbe, wenn die Theorie zutreffen sollte, das beer immerhin in den Kultstatus des Getränks schlechthin. Sagten wir «Kultstatus»? Wir meinen natürlich cult status (cultus, «Verehrung»; status, «Zustand»).