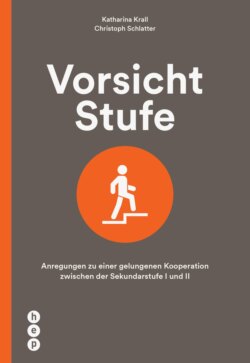Читать книгу Vorsicht Stufe (E-Book) - Katharina Krall - Страница 9
1.2.2Übergänge und Schnittstellen oder gar offene Wunden?
ОглавлениеIm Leben werden wir unabhängig davon, ob es sich um berufliche oder private Ereignisse handelt, immer wieder mit spezifischen Herausforderungen konfrontiert. Diese Situationen stehen oftmals zu Beginn oder am Ende eines Lebensabschnitts, wir bezeichnen diese als Schlüsselereignisse, als Übergänge und Schnittstellen. Der Vergleich mag vielleicht in Bezug auf die Schnittstellen bei den Übergängen im Rahmen der dualen Berufsbildung etwas weit hergeholt erscheinen. Dennoch bedeutet der Einstieg in die Berufswelt für junge Menschen oft einen radikalen Schnitt, zumal dieser parallel zu entwicklungspsychologischen sowie hormonellen Veränderungen im Rahmen der Adoleszenz stattfindet. Innerhalb des dualen Berufsbildungssystems lassen sich mehrere solche Schnittstellen identifizieren, die zu verschiedenen Übergängen führen. Auf der vertikalen Achse kann die Schnittstelle zwischen der Sekundarstufe II und dem Tertiärbereich eine solche Herausforderung darstellen. Auf der horizontalen Achse kann der Erwerb eines neuen Berufs ein solches Ereignis darstellen. Eine anschauliche Darstellung und Beschreibung liefert das 2-Schwellen-Konzept von Emil Wettstein und Philipp Gonon (2009, S. 239).[1] Wir befassen uns vorwiegend mit der Schnittstelle zwischen der Sekundarstufe I und der Sekundarstufe II.
Beim 2-Schwellen-Konzept wird erläutert, dass es zwei wichtige Übergänge gibt. Im Konzept wird von Schwellen gesprochen, die es zu überwinden gilt. Die erste Schwelle befindet sich am Übergang von der Sekundarstufe I zur Sekundarstufe II. Die zweite Schwelle stellt den Übergang ins Erwerbsleben dar und führt in die Zeit nach der Berufsbildung. Im Konzept wird auch die Schnittstelle zur Tertiärstufe als eine Variante der zweiten Schwelle bezeichnet. Wie bereits erläutert, fokussieren wir uns hier aber auf die erste Schwelle. Für die meisten Jugendlichen erfolgt der Übergang von der Sekundarstufe I in die Sekundarstufe II nahtlos und somit ohne grössere zeitliche Lücke.
Im Jahr 2006 vereinbarten Bund, Kantone und Sozialpartner mit den Leitlinien zum Nahtstellenprojekt das Ziel, dass im Jahr 2015 95 Prozent der 25-Jährigen in der Schweiz über einen Abschluss auf Sekundarstufe II verfügen sollen. Der Bildungsbericht 2018 geht davon aus, dass diese Zahl mittlerweile nahezu erreicht ist, immer abhängig von der Herkunft der Jugendlichen (vgl. SKBF 2018, S. 111).
Trotzdem sind sich die beteiligten Stellen einig, dass dieser Übergang für einige Jugendliche mit grösseren Schwierigkeiten verbunden ist und nicht ohne Hilfe gemeistert werden kann.
Den direkten Übergang von der Sekundarstufe I beziehungsweise der obligatorischen Schule in die Sekundarstufe II schaffen rund 30 Prozent der Lernenden eines Jahrgangs nicht auf Anhieb: «[Es] lässt sich für die Jahre zwischen 2000 und 2014 doch ein leichter Anstieg des Anteils der Jugendlichen feststellen, die weder sofort übergetreten sind, noch sich in einer schulischen Zwischenlösung befinden.» (Ebd., S. 105)
Die Gründe für den Besuch eines Zwischenlösungsangebots sind vielfältig, da es keine schweizweite einheitliche Definition für solche Angebote gibt. Meistens dienen die Zwischenlösungen dazu, den Lernenden die Chancen auf eine anspruchsvollere Ausbildung zu ermöglichen.
Basierend auf den Daten der TREE-Studie der Universität Bern kann man festhalten, «dass sich Jugendliche mit schulischen Zwischenlösungen bezüglich des weiteren Bildungsverlaufs zwar von jenen unterscheiden, die nach der obligatorischen Schule keine Zwischenlösung gewählt hatten, jedoch nicht von vergleichbaren Jugendlichen, die sich für einen Sofortübertritt entschieden hatten» (ebd., S. 107).
Die Anzahl der Lernenden, die es trotz Zwischenlösung nicht zum Abschluss einer Ausbildung auf Sekundarstufe II schaffen, ist zwar klein, in den letzten Jahren aber leider gleichbleibend. Für diesen Anteil an Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist der Übergang von der obligatorischen Schulzeit zur Sekundarstufe II mit einem Abschluss auf dieser Ebene also eher eine offene Wunde als eine Nahtstelle. Das Gleiche gilt für die Lernenden, die den Übergang in eine Ausbildung bewältigen, bei denen es jedoch zu einem Lehrabbruch kommt.
Der letzte Bildungsbericht aus dem Jahr 2018 erkennt ganz allgemein Schwierigkeiten von Jugendlichen beim Einstieg in die Berufswelt, vor allem geht es im Bildungsbericht um mangelnde fachliche Kompetenzen, die zum Scheitern der Jugendlichen in der Ausbildung beitragen. Barbara Stalder und Evi Schmid (2006, S. 51) haben für den Kanton Bern Lehrvertragsauflösungen, ihre Ursachen und Konsequenzen im Rahmen des Projekts LEVA untersucht. Ihre Untersuchung zeigt, dass sowohl aus Sicht der Berufsbildnerinnen und -bildner als auch aus Sicht der Lernenden Leistungsprobleme in der Schule und im Betrieb ein wichtiger Grund sind. Bei den befragten Lernenden ist das Scheitern an der Berufsfachschule sogar der wichtigste Grund.
Dies gibt natürlich der Autorin als Lehrperson im Berufsvorbereitungsjahr sehr zu denken: Weder die obligatorischen neun Jahre auf der Sekundarstufe I noch ein Jahr in einer Zwischenlösung wie zum Beispiel im Berufsvorbereitungsjahr bereiten eine gewisse Anzahl Jugendlicher so auf die Berufslehre und die Berufsfachschule vor, dass sie dort bestehen können.
Neben dieser Gruppe Jugendlicher, die es gar nicht erst in die Berufsfachschule schafft oder dort scheitert, gibt es noch eine weitere Gruppe, die nach Erachten der Autorin und des Autors noch nicht erfasst wurde beziehungsweise noch wenig Interesse hervorgerufen hat. Die Autorin lädt regelmässig ehemalige Lernende ins Berufsvorbereitungsjahr ein, wo sie von ihren Erfahrungen in der Ausbildung berichten. Diese Lernenden berichten sehr unterschiedlich von ihren Ausbildungen: Einige sind sehr erfolgreich in ihrer Ausbildung, einige haben die Lehre leider bereits abgebrochen, teilweise handelt es sich um schulisch starke Lernende, einige sind eher schwach. Manche fühlen sich wohl in ihrem Betrieb und ihrer Lehre, andere sind eher unzufrieden. Es handelt sich also um eine recht heterogene Gruppe, jedoch berichten all diese Lernenden in ähnlicher Art und Weise von ihrem Einstieg in die Berufsfachschule: Der Start ist für die Lernenden holprig, alles ist anders als erwartet, oft unpersönlicher, schneller, und die geforderte Selbstverantwortung überfordert die meisten Lernenden. Im besten Fall gewöhnen sie sich schnell an das neue System und sind nur kurz irritiert. Für die meisten bedeutet die Berufsfachschule aber zunächst frustrierende Erfahrungen und schlechte(re) Noten. Viele der Lernenden berichten, dass sie in den ersten drei Monaten überfordert waren, kämpfen mussten, und selbst die langfristig erfolgreichen Lernenden beschreiben diese erste Zeit in der Ausbildung und an der Berufsfachschule als anstrengend. Die meisten Lernenden denken in dieser Zeit auch über einen Lehrabbruch nach, vor allem weil sie das Gefühl haben, den Ansprüchen nicht zu genügen und deshalb zu versagen. Einige vollziehen dann auch den Lehrabbruch.
Die Aussagen dieser Lernenden ergeben natürlich ein sehr subjektives Stimmungsbild. Aber ähnliche Erfahrungen macht auch die andere Seite, die Lehrpersonen an Berufsfachschulen. Vor allem die ersten drei Monate des ersten Lehrjahres werden als eine unbefriedigende Zeit beschrieben, in der sehr viel Zeit dafür verwendet werden muss, die Lernenden an die neue Schulsituation zu gewöhnen. Zeit, die häufig nicht zur Verfügung steht oder dann anderswo fehlt.