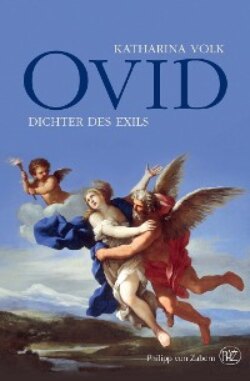Читать книгу Ovid - Katharina Volk - Страница 12
Verlorene und fälschlich zugeschriebene Gedichte
ОглавлениеEs ist eine ernüchternde Tatsache, dass uns die überwältigende Mehrheit der antiken griechischen und römischen Literatur für immer unbekannt bleiben wird, nachdem sie im risikobefrachteten Prozess der Textüberlieferung von der Antike bis in die Neuzeit einfach verloren gegangen ist. Ovid ist dabei weit glimpflicher davongekommen als viele andere Autoren (so sind etwa von den gefeierten Gedichten des ersten römischen Liebeselegikers, Gallus, nur etwa zehn Zeilen erhalten), doch auch sein Gesamtwerk ist nicht zur Gänze überliefert. Der schlimmste Verlust ist die Tragödie Medea, auf die der Dichter in Amores 2.18 anspielt und die auch spätere Autoren wie Seneca der Ältere, Tacitus und Quintilian erwähnen. Lediglich zwei kurze Fragmente des Stücks, beide anscheinend Teile aus Reden Medeas, haben überlebt.
Außerdem wird Ovid eine Übersetzung der Phainómena (»Sichtbare Zeichen«) des hellenistischen Dichters Arat (3. Jh. v. Chr.) zugeschrieben, aus der zwei Fragmente in späteren Quellen zitiert werden. Arats Gedicht, eine Beschreibung der Sternbilder, war in Rom äußerst beliebt und schon von Cicero ins Lateinische übertragen worden. Sein Zeitgenosse Germanicus, dem Ovid die Fasti gewidmet hatte, schrieb ebenfalls eine lateinische Version. Dass offenbar auch Ovid von dieser römischen Arat-Begeisterung erfasst wurde, überrascht nicht; die Beschreibungen der Himmelsbewegungen und die Sternmythen in den Fasti bezeugen ebenfalls sein Interesse an astronomischen Themen.
Während einige von Ovids Werken verloren gingen, werden andere Gedichte, die ihm schon in der Antike oder aber in mittelalterlichen Handschriften zugeordnet werden, in der modernen Forschung weitgehend als nicht authentisch eingeschätzt. Die bekanntesten davon sind die Halieutica (»Kunst des Fischens«), die Nux (»Der Walnussbaum«) und die Consolatio ad Liviam (»Trostrede für Livia«). Die Halieutica, ein Fragment von 134 Hexametern, handeln vor allem von der angeborenen Fähigkeit verschiedener Fischarten, sich vor Räubern zu schützen, und den Tricks der Fischer, die sie fangen wollen. In der Nux, einer Elegie von 182 Zeilen, beschwert sich ein Walnussbaum am Wegesrand über die Menschen, die ihn mit Steinen bewerfen, um an die Nüsse zu kommen. In der Consolatio ad Liviam schließlich tröstet der Sprecher des Gedichts die Kaiserin Livia über den Tod ihres Sohnes Drusus (9 v. Chr.). Diese Werke gelten unter anderem auf Grund von metrischen und sprachlichen Anomalien als unecht, wobei es aber für die Echtheit besonders der Halieutica in der Forschung auch Fürsprecher gibt.
Selbst wenn man von den gerade genannten Gedichten absieht, die hier nicht weiter erörtert werden, ist es wichtig, sich vor Augen zu führen, dass es bei 2000 Jahre alten Werken keine absolute Sicherheit geben kann, dass der vorliegende Text tatsächlich von dem fraglichen Autor stammt. Wie bereits erwähnt, stehen einige der Heroides im Verdacht der Unechtheit; die Fasti (wenn auch nicht die Metamorphosen) scheinen unvollendet zu sein; und vermutete Überarbeitungen und mehrfache Auflagen komplizieren die Dinge noch zusätzlich. Da diese Werke außerdem bis zur Erfindung des Buchdrucks alle nur als handschriftliche Kopien von Kopien überliefert wurden, kam es zu zahlreichen Fehlern. Manche von ihnen können problemlos erkannt und korrigiert werden, während andere zweifellos unentdeckt weiterbestehen.
Wie das folgende Kapitel zeigen wird, müssen wir uns fast ausschließlich auf Ovids Werk stützen, um eine Vorstellung von dem Menschen Ovid zu bekommen. Wir haben seine Worte, doch seine Person ist schwer zu fassen. Dabei haben wir uns zu vergegenwärtigen, dass selbst die überlieferten Worte immer nur eine Annäherung (wie gut auch immer) an das sind, was Ovid tatsächlich geschrieben haben muss.