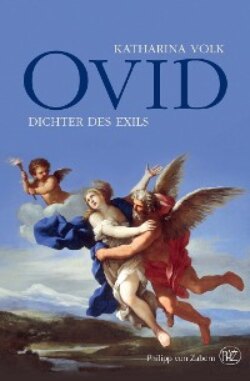Читать книгу Ovid - Katharina Volk - Страница 6
Einleitung Der Ruhm Ovids
ОглавлениеAm Ende seiner Metamorphosen erklärt der römische Dichter Ovid voll Stolz, dass ihm ein Werk gelungen sei, »das weder der Zorn Jupiters noch Feuer und Schwert oder der alles verschlingende Lauf der Zeit zerstören können« (15.871–872). Auch wenn sein Leib eines Tages sterben werde, so werde doch seine Dichtung fortleben:
»So weit sich die Macht Roms über die eroberten Länder erstreckt, werde ich mit den Lippen der Menschen gelesen werden – und wenn nur ein Körnchen Wahrheit in den Prophezeiungen der Dichter steckt, werde ich kraft meines Ruhms für alle Zeiten leben« (15.877–879).
Ovid starb vor fast 2000 Jahren, doch diese Vorhersage hat sich in einem Maß erfüllt, das selbst seine dichterische Vorstellungskraft übertrifft. In der zitierten Passage hofft Ovid lediglich, dass sein Ruf als Dichter so weit reichen werde wie die politische Macht Roms. Das Römische Reich aber ist längst untergegangen, Latein ist keine Weltsprache mehr – und doch werden Ovids Werke immer noch gelesen, und zwar auch in Teilen der Welt, von deren Existenz Ovid nichts wusste, und in Sprachen, die noch niemand sprach, als er seine Verse niederschrieb.
Während der Ruhm des Dichters so durch alle Epochen bis heute überlebt hat, hat er zusätzlich in jüngster Zeit einen besonderen Aufschwung genommen. In den letzten dreißig Jahren hat Ovid eine solche Beliebtheit erlangt, dass häufig von einer neuen aetas Ovidiana die Rede ist. (Der Begriff eines »Ovid’schen Zeitalters« wurde ursprünglich von dem Mediävisten Ludwig Traube für das 12. und 13. Jahrhundert geprägt, eine Zeit, in der man sich intensiv mit Ovid befasste und ihn häufig imitierte.1) Dieser Trend ist nicht nur daran festzumachen, dass Ovid heutzutage einer der beliebtesten lateinischen Autoren an Schulen und Universitäten ist (ein amerikanisches Anfangslehrbuch für Latein unternimmt es sogar, Latin via Ovid zu lehren) oder dass in den letzten Jahrzehnten die Zahl der wissenschaftlichen Publikationen zu Ovid geradezu explodiert ist. Noch weit bemerkenswerter ist die Anziehung, die Ovid auf ein breiteres Publikum ausübt, wie es sich zum Beispiel am Interesse an literarischen Übersetzungen zeigt (etwa Ted Hughes’ Tales from Ovid, 1997), am Erfolg von Mary Zimmermans Theaterstück Metamorphoses (einem Broadway-Hit von 2002) oder an dem neuen literarischen Mini-Genre des »Ovidromans« (dessen prominente Vertreter, unter anderem David Malouf, Christoph Ransmayr und Jane Alison, im achten Kapitel behandelt werden).
Woher kommt diese Faszination? Wer Ovids Werke im Original lesen kann, wird vielleicht auf die klassische Schönheit seiner Sprache hinweisen (die übrigens einfach genug ist, um sich Lateinschülern schon früh zu erschließen). Ein Großteil von Ovids Werk widmet sich dem Thema der Liebe und mythologischen Erzählungen – Themen, die für moderne Leser ebenso anziehend sind wie für die antiken –, wobei die Tatsache, dass der Dichter diese mit dem ihm eigenen Witz und Humor behandelt, seinen Texten zusätzliche Attraktivität verleiht. Darüber hinaus weckt das traurige Schicksal des Autors, der auf der Höhe seines Erfolgs unter mysteriösen Umständen in ein fernes Land verbannt wurde, immer noch Mitgefühl und ruft Spekulationen hervor.
Der Hauptgrund, warum die Leserinnen und Leser des späten 20. und frühen 21. Jahrhunderts in Ovid einen verwandten Geist sehen, liegt jedoch vielleicht darin, dass der Dichter so modern – oder genauer: postmodern – wirkt und viele Einstellungen und Anliegen nicht nur mit der modernen akademischen Welt, sondern auch mit der Alltagskultur der Gegenwart teilt. Misstrauisch gegenüber den großen Narrativen, mehr an den sprachlichen Strukturen interessiert als an der Realität, intertextuell, selbstreferentiell und zutiefst ironisch, spricht Ovid nicht nur poststrukturalistisch orientierte Gelehrte, sondern auch ein breiteres Publikum an, das (um nur ein Beispiel zu nennen) heutzutage etwa erwartet, dass selbst ein Unterhaltungsfilm selbstreflektierende und häufig witzige Anspielungen auf frühere Filme derselben Gattung enthält und damit die Aufmerksamkeit auf seinen Status als Kunstwerk lenkt. Die Prophezeiung seines Ruhms, mit der Ovid die Metamorphosen beschließt, ist ein Musterbeispiel postmoderner Verspieltheit. Wie ein mit der Geschichte des Films vertrauter Kinogänger eher in der Lage ist, das Ausmaß der Anspielungen eines beliebigen neuen Films zu erkennen und zu genießen, so wird es einem lector doctus (»gelehrten Leser«) Ovids bewusst sein, dass dieser mit seinem stolzen Anspruch auf die Unsterblichkeit seines Werkes auf ähnliche Behauptungen zweier früherer lateinischer Dichter zurückgreift. Im letzten Gedicht des dritten Buches seiner Oden erklärt Horaz (65–8 v. Chr.), dass er »ein Werk, dauerhafter als Bronze«, geschaffen habe (3.30.1), dessen Fortleben durch die Jahrhunderte sicherstellen solle, dass auch sein Dichter nicht sterben, sondern durch seinen Ruhm fortleben werde. Wie Ovid nach ihm verknüpft auch Horaz sein unvergängliches Ansehen mit der Dauerhaftigkeit des Römischen Reiches, wenn er sagt, dass seine Berühmtheit stetig wachsen werde, »solange der Hohepriester mit der schweigenden Jungfrau zum Kapitol emporsteigt« (8–9, eine Anspielung auf den Pontifex Maximus und die Vestalinnen). Schon vor Horaz hatte der archaische lateinische Dichter Ennius (3.–2. Jh. v. Chr.) seinen Freunden geraten, nach seinem Tod nicht um ihn zu weinen, da er nicht sterben, sondern »lebendig über die Lippen der Menschen fliegen« werde (Epigramme fr. 18 Vahlen = 46.2 Courtney).
Über diese Anspielungen auf ältere lateinische Dichtungen hinaus treibt Ovids Vorhersage auch noch ein selbstreferentielles Spiel mit dem Leser. Die Wendung »Ich werde mit den Lippen der Menschen gelesen werden« ist eine sich selbst bewahrheitende Prophezeiung. Sie trifft buchstäblich ein, sobald jemand diese Zeile liest – und mehr noch, wenn jemand sie laut liest, wie es in der Antike üblich war. Schon durch das Lesen seiner Worte halten wir Ovid am Leben.