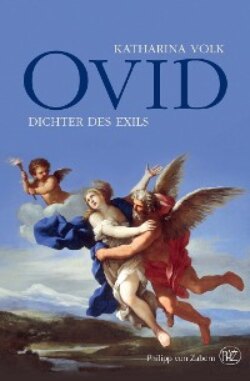Читать книгу Ovid - Katharina Volk - Страница 9
Liebesdichtung
ОглавлениеAmores (»Liebschaften«)
In der überlieferten Form sind die Amores eine Sammlung von neunundvierzig elegischen Gedichten im Stil von Tibull und Properz, die auf drei Bücher verteilt sind. In ihnen stellt ein männlicher Sprecher in der ersten Person seine erotischen Gefühle und seine Beziehung zu einer Frau dar, die er Corinna nennt. Der Sammlung ist ein kurzes Epigramm vorangestellt, aus dem der Leser erfährt, dass es ursprünglich fünf Bücher gab. Der Autor habe aber das Werk in verkürzter Form neu herausgegeben und damit dem Leser – wie scherzhaft formuliert wird – weniger Schmerzen bereitet. Die Tatsache, dass die Amores diese zwei Auflagen erlebten, erschwert die Klärung ihrer Chronologie, vor allem, weil unklar bleibt, ob die fünf Bücher der ersten Ausgabe auf einmal oder nacheinander in gewissen Anständen herauskamen und ob der zweiten Ausgabe neue Gedichte hinzugefügt wurden.
In Tristia 4.10.57–60 erklärt Ovid, dass er seine Dichtung zum ersten Mal öffentlich vorgetragen habe, »als [sein] Bart gerade ein oder zweimal geschnitten worden war« (58), und dass sich darunter Gedichte über Corinna befanden. Danach wären die frühesten Teile der Amores auf die 20er Jahre v. Chr. zu datieren. Nur sehr wenige Gedichte in der erhaltenen dreibändigen Ausgabe enthalten Hinweise auf datierbare Ereignisse: In Amores 3.9 wird der Tod des Dichters Tibull (19 v. Chr.) erwähnt, und die Passage 1.14.45–50 spielt auf einen römischen Sieg über die germanischen Sugambrer an (möglicherweise 16 v. Chr., wenn sich die Auseinandersetzungen auch fortsetzten und der Stamm erst 8 v. Chr. endgültig besiegt wurde). Interessant, aber auch problematisch ist das Gedicht 2.18, in dem Ovid auf etliche seiner anderen teils vollendeten, teils in Entstehung begriffenen Werke Bezug nimmt; dazu gehören die Medea (13–14), die Heroides (21– 26) und eventuell die Ars amatoria (19–20). Der zuletzt genannte Bezug ist zweifelhaft, da man die »Künste zarter Liebe« (artes teneri … Amoris, 19) auch als eine Anspielung nicht auf die Ars, sondern auf die Amores selbst interpretieren kann. Sollte Ovid jedoch die Ars meinen, deren Entstehung sich auf den Zeitraum zwischen 1 v. Chr. und 2 n. Chr. datieren lässt, dann wäre 2.18 ein sehr spätes, zweifellos für die zweite Ausgabe der Amores verfasstes Gedicht; diese würde damit in die Zeit um die Jahrtausendwende fallen. Der Dichter hätte damit möglicherweise über fünfundzwanzig Jahre hinweg immer wieder mit Unterbrechungen an den Amores gearbeitet.
Die Amores sind die letzte Manifestation der Gattung der römischen Liebeselegie, die detaillierter in Kapitel 3 besprochen wird. Gemäß den Konventionen dieser Gattung ist das lyrische Ich der Amores (der Erzähler in der ersten Person) sowohl ein Liebhaber als auch ein Liebesdichter, das heißt ein Elegiker. Zusätzlich zu seinem Auftreten in für die Elegie typischen Situationen (beim Bankett, auf der Türschwelle der Geliebten, von Eifersucht auf einen Rivalen geplagt, voll Wut über die Treulosigkeit der Geliebten usw.) reflektiert der Poet und Liebhaber häufig über seine dichterische Tätigkeit. Indem er die Aufmerksamkeit auf die Künstlichkeit des elegischen Szenarios lenkt (bei dem ein Mann liebeskrank nach einer letztlich unerreichbaren idealisierten Frau schmachtet) und die handfesteren Aspekte einer erotischen Beziehung betont (z. B. unromantische Ereignisse wie Impotenz in 3.7 und Abtreibung in 2.13 und 2.14), macht Ovid sich über die Elegie selbst lustig und erweitert gleichzeitig ihre Bandbreite – eine Tendenz, die sich in seiner weiteren Liebesdichtung fortsetzt.
Heroides (Heroidenbriefe)
Die Heroides oder Epistulae Heroidum (»Briefe heldenhafter Frauen«) sind fiktive Briefe im elegischen Versmaß, die vorgeblich von mythologischen Frauengestalten (und einigen wenigen Männern) an ihre Geliebten geschrieben wurden. Einundzwanzig solche Gedichte sind unter dem Namen Ovids erhalten. Die ersten fünfzehn Heroides, die so genannten Einzelbriefe, sind Briefe der »Heroinen« an geliebte Männer, von denen sie getrennt, nicht selten auch im Stich gelassen worden sind und mit denen sie wieder vereint sein wollen. Zu den »Verfasserinnen« gehören berühmte literarische Gestalten wie Penelope, Phaedra, Dido, Ariadne und Medea sowie als einzige historische Figur die Dichterin Sappho als fiktive Autorin des 15. Heroidenbriefes. Die restlichen sechs, die so genannten Doppelbriefe, bestehen aus drei Briefpaaren, in denen jeweils ein Mann zuerst an seine Geliebte schreibt und dann von ihr eine Antwort erhält: Paris schreibt an Helena, Leander an Hero, Acontius an Cydippe.
Wie oben angemerkt, erwähnt Ovid einige der Einzelbriefe in Amores 2.18 (21–26), woraus folgt, dass sie zeitgleich mit Teilen der Amores entstanden sind, zu einem unbekannten Zeitpunkt im letzten Viertel des 1. Jahrhunderts v. Chr. Im selben Text (27–34) berichtet Ovid, dass einer seiner Freunde, ein gewisser Sabinus, in eigenen Gedichten die männlichen Adressaten Antwortbriefe an die Heroinen schreiben ließ; so erhielt Penelope schließlich eine Nachricht des verloren geglaubten Odysseus. Vielleicht hat Sabinus’ witzige Fortsetzung (die nicht erhalten ist) Ovid zu den Briefpaaren der Heroiden angeregt. Da Ovid selbst die Briefpaare aber nie erwähnt (und diese zudem auf Grund ihrer mythologischen Thematik keinerlei Hinweise auf zeitgenössische Ereignisse enthalten), ist es nicht möglich, sie genauer zu datieren, außer dass sie nach Amores 2.18 entstanden sein müssen. Aus stilistischen Gründen werden sie häufig einem späten Stadium in Ovids Karriere zugeordnet. Möglicherweise hat sie Ovid erst während seiner Verbannung verfasst.
Die Authentizität einiger Heroidenbriefe ist Gegenstand einer lebhaften Debatte. Am häufigsten ins Kreuzfeuer gerät der Sappho-Brief, der heute gewöhnlich als Nummer 15 der Sammlung geführt wird, aber eine andere handschriftliche Überlieferungsgeschichte als die der restlichen zwanzig Gedichte hat und überhaupt erst seit dem 15. Jahrhundert bekannt ist. Die Briefpaare sind gleichermaßen in den Verdacht geraten, nicht echt zu sein, ebenso jene Einzelbriefe, die nicht ausdrücklich in Amores 2.18 erwähnt sind (eine weitere Komplikation ergibt sich daraus, dass dort ausdrücklich ein Brief Sapphos genannt wird). Die meisten Argumente gegen die Echtheit basieren auf zweifelhaften stilistischen und metrischen Eigenschaften der jeweiligen Briefe. Obwohl die Debatte zu dieser Frage bestimmt noch lange weitergehen wird, neige ich zu der Ansicht, dass alle einundzwanzig Briefe aus Ovids Feder stammen, und werde sie in der Folge als authentische Texte behandeln.
Medicamina faciei femineae (»Gesichtskosmetik für die Frau«)
Mit den Medicamina beginnt Ovids Streifzug in die Lehrdichtung, eine Gattung, die üblicherweise in Hexametern verfasst war und zumindest vorgab, entweder praktische Kenntnisse (wie etwa in Vergils Georgica solche der Landwirtschaft) oder theoretisches Wissen (wie die epikureische Physik in De rerum natura des Lukrez) zu vermitteln. Im Gegensatz dazu kleidet Ovid seine Anweisungen in elegische Distichen und wählt ein dazu passendes elegisches Sujet: die Kosmetik der Frau. Das Gedicht ist nur fragmentarisch überliefert und bricht nach Zeile 100 ab. Die Hälfte des erhaltenen Textes nimmt ein Proömium ein, in dem Ovid sich an sein weibliches Publikum wendet und ein Loblied auf das Konzept des cultus (»Kultivierung, Raffinement«) anstimmt, der nicht nur die Basis weiblicher Verschönerung, sondern der Kultur im Allgemeinen bilde. Die verbleibenden Verse vermitteln äußerst technische »Rezepte« für verschiedene Hautpflegemittel und Gesichtscremes. Da die Medicamina in Ars 3 (205–208) genannt werden, sind sie auf jeden Fall vor Buch 3 und höchstwahrscheinlich vor der gesamten Ars geschrieben worden.
Ars amatoria (»Liebeskunst«)
Waren die Medicamina Ovids origineller Erstlingsversuch, das Format des Lehrgedichts mit dem Versmaß und der Thematik der Elegie zu kombinieren, so perfektionierte er diese hybride Gattung in der Ars. Die römische Liebeselegie, einschließlich der Amores, beschreibt lediglich die oft schmerzhaften Liebeserfahrungen des Dichters. Im Gegensatz dazu versucht sich die neue »Liebeskunst« an dem ambitionierten Unterfangen, die elegische Liebe zu lehren – und zwar so, dass sie schmerzfrei wird. Im ersten und zweiten Buch der Ars wendet sich Ovid an die jungen Männer Roms und demonstriert, dass eine in jeder Hinsicht befriedigende Beziehung in drei leichten Schritten erreicht werden kann: Zuerst muss der Mann eine Liebespartnerin finden, dann muss er sie verführen und schließlich Schritte unternehmen, um ein langfristiges Verhältnis zu sichern. Die Anweisungen des Lehrers sind handfest: Ovid erstellt eine Liste der für eine Kontaktaufnahme günstigsten römischen Lokalitäten, gibt Tipps zur Stärkung des Selbstvertrauens vor der ersten Annäherung an das Mädchen und erteilt überhaupt Ratschläge für alles: wie man Liebesbriefe formuliert, Geschenke auswählt und überreicht, wie man schließlich erfolgreich im Schlafzimmer vorgeht. Am Ende von Buch 2 haben die jungen Männer sich ihre Geliebten gesichert und feiern ihren Lehrer Ovid als einen Meister seiner Zunft.
An dieser Stelle erklärt Ovid, dass die »zarten Mädchen« (2.745) ebenfalls um seinen Rat nachsuchen, und macht sich sofort – aus Gründen der Fairness – an sein drittes Buch, das Instruktionen für Frauen enthält. Traditionell nimmt man an, dass die beiden ersten Bücher nach ihrem Erscheinen so erfolgreich waren, dass Ovid Buch 3 als witzige Fortsetzung konzipierte, um die männerzentrierten Darlegungen aus der weiblichen Perspektive zu ergänzen. Es ist aber auch möglich, dass der Dichter die drei Bücher von vorne herein als Einheit plante und dass seine Behauptung, das dritte sei ein nachträglicher Einfall, der auf das Drängen der Frauen selbst zurückgehe, nur eine witzige Fiktion ist. Buch 3 greift auf die Medicamina zurück, indem es die Leserinnen zum cultus anhält und jede Menge Ratschläge zu Themen wie Kleidung und Frisur erteilt. Obwohl Ovid von seinen Schülerinnen auf den Pfaden der Liebe eine deutlich zurückhaltendere Rolle erwartet als von den Männern, erzieht er sie doch zu ernst zu nehmenden Mitspielerinnen, die es verstehen, sich die Männer für ihre eigenen Zwecke gefügig zu machen.
Das erste Buch der Ars enthält Hinweise auf zwei zeitgenössische Ereignisse, die eine ungewöhnlich exakte Datierung erlauben. In der Passage 171–176 erwähnt Ovid die Inszenierung einer nachgestellten Seeschlacht, die Augustus im Jahr 2 v. Chr. veranlasste, und in 177–228 behandelt er den bevorstehenden Feldzug des Kaiserenkels Gaius Caesar gegen die Parther, zu dem dieser spät im Jahr 2 oder früh im Jahr 1 v. Chr. aufbrach. Falls Buch 3 Teil der ursprünglichen Konzeption war, datiert es aus dieser Zeit; andernfalls ist es vermutlich kurz darauf entstanden.
Remedia amoris (»Heilmittel gegen die Liebe«)
Schon im dritten Buch der Ars amatoria ist Ovids Gefallen daran zu erkennen, einige seiner Lehren aus den ersten beiden Büchern humorvoll in ihr Gegenteil zu verkehren. In den Remedia amoris, seinem letzten didaktischen Gedicht zum Thema Liebe, nimmt der Dichter eine weitere Kehrtwendung vor. Nachdem er die Kunst der Liebe gelehrt hat, erteilt er nun Ratschläge, wie man sich von möglichen unerwünschten Gefühlen und Begierden befreien kann. Wie der Titel suggeriert, schlüpft der Dichter hier in die Rolle des Arztes, der weiß, wie man Patienten von der Liebes-»Krankheit« (einer gängigen Metapher der römischen Liebeselegie) kuriert. Obwohl weiterhin ein humorvoller Ton vorherrscht, sind die Ratschläge – wie man die Verstrickung in eine unzuträgliche Beziehung von vorne herein vermeidet, wie man sich durch eine aktive Lebensführung davon ablenkt und wie eine Trennung im gegenseitigen Einvernehmen gelingen kann – im Ganzen ernsthafter und finden sogar Parallelen in der Morallehre der zeitgenössischen Philosophie.
Im Zusammenhang mit dem Rat an einen unglücklich verliebten Schüler, sich durch den Eintritt in den Militärdienst von der Geliebten abzulenken, erwähnt Ovid wiederum Gaius Caesar, der zu diesem Zeitpunkt parthisches Gebiet erreicht hat und zur Schlacht bereit ist (155–156). Weit davon entfernt, sich mit den Parthern anzulegen, handelte allerdings der wirkliche Gaius 2 n. Chr. eine diplomatische Lösung aus. Da Ovid zum Zeitpunkt der Abfassung dieser Zeilen offensichtlich von dieser Entwicklung noch nichts wusste, darf man davon ausgehen, dass er die Remedia und damit die Phase seiner Liebesdichtungen früh im Jahr 2 n. Chr. beendet hatte.