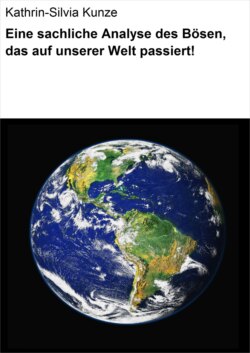Читать книгу Eine sachliche Analyse des Bösen, das auf unserer Welt passiert! - Kathrin-Silvia Kunze - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление1.4. Jenseits des Mitgefühls
Wie ist es einem Menschen vom rein emotionalen Anspruch her überhaupt möglich einem anderen Wesen absichtlich Böses zu tun? Dazu kann man sagen, dass nur Menschen, die ihre Angst verdrängt haben in der Lage sind, anderen Böses zu tun, denn als Folge der Angstverdrängung ist auch der Kontakt zu ihren anderen Emotionen und damit auch zu ihrem Mitgefühl gestört. Vom emotionalen Anspruch her, ist es nämlich nur dann möglich, einem Menschen oder einem anderen Mitgeschöpf absichtlich zu schaden oder sogar Gewalt anzutun, wenn man sich zuvor von ihm emotional distanziert hat. Diese Distanzierung erwächst aus einem fehlenden Mitgefühl. Und zu fehlendem Mitgefühl kommt es durch die Verdrängung von Angst.
Die emotionale Vorraussetzung für eine böse Tat ist damit also ein gestörter Kontakt zum Mitgefühl, wodurch Distanz zum Mitmenschen/-geschöpf aufgebaut wird.
Denn ein Mensch der seine Angst als Teil des einfach Mensch sein akzeptiert hat, verfügt dadurch auch über einen guten Kontakt zu seinen anderen Emotionen. Dazu gehört auch die als Mitgefühl bezeichnete Fähigkeit, mit anderen Menschen und Lebewesen mit zu empfinden. Das bedeutet, man vermag seine eigenen Lebens- und auch Leiderfahrungen auf andere zu extrapolieren bzw. zu übertragen. Eigentlich erst dadurch werden die Lebewesen in der Umwelt eines Menschen für ihn zu Mit-Menschen und Mit-Geschöpfen. Und in dem Moment, in dem ein Mensch seine Empfindungsfähigkeit auch einem anderen Wesen zuspricht und es dadurch zum Mit-Wesen erhebt, ist ihm dadurch emotional jegliche Böse Tat an diesem verwehrt, bzw. unmöglich. Wenn ein Mensch jedoch seine Angst verdrängt hat, entsteht dadurch ein innerer Druck, der auch den Kontakt zu seinen übrigen Emotionen stört und verschlechtert. Dadurch verfügt er auch nur noch über einen zurück- bzw. unterentwickelten Kontakt zu seinem Mitgefühl. Doch gerade das Mitgefühl ist essentiell, um eine emotionale Verbindung bzw. ein auf andere bezogenes Mitempfinden zu entwickeln. Wird nun aufgrund eines mangelhaften Mitgefühls vom Menschen kein Bezug zwischen einer potentiell bösen Tat an einem Mitmenschen/Mitgeschöpf und den eigenen Lebens- bzw. Leiderfahrungen hergestellt, entsteht eine Distanz zwischen ihm und seinem Mitmenschen/Mitgeschöpf. Diese Distanz ist es letztendlich, die einem Menschen vom emotionalen Anspruch her erst eine böse Tat ermöglich und ihn zum potentiellen Täter werden lässt. Denn Distanz verhindert die notwendige emotionale Hemmung von bösen Taten. Durch diese Distanz kann der potentielle Täter den Lebewesen sozusagen ihre Mit-Menschlichkeit oder Mit-Geschöpflichkeit absprechen und sie dadurch verdinglichen und so letztendlich zu potentiellen Opfern degradieren.
Hierher rührt auch die - oftmals sogar unbewusste - Vorgehensweise potentielle Opfer oder imaginäre Feinde nach Möglichkeit zu diffamieren und abzuwerten. Denn durch verbale Abwertungen im Sinne von „Krautfresser, Waschlappen, Trottel, Streber, Bürohengst, langhaariger Öko-Hippi“, etc., oder durch die für Tierversuche oder Massentierhaltung immer wieder gern genutzte Aussage „aber das sind doch nur Tiere“ kommt es zur gewünschten emotionalen Trennung und dem Aufbau von Distanz. Und Distanz wiederum verhindert das Aufkommen von Mitgefühl und Mitempfinden.
Schon der russische Schriftsteller Fjodor Michailowitsch Dostojewski (1821-1881) thematisierte in seinem Roman Die Brüder Karamasow, wie wichtig es ist, dass jeder Mensch ein starkes Mitgefühl für seine soziale Umwelt empfindet. Dies ist deshalb so dringend notwendig, da fehlendes Mitgefühl eine Voraussetzung dafür ist, um Böses zu tun. Und wenn Böses getan wird, dann von Menschen. Auch darauf wies Dostojewski bereits hin, indem er in seinem Roman Die Brüder Karamasow den kleinen, unterernährten und kränklichen Jungen Iljuscha, der zusehen musste wie sein armer, zerlumpter und unterernährter Vater, Hauptmann Snegirjow, beleidigt und verspottet wurde, sagen lässt: „Oh Vater, diese Menschen.“
Bei Menschen, die ihre Angst verdrängen, degeneriert also im Laufe der Zeit auch die Fähigkeit, Mitgefühl zu empfinden. Denn unter dem Druck, eine natürliche Emotion verdrängen zu müssen, wird auch der gesunde Kontakt zu allen übrigen Emotionen gestört und verschlechtert. Dies gilt dann natürlich nicht nur für das Mitgefühl anderen gegenüber, sondern auch und vor allem, für das Mitgefühl, sich selbst gegenüber. Menschen, die nicht genug Vergebung sich selbst gegenüber aufbringen, um ihre Angst als Teil des einfach Mensch sein zu akzeptieren, sind dadurch also auch sich selbst entfremdet. Man kann sogar sagen, dass solche Menschen gerade darum kein Mitleid für andere haben, weil sie eben kein wirkliches Mitleid für ihr eigenes, wahres, menschliches Selbst haben. Unter diesem Druck sind sie mit sich selbst nicht im reinen und verspüren ein latentes Missempfinden und eine latente Unzufriedenheit sich selbst und ihrer Umwelt gegenüber. Diese Unzufriedenheit versuchen sie, in irgendeiner Form zu überdecken, damit sie sie nicht zu stark wahrnehmen müssen. Dafür wählen sie entweder ein soziales Umfeld voll Aktion, Trubel und Lärm oder sogar voll Aggression und Gewalt.
Wenn sich solche Menschen jedoch in einem relativ harmonischen Umfeld befinden, versuchen sie unbewusst, ihr Missempfinden mithilfe von störenden oder aggressiven Aktionen auf ihre Umgebung zu übertragen. Denn dadurch können sie dann auch in ihrer sozialen Umgebung eine Art Missstimmung erzeugen. Menschen, die aufgrund ihrer Angstverdrängung einem latenten Missempfinden ausgesetzt sind, versuchen also, Harmonie in Disharmonie umzuwandeln, um eine Entsprechung ihrer Negativität in der Umwelt zu finden, bzw. notfalls zu erzeugen. Dieses Verhalten dient ihnen dazu, die Dissonanz zwischen außen und innen, also von harmonisch/neutral zu negativ, nicht zu stark empfinden zu müssen.
Wenn die Angstverdrängung jedoch zu groß wird und dadurch der Konflikt zwischen dem was man sein will und dem was man nun mal ist, zu stark, kommt es zusammen mit einem fehlenden Mitgefühl für sich selbst zur Selbstablehnung bzw. zur Ablehnung der eigenen Person. Dadurch entwickeln viele Menschen, die ihre Angst verdrängt haben, auch eine Form von Selbsthass. Wie man sich anderen Menschen bzw. Lebewesen gegenüber verhält, hängt also in hohem Maße davon ab wie gut oder schlecht das Verhältnis zur eigenen Person ist. Sich selbst keine Schwäche zu erlauben, bedeutet sich selbst nicht zu akzeptieren, wie man eben ist. Darum müssen diese Menschen sich immer selbst verbessern und in allem möglichst gut bzw. zumindest niemals unterlegen sein. Somit empfinden sie keine Selbstakzeptanz, denn eigenes Versagen wird möglichst überspielt aber auf keinen Fall toleriert. Da aber jeder Mensch am Ende nur Mensch bleibt und schwach sein oder versagen ganz natürlich dazu gehören, empfinden solche Personen ein permanentes inneres Missempfinden und Unwohlsein. Im Laufe der Zeit entwickelt sich daraus also eine Form von Selbsthass. Und man kann sagen, dass auch dieser Selbsthass letztendlich den Menschen erst dazu befähigt und am Ende auch dazu treibt, anderen absichtlich Schaden zuzufügen. Man hasst sich dann nämlich sozusagen in anderen.
Zusammenfassend kann man also festhalten, dass die Verdrängung von Angst zu einem inneren Druck führt, der dann auch den Kontakt zu den übrigen Emotionen wie z. B. dem Mitgefühl stört und verschlechtert. Ein mangelhafter Kontakt zum Mitgefühl wiederum bewirkt eine emotionale Distanz zu Mitmenschen und Mitgeschöpfen. Diese Distanz ist die emotionale Voraussetzung für eine böse Tat. Denn bevor man einem anderen Menschen oder Mitgeschöpf überhaupt erst Böses tun kann, muss man sich zuvor von ihm emotional distanziert haben. Demnach sind Menschen, die ihre Angst verdrängt haben, durch den daraus resultierenden Abbau von Mitgefühl und dem damit wiederum einher gehenden Aufbau von Distanz zur Umwelt, in der Disposition Böses zu tun.