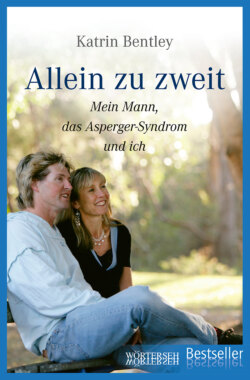Читать книгу Allein zu zweit - Katrin Bentley - Страница 12
3
ОглавлениеAn einem schönen Frühlingstag im Jahr 1980 hielt ich endlich das Lehrerdiplom in den Händen und begann sofort mit der Stellensuche. Wenig später bekam ich eine Zusage von der Primarschule in Jegenstorf, einem Bauerndorf nördlich von Bern. Dort hatte ich am Anfang nur ein Zimmer und verbrachte das Wochenende nach wie vor in Thun. Oft fuhr ich sogar an freien Nachmittagen heim in die elterliche Wohnung und korrigierte die Arbeiten der Kinder am See oder zu Hause auf der Terrasse mit Sicht auf die Berge.
Mein Beruf gefiel mir ausgezeichnet, er erfüllte mein Bedürfnis nach Abwechslung und Kreativität. Ich liebte den Umgang mit den Kindern und konnte ihren Wunsch nach Bewegung und Fröhlichkeit und ihre Freude an Geschichten nur allzu gut verstehen. Wurden sie beim ersten Schnee unruhig, unterbrach ich schnell die Rechenstunde und ging mit ihnen nach draußen, wo sie sich nach Herzenslust austoben konnten. Saßen sie später mit roten Wangen und glänzenden Augen wieder an ihren Pulten, lösten sie die Aufgaben schneller denn je.
Ich war mit Leib und Seele Lehrerin und nahm mir fest vor, immer ausgeglichen, fröhlich und geduldig vor meinen Schülern zu stehen. Sie zu verängstigen, lag mir fern, denn Angst spornt nicht an, sie blockiert, das wusste ich genau. Stattdessen versuchte ich, ihre Freude am Lernen zu wecken und ihnen Selbstvertrauen zu geben. Am Beispiel des Hausbaus zeigte ich ihnen, wie gut es ist, dass wir alle unterschiedliche Fähigkeiten haben. Ein Architekt allein kann kein Haus bauen, es braucht auch Elektriker, Schreiner, Maurer und Büropersonal, damit das Projekt gelingt. Die Kinder und ich waren nicht bloß eine Klasse, sondern eher eine Familie, bei der Toleranz, gegenseitiges Verständnis, Motivation, Ehrlichkeit und gute Zusammenarbeit an erster Stelle standen.
Mit der Zeit übernahm ich auch sogenannt schwierige Schüler von anderen Lehrern. Ich machte das gern und freute mich, wenn ich sah, dass sie sich mit ein wenig Verständnis, klaren Abmachungen und Mithilfe der Klassenkameraden wieder integrieren ließen. Ich war damals Unterstufenlehrerin, aber bald einmal wandten sich auch ältere Schüler mit ihren Problemen an mich. Gern nahm ich mir Zeit für sie. Die Oberstufenlehrer lachten damals über meinen Erziehungsstil, ich ließ mich davon aber nicht beirren, weil ich sah, wie das Selbstvertrauen der Teenager wuchs und sie ihr Leben besser in den Griff bekamen. Dem Schulinspektor fiel mein Engagement und meine Freude am Lehrerberuf auf, und so wurde ich bereits mit knapp 23 Jahren Übungslehrerin. Ich durfte also künftigen Lehrern und Lehrerinnen in meiner Klasse das Unterrichten beibringen. Ich hoffte, dass sich meine Freude auf sie übertragen würde, und genoss es, wenn mir das gelang und sie über die anfänglichen Unsicherheiten hinweg zu ihrem eigenen Lehrstil fanden.
Ich war auch Mitglied einer weit über den Ort hinaus bekannten Amateurtheatergruppe, die unter anderem Stücke von Leo Tolstoi, Peter Shaffer, Gerhart Hauptmann und John Patrick in Mundart aufführte. Unsere Vorstellungen waren meist schon Wochen vor Spielbeginn ausverkauft. Drei Jahre lang spielte ich in verschiedenen Produktionen eine Hauptrolle. Das war zwar sehr zeitaufwendig, gleichzeitig aber auch sehr erfüllend. Oft stand ich fünf Abende in der Woche auf der Bühne und kam kaum je vor Mitternacht ins Bett. Ich versuchte auch, in meinen Schülern die Freude an der Schauspielerei zu wecken, und schrieb Musicals und Theaterstücke für sie, die sie dann am Ende des Jahres aufführten.
Mit 24 Jahren war ich vollkommen glücklich mit meinem Leben. Unter der Woche lebte ich nun in meiner eigenen gemütlichen, nordisch eingerichteten Dreizimmerwohnung in Jegenstorf, und an den Wochenenden fuhr ich nach Thun, um meine Familie und meine Freunde zu sehen. Dann, am 3. November 1984, es war ein Samstag, rief plötzlich meine Mutter in der Schule an und teilte mir bestürzt mit, dass mein Vater eine Lungenembolie erlitten habe. Ich ließ meine Klasse in der Obhut einer anderen Lehrerin und fuhr, so schnell ich konnte, ins Spital. Als man mich nicht zu meinem Vater ließ, wurde mir klar, wie ernst die Lage war: Die Ärzte kämpften um sein Leben.
Der Anblick meiner Mutter brach mir fast das Herz, wusste ich doch, wie sehr sie ihn liebte. Ich drückte ihre zitternden Hände und redete beruhigend auf sie ein, aber sie schien mich nicht zu hören und wimmerte nur leise vor sich hin. Zusammen mit meinem Bruder und seiner Frau warteten wir und hofften, dass sich alles zum Guten wenden würde. Aber je länger wir warteten, desto größer wurde unsere Besorgnis. Endlich ging die Tür auf, ein Oberarzt kam auf uns zu und teilte uns sachlich mit, dass es ihm leidtue – »Wir haben alles versucht, konnten ihm aber nicht helfen. Er ist vor fünf Minuten gestorben.« Das kann doch nicht sein!, wollte ich schreien, er war doch so fit, so gesund und so lebensfroh! Aber da hatte der Arzt das Zimmer bereits wieder verlassen, um sich um andere Leben zu kümmern.
Nie werde ich diesen Tag vergessen, an dem ich in der Intensivstation zum letzten Mal das Gesicht meines geliebten Vaters sah. Ich stützte meine Mutter, die immer wieder versuchte, ihn aufzuwecken, und nahm tränenüberströmt Abschied von dem Mann, der meine Kindheit mit so viel Sonnenschein und Freude erfüllt hatte. Die Liebe meiner Eltern war so groß, und sie hatten noch so viele Pläne. Nun stand meine Mutter plötzlich allein da.
Die nächsten Tage verbrachte ich an ihrer Seite und versuchte, ihr etwas Halt zu geben, dabei hatte ich selber keinen mehr. Starr saß ich am Tag der Beerdigung, an dem sich mindestens 700 Menschen in der Thuner Stadtkirche versammelt hatten, um Abschied von meinem Vater zu nehmen, neben meiner Mutter und versuchte, mich auf die vielen Reden zu konzentrieren. Mein Vater war ein fröhlicher, positiver Mensch und hatte sich sein Leben lang für das Wohl seiner Mitmenschen eingesetzt. Er war mein Freund, mein Vorbild und meine Inspiration.
Mein Vater war im Spätherbst gestorben, der Winter danach war trostlos und schwierig. Ich besuchte meine Mutter, sooft ich konnte, aber die Lücke, die mein Vater hinterlassen hatte, klaffte wie eine offene Wunde zwischen uns. Ich versuchte, für sie da zu sein, hatte aber selbst keinen Ort, wo ich auftanken konnte. Sicher wären meine Freunde für mich da gewesen, aber ich fand keinen Trost darin, mit ihnen über meinen Verlust zu reden.
Kurz bevor mein Vater starb, hatte ich mich auf sein Drängen hin bei einem Hallentennisturnier angemeldet, an dem ich nun natürlich nicht teilnehmen wollte. Mein Tennislehrer ermunterte mich jedoch, dennoch anzutreten, was ich dann mit großem Widerwillen auch tat. Ich gewann das Turnier und damit die Tennistasche, von der mein Vater so geschwärmt hatte. Ich stellte sie daheim auf den Tisch und dachte an die schönen Zeiten, die mein fröhlicher Vater und ich im Tennisklub verbracht hatten. Er wäre stolz auf mich gewesen – aber eben, er war nicht mehr da.
Weihnachten verbrachten meine Mutter und ich allein, da mein Bruder arbeiten musste. Es war alles so trostlos ohne meinen Vater, aber wir versuchten, positiv zu bleiben – auch er hätte es so gewollt. Im Januar lernte ich meinen späteren Freund kennen. Ich mochte ihn auf Anhieb, und ihm schien es nicht anders zu ergehen. Er brachte wieder Fröhlichkeit in mein Leben, und das brauchte ich dringend, um für meine Mutter da sein zu können. Wir gingen Ski fahren, besuchten Rockkonzerte, spielten Tennis und kochten zusammen. Er war ein begeisterter Windsurfer und versuchte, auch mir diesen Sport näherzubringen, aber ich hatte kein Talent dazu. Viel lieber schwamm ich im See oder spielte mit Freunden am Ufer Frisbee.
Es war nicht meine erste Beziehung, aber so glücklich wie mit ihm war ich noch nie. Mein Freund wohnte mit einem Kollegen in der Nähe des Thunersees. Gern wäre ich mit ihm zusammengezogen, aber da er vor mir in einer sehr engen Beziehung gelebt hatte, wollte er jetzt, obwohl er mich liebte, erst einmal seine Freiheit genießen. Ich verstand, dass er viel Zeit mit seinen Kollegen und auf dem Wasser verbringen wollte, kam mir allerdings manchmal etwas überflüssig vor. Es lag mir fern, meinen Freund zu bedrängen, denn wenn wir uns sahen, hatten wir es immer schön. Aber bloß immer nur auf ihn warten mochte ich auch nicht, dazu war ich zu unternehmungslustig. Und so beschloss ich im Sommer 1986 spontan, mich auf eine Australienreise zu machen. Als ich meinen Freund fragte, ob er mitkommen wolle, überraschte mich seine Absage nicht. Er konnte nicht freinehmen und wollte später lieber einmal Südamerika sehen.
Als ich den Plan, nach Down Under zu reisen, mit meinen Freunden besprach, rieten sie mir ab. »Das ist ein Land für Männer«, sagten diejenigen, die sich bereits in das Land der giftigen Schlangen, Spinnen und Krokodile gewagt hatten. Aber ich lachte nur. Jetzt erst recht! »Du sprichst ja kaum Englisch«, war der Einwand meiner Mutter, und da musste ich ihr recht geben. Französisch und Italienisch konnte ich sehr gut, Englisch hingegen hatte ich in der Schule nicht gelernt. Das war allerdings kein Grund, mein Vorhaben aufzugeben. Im Gegenteil, ich hoffte, in Australien meine Englischkenntnisse verbessern zu können. Ich besuchte noch einen Anfängerkurs in Bern, lernte in der kurzen Zeit aber nicht viel mehr als »Where is the bus station?«.
Am 3. Januar 1987 war es dann endlich so weit. Ich saß im Flugzeug und warf einen letzten Blick auf die Felderlandschaft der Schweiz, die sich langsam entfernte. »Auf tolle drei Monate!«, sagte ich und hob schmunzelnd mein Glas Rotwein. Ich hatte keine Ahnung, dass diese Reise mein Leben für immer verändern würde.