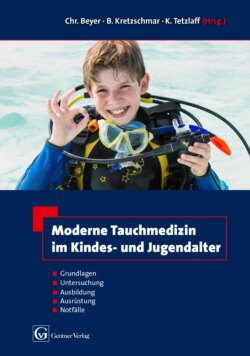Читать книгу Moderne Tauchmedizin im Kindes- und Jugendalter - Kay Tetzlaff - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление3 Entwicklung im Alter von 8 bis 18 Jahren
H. -R. Drunkenmölle
„Wir können Kinder nicht erziehen, sie machen uns doch alles nach.“
Karl Valentin
Das große Thema in der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen im Alter von 8 bis 18 Jahren ist die inter- und intraindividuelle Vielfalt. Die interindividuelle Variabilität beschreibt die Entwicklung zwischen den Kindern und Jugendlichen, die intraindividuelle Entwicklung die Verschiedenheit der Entwicklungsbereiche des einzelnen Kindes mit seinen Stärken und Schwächen.
Abb. 3.1: Wachstumsgeschwindigkeiten zwischen 2 und 18 Jahren; a: Jungen, b: Mädchen (Prader et al. 1989)
Die Entwicklung im Kindes- und Jugendalter ist nach Largo (2015) im Wesentlichen durch drei Prozesse charakterisiert: Wachstum, Differenzierung und Spezifizierung.
Wachstum:
Wachstum ist das hervorragende Merkmal kindlicher Entwicklung. Am Beispiel der körperlichen Wachstumsgeschwindigkeit wird die Dynamik in den verschiedenen Altersstufen deutlich (Abb. 3.1 a und b).
Differenzierung:
Entwicklung der geistigen Fähigkeiten wie z.B. Kommunikation, logisches Denken, räumliches Denken, Ausbildung der sekundären Geschlechtsmerkmale.
Abb. 3.2: Entwicklung des Kindes in seiner Umwelt (nach Cole et al. 2005)
Spezifizierung:
Festlegung bestimmter Fähigkeiten in der Pubertät, z.B. Ausbildung der Sprache auch in Abhängigkeit vom Umfeld des Kindes.
Die Entwicklung des Organismus, insbesondere auch des Zentralnervensystems, ist einerseits genetisch determiniert, andererseits umweltabhängig. Die Wechselwirkungen von Anlage und Umwelt sind aufgrund der Vielzahl biologischer, psychischer und sozialer Faktoren äußerst komplex.
Die Entwicklung des Kindes in seiner Umwelt wird in seiner Komplexität in Abb. 3.2 dargestellt.
Die interindividuelle Entwicklung wird von Largo (2015) beispielhaft in Abb. 3.3 beschrieben: „Mit 13 Jahren variiert das Entwicklungsalter um mindestens 6 Jahre zwischen den am weitesten entwickelten Jugendlichen und jenen, die sich am langsamsten entwickeln.“
Abb. 3.3: Interindividuelle Variabilität anhand des Entwicklungsalters im chronologischen Alter von 13 Jahren (Largo 2015)
Die intraindividuelle Entwicklung wird anhand der Kompetenzprofile von zwei 14-jährigen Jugendlichen in Abb. 3.4 und 3.5 (Largo 2015) deutlich.
Die körperliche, geistige und psychosoziale Entwicklung stimmt oft nicht mit dem chronologischen Alter überein. Das gemeinsame Merkmal ist der Unterschied. Mit 8 Jahren ist das erste Bezugssystem eines Kindes noch die Familie, im Jugendlichenalter dann die Gruppe der Gleichaltrigen, die Peer-Group, und damit die weitestgehende Ablösung von den Eltern.
Die biopsychosoziale Entwicklung von Jugendlichen wird in Tab. 3.1 nach Rutishauser und Navratil (2004) in wichtigen Bereichen veranschaulicht.
Abb. 3.4: Kompetenzprofil eines 14-jährigen Mädchens
Abb. 3.5: Kompetenzprofil eines 14-jährigen Jungen
| Entwicklungsbereich | Frühe Adoleszenz (10–13 Jahre) | Mittlere Adoleszenz (14–16 Jahre) | Späte Adoleszenz (17–20 Jahre und älter) |
| Körperentwicklung | Beginn Pubertät: sekundäre Geschlechtsmerkmale, rasches Wachstum | Wachstumsspurt, veränderte Körperform und -zusammensetzung, Akne, Geruch, Menarche, Spermarche | langsameres Wachstum, Körperreife beendet |
| Körperbefinden | Beschäftigung mit sich selbst und mit pubertären Veränderungen | Akzeptanz des veränderten Aussehens, Sorge um Attraktivität | Akzeptanz der pubertären Veränderungen |
| Sexualität | sexuelles Interesse übersteigt sexuelle Aktivität | vermehrter sexueller Drang, Experimentieren, Fragen der sexuellen Orientierung | Konsolidation der sexuellen Identifikation |
| Kognition und Moral | konkrete Operationen, konventionelle Moral | abstraktes Denken, Hinterfragen der konventionellen Moral, mit sich selbst beschäftigt | Idealismus / Absolutismus |
| Unabhängigkeit | weniger interessiert an den Aktivitäten der Eltern | Streben nach elterlicher Akzeptanz von mehr Unabhängigkeit | Wiederakzeptieren von elterlichen Wertvorstellungen und Ratschlägen |
| Gleichaltrige | Orientierung in gleichgeschlechtlichen Gruppen | Konformität mit Gleichaltrigen, Experimentieren von risikoreichem Verhalten | Gleichaltrigengruppen weniger wichtig, intime Beziehungen wichtiger |
Tab. 3.1: Biopsychosoziale Entwicklung von Jugendlichen (nach Rutishauser und Navratil 2004)
Suche nach Geborgenheit und Autonomie, soziale Akzeptanz und Selbstverwirklichung sind vorherrschende Themen in der Pubertät und Adoleszenz. Im Jugendalter hängt das soziale und emotionale Wohlbefinden in hohem Maße von der Akzeptanz in der Gleichaltrigengruppe ab.
„Die Pubertät ist noch einmal ein Höhepunkt im Erproben von Abgrenzung, Trennung, Autonomie und der Suche nach Identität.“ (v. Lüpke 1994). Nach Milani-Comparetti setzt die Entwicklung von Identität einen kontinuierlichen Dialog voraus. Ein für die Entwicklung wichtiger Antrieb ist die Suche nach dem Neuen, dem Unbekannten. Zwischen risikosuchendem („no risk – no fun“) und risikovermeidendem Verhalten zeigt sich eine große Bandbreite bei den Jugendlichen. Auch das Erkennen von Gefahren und von Reaktionen in Gefahrensituationen ist je nach Reifegrad individuell sehr unterschiedlich. „Risikoreiches Verhalten ist aus verhaltensbiologischer Sicht keine Fehlschaltung, sondern von der Natur so gewollt. Es gibt den jungen Menschen Mut und Kraft, Neues zu wagen. Gefahr droht besonders dann, wenn mit erhöhter Risikobereitschaft ein schwaches oder gar fehlendes Selbstwertgefühl kompensiert werden muss. Gefährdet sind vor allem Jugendliche, die in verschiedener Hinsicht ungenügend integriert und sozial akzeptiert sind.“ (Largo, Czernin 2015). Bei Sportarten mit hohem Gefährdungspotential wie Bergsteigen, Drachenfliegen oder Tauchen kann bei dieser Gruppe eine erhöhte Gefährdung entstehen. „Überstandene Gefahren steigern das Selbstwertgefühl und die Stellung in der Peer-Gruppe“ (Baumann 2013).
Für den Tauchsport können diese physiologisch erhöhte Risikobereitschaft und die zum Teil reflexhaften Reaktionen in Gefahrensituationen zu einer erhöhten Gefährdung führen.
Stressverhalten und Stressbewältigung (Coping) zeigen eine große Variabilität. Eine besondere Bedeutung hat die Resilienz, die Fähigkeit zur Bewältigung widriger Umstände, Veränderungen und Herausforderungen. Insbesondere die vulnerablen Übergänge von der Kindheit bis zur Adoleszenz, einschließlich der individuellen spezifischen Entwicklungsbesonderheiten, stellen eine große Herausforderung an die Bewertung der Tauchtauglichkeit von Kindern und Jugendlichen dar.
In der Adoleszenz kommt es zu komplexen Veränderungen in der Organisation und Funktion des Gehirns, besonders des Frontallappens. Dieser ist assoziiert mit Planung, Erinnerung, Assoziation, Entscheidungsfindung und Bewegungsplanung.
Permanente Veränderungen der Grob- und Feinmotorik und damit auch der Koordination betreffen auch die Selbst- und Fremdwahrnehmung. Dabei entstehen Unsicherheiten, die in individuell unterschiedlicher Weise kompensiert werden.
Auch die Impulskontrolle und die Selbstregulationsfähigkeiten, damit einhergehend Gefahrenerkennung und -abschätzung sind intraindividuell im gleichen chronologischen Alter sehr unterschiedlich.
Diese Aspekte sind für das Tauchen von Kindern und Jugendlichen von außerordentlicher Bedeutung.
Stufenmodelle der Entwicklung nach Piaget, Erikson u.a. sind wenig hilfreich für die Beurteilung der Tauchtauglichkeit von Kindern und Jugendlichen.
„Sicher ist, dass eine starre und verbindliche Altersgrenze nicht festgelegt werden kann. Im Gegenteil: Mehr noch als bei erwachsenen Tauchern spielen individuelle Unterschiede bei der Beurteilung der Tauchfähigkeit eine Rolle“ (Muth, Winkler, Beyer).