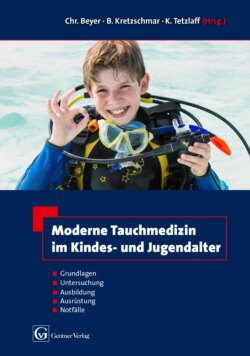Читать книгу Moderne Tauchmedizin im Kindes- und Jugendalter - Kay Tetzlaff - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление5 Hals – Nase – Ohren
A. Glowania, A. Lopez
5.1 Einleitung
Viele tauchmedizinische Probleme haben ihren Ursprung im Kopf-Hals-Bereich; dies ist bei dieser Altersgruppe nicht anders. Demzufolge besitzt diese Region eine besondere Bedeutung. Im Folgenden sollen neben anatomisch-physiologischen Grundlagen wichtige Krankheitsbilder und deren Auswirkungen auf die Ausübung des Tauchsports erläutert werden.
5.2 Anatomie und Physiologie
5.2.1 Ohr
Das Ohr gliedert sich in drei Abschnitte: äußeres Ohr, Mittelohr und Innenohr.
Äußeres Ohr
Zum äußeren Ohr wird der Abschnitt von der Ohrmuschel bis zum Trommelfell gezählt. Der äußere Gehörgang leitet als kanalartige Struktur den Schall von der Ohrmuschel zum Trommelfell. Er gliedert sich in einen äußeren knorpeligen und einen inneren knöchernen Abschnitt. Er wird durch eine Haut, die im äußeren Anteil Haare und Drüsen enthält und mit der Unterlage fest verwachsen ist, ausgekleidet. Bei Entzündungsvorgängen führt diese geringe Elastizität zu einer ausgeprägten Schmerzsymptomatik.
Das Ohrschmalz (Cerumen) besitzt eine Schutzfunktion für die Gehörgangshaut. Sein niedriger pH-Wert (sauer) erschwert das Wachstum von Bakterien und anderen Krankheitserregern. Der wachsähnliche, wasserabweisende Charakter verhindert das Aufweichen der Gehörgangshaut nach längerem Wasserkontakt. Solange die Selbstreinigungsfunktion ungestört bleibt, wird das Ohrschmalz, das u.a. aus Absonderungen der Drüsen im Gehörgangsbereich und aus Hautzellen besteht, vom inneren Anteil in Richtung Ohrmuschel bewegt.
Ein „Knick“ im Übergangsbereich zwischen knorpeligem und knöchernem Anteil macht die direkte Betrachtung unmöglich. Durch Zug an der Ohrmuschel wird dies korrigiert.
Abb. 5.1: Ohr im Querschnitt
Mittelohr (Paukenhöhle)
Das Mittelohr reicht vom Trommelfell bis zur knöchernen Begrenzung des Innenohres und enthält die 3 Gehörknöchelchen Hammer, Amboss und Steigbügel. Das gesunde Trommelfell weist eine perlmuttgraue Farbe auf und spannt sich trichterförmig als seitliche Begrenzung zum äußeren Gehörgang auf. Es nimmt die Schallwellen auf und überträgt sie auf die Gehörknöchelchenkette, welche wiederum eine Signalverstärkung vornimmt und die Wellen über das runde Fenster an das Innenohr weiterleitet.
Das Mittelohr ist von einer Schleimhaut ausgekleidet, die sich in das dahinterliegende Knochenzellsystem (Mastoid) ausdehnt.
Die Ohrtrompete (Eustachische Röhre/Tuba auditiva/Tuba pharyngotympanica) verbindet als schlauchähnliche Röhre das Mittelohr mit dem Nasenrachen (NR) und sorgt für die Belüftung bzw. den Druckausgleich im Mittelohr. Der untere Teil (2/3) besteht aus Knorpel und schließt mit zwei Schleimhautwülsten seine seitliche Nasenrachenmündung ab, die obere Verbindung zur Paukenhöhle ist knöchern (1/3). Der Übergangsbereich zwischen beiden Anteilen weist eine Engstelle auf (Isthmus). Im Nasenrachenbereich setzen willentlich beinflussbare Muskeln an, welche für die aktive Öffnung der Tube und somit für den Druckausgleich entscheidend sind. Im unteren Bereich setzt sich die respiratorische Schleimhaut der Nase fort, im oberen Anteil findet sich die Mittelohrschleimhaut. Es wird ein Sekret gebildet, das in Richtung Nasenrachen transportiert wird und so das Aufsteigen von Krankheitserregen aus dem Nasenrachen verhindern soll. Deshalb ist die Tube in Ruhe verschlossen.
Die Entwicklung der Tube ist zum Zeitpunkt der Geburt noch nicht abgeschlossen. Kinder bis zum 7./8. Lebensjahr besitzen eine flache, kurze und weite Tube (Götte). Erst anschließend kommt es zu einem Ansteigen des bis dahin flachen Neigungswinkels der Tube um ca. 15°. Die anatomischen Verhältnisse entsprechen damit weitgehend denen des Erwachsenen.
Ist die Belüftung über die Ohrtrompete nicht dauerhaft gewährleistet, kann es zu strukturellen Veränderungen des Mittelohres mit Trommelfelleinziehung und Sekretbildung bis zur Verklebung der Gehörknöchelchen kommen (siehe Paukenerguss / Paracentese, Paukendrainage).
Innenohr
Das Innenohr beinhaltet im Schutzblock des Felsenbeins, in knöchernen Aussparungen und eingebettet in flüssigkeitsgefüllte Schlauchsysteme die Sinneszellen des Hör- und Gleichgewichtsorgans. In der Hörschnecke (Cochlea) werden die mechanischen Reize – vermittelt über die Gehörknöchelchenkette – auf die Flüssigkeitssäule des Hörorgans übertragen und von spezialisierten Zellen in elektrische Impulse übersetzt sowie anschließend über den Hörnerv an das Gehirn weitergeleitet.
Das Gleichgewichtsorgan (Vestibularorgan) umfasst ein System aus drei bogenförmigen, flüssigkeitsgefüllten Röhren für die Wahrnehmung der Drehbewegungen sowie zwei zusätzliche Rezeptororgane für vertikale Bewegungen.
Eine Verbindung besteht zwischen dem flüssigkeitsgefüllten System des Innenohres und dem Liquorsystem des Gehirns (Aquaeduct).
5.2.2 Nase/Nasennebenhöhlen (NNH)
Die Nase liegt am Anfang des Atemtraktes. Sie geht in die Nasenhaupthöhle über. Im seitlichen und hinteren Bereich bestehen Verbindungen zu den Nasennebenhöhlen (NNH). Die Funktion der Nase besteht im Anwärmen, Befeuchten und Filtern der Atemluft. Diese wichtige Funktion der Nase bemerken wir meist erst, wenn z.B. bei einer Entzündung die Funktion nicht mehr erfüllt werden kann und wir gezwungen sind, über den Mund zu atmen. Die unmittelbaren Folgen sind Mundtrockenheit bis zu vermehrter, unangenehmer Speichelproduktion und schmerzhaften Schluckstörungen.
Die Nasenbinnenräume sind von Schleimhaut mit einem feinen oberflächlichen Härchensaum bedeckt. Das von den Zellen gebildete, die Schleimhautoberfläche bedeckende Sekret sammelt die über die Nase eingedrungenen Fremdstoffe und befördert sie mittels feinem Wimpernschlag in Richtung Rachen.
Im Bereich des Nasendaches befinden sich spezifische Nervenzellen, welche für die Geruchswahrnehmung verantwortlich sind.
Die Nasennebenhöhlen sind knöcherne Ausbuchtungen im Schädelknochen. Sie sind teilweise paarig angelegt und besitzen ebenfalls eine Schleimhautauskleidung. Über ihre Funktion wird spekuliert.
Abb. 5.2: Darstellung der Nasennebenhöhlen. Die Keilbeinhöhle liegt in der Tiefe des Schädels und ist hier nicht abgebildet.
NNH-Entwicklung
Bei der Geburt sind einzig die Siebbeinzellen (Sinus ethmoidales) bereits vollständig angelegt. Die Kieferhöhle (Sinus maxillaris) ist als kleine „Bucht“ ebenfalls schon vorhanden. Stirn- (Sinus frontalis) und Keilbeinhöhle (Sinus sphenoidalis) werden ca. ab dem 4. Lebensmonat angelegt, ihre vollständige Entwicklung erfolgt bis in die Pubertät hinein. Die Kieferhöhle entwickelt sich besonders ab dem 7./8. Lebensjahr, parallel zum Wechsel vom Milchzahngebiss des Kindes zum permanenten Gebiss des Erwachsenen. Diese Entwicklung dauert bis nach der Pubertät.
Physiologie des Druckausgleichs und Druckausgleichsmanöver
Ein ungehindertes Ein- und Ausströmen von Luft in den luftgefüllten Hohlräumen ist wichtige Grundvoraussetzung für den Druckausgleich. Eine Behinderung der Luftpassage führt zu Druckunterschieden zwischen Umgebung und luftgefüllter Körperhöhle (Unterdruck beim Abtauchen bzw. Überdruck beim Auftauchen). Aus dieser Fehlfunktion können druckbedingte Schäden an den Organen (Barotraumen) resultieren.
Im Kopf-Hals-Bereich sind die davon betroffenen Organe mit starrer Wandung die Nasennebenhöhlen und die Paukenhöhle. Während der Druckausgleich in den Nasennebenhöhlen ein passiver Prozess ist, erfolgt der Druckausgleich im Mittelohr aktiv, d.h., durch Aktivierung der an der Ohrtrompete ansetzenden Muskelgruppen beim Schlucken, Kauen bzw. bei Bewegungen der Kau- und Rachenmuskeln.
Verschiedene Möglichkeiten zur Durchführung eines Druckausgleichsmanövers sind bekannt.
Valsalva-Manöver: Das Valsalva-Manöver stellt die am häufigsten angewandte Form dar. Nach Verschluss von Mund und Nase wird beim Ausatmen ein Überdruck aufgebaut, der Luft vom Nasenrachen über die Ohrtrompete in die Mittelohrhöhle strömen lässt. Nachteilig ist, dass für die erfolgreiche Durchführung ein Überdruck im Thorax aufgebaut wird.
Am wirkungsvollsten sind die „einfachen Methoden“, der Druckausgleich durch Aktivierung der natürlichen muskulären Tubenöffner durch Schlucken oder Kieferbewegungen bei geschlossenem Mund.
5.2.3 Rachen
Der Rachen bildet eine muskuläre, röhrenförmige Struktur, die sich an den hinteren Teil der Nase bzw. der Mundhöle anschließt und eine Verbindung zu Luft- und Speiseröhre darstellt. Er gliedert sich in 3 Abschnitte: Nasenrachen, Mundrachen und Kehlkopfrachen.
Aufgrund des Kontaktes mit Krankheitserregern erfüllt der Rachen Abwehraufgaben und ist mit lokalen Ansammlungen von Abwehrgewebe ausgestattet. Dieses sogenannte lymphatische Gewebe konzentriert sich u.a. im Nasenrachen als „Polypen“ (Rachenmandel, Adenoide) sowie im Bereich des Mundrachens als „Mandeln“ (Gaumenmandeln, Tonsillen).
Insbesondere der Nasenrachenabschnitt stellt einen wichtigen Anteil dar: hier mündet im seitlichen Bereich die Ohrtrompete – der Verbindungsgang zum Mittelohr. Es bestehen aus anatomischen Gründen somit die Voraussetzungen für die Entstehung von Tubenbelüftungsproblemen – sei es durch aufsteigende Infektionen über die Ohrtrompete ins Mittelohr oder durch die Verlegung des Tubeneingangs durch vergrößerte Rachenmandeln.
Abb. 5.3: Rachen (Pharynx) im Querschnitt. Die im seitlichen Nasenrachenbereich mündende Ohrtrompete kann durch eine vergrößerte Rachenmandel (Adenoide) in ihrer Funktion beeinträchtigt werden.
5.3 Erkrankungen
5.3.1 Ohr
Äußeres Ohr
■ Gehörgangsfehlbildungen
Gehörgangsfehlbildungen sind selten. Mittels HNO-fachärztlicher Untersuchung können diese erkannt und entsprechende diagnostische Schritte eingeleitet werden, um Einschränkungen für die Tauchtauglichkeit beurteilen zu können.
■ Ohrschmalzpfropf (Cerumen obturans)
Ein Ohrschmalzpfropf kann den äußeren Gehörgang blockieren und einen Druckausgleich behindern und – im schlimmsten Fall – verhindern. Mögliche Folge ist ein Barotrauma des äußeren Ohres.
Um den natürlichen Ohrschmalztransport nicht zu stören, sollte zur Vorbeugung eine Reinigung des äußeren Gehörgangs mittels Q-Tips oder anderer mechanischer Hilfsmittel unterbleiben.
Bei bereits bekannter, vermehrter Bildung von Ohrschmalz ist der Gang zum Hals-Nasen-Ohren-Arzt vor Beginn von Tauchaktivitäten zu empfehlen. Dieser kann zum einen die reguläre Beschaffenheit von Gehörgang und Trommelfell überprüfen und ggf. festsitzende, trommelfellnahe Anteile entfernen.
Ob die Anwendung von Taucherohrentropfen die Bildung von übermäßigem Ohrenschmalz verhindern kann, ist nicht bekannt.
Abb. 5.4: Ohrenschmalzpfropf
■ Gehörgangsentzündung (Otitis externa diffusa)
Verschiedene Faktoren können zur Entstehung einer Gehörgangsentzündung beitragen [Wang et al. 2005]. Neben Bakterien sind Pilze bekannte Auslöser – meist auf der Grundlage, dass zuvor das Mikromilieu des äußeren Gehörgangs und die Produktion von Cerumen, z.B. durch dauerhaften Wasserkontakt, gestört worden sind. Als Folge dieser behinderten Barrierefunktion können Krankheitskeime leicht in das Gewebe eindringen. Ein weiterer, vielfach unbeachteter Faktor ist die Reinigung des Gehörgangs mit Wattestäbchen (Q-Tips) oder anderen mechanischen Hilfsmitteln. Es entstehen hierbei häufig Mikroverletzungen, die Wegbereiter einer Entzündung sind.
Dementsprechend tritt die Gehörgangsentzündung unter Wassersportlern, insbesondere Schnorchlern und Tauchern, häufig auf. Die Betroffenen klagen in der Anfangsphase über einen Juckreiz oder Brennen. Bei Fortschreiten der Entzündung kommt es zu Schmerzen sowie einer Schwellung der Gehörgangshaut, die bei schweren Verläufen die Ohrmuschel mit einbeziehen kann. Eine Flüssigkeitsabsonderung aus dem Gehörgang kann manchmal beobachtet werden.
Bei der Untersuchung zeigt sich eine geschwollene, verdickte Gehörgangshaut, die teilweise die Sicht auf das Trommelfell versperren kann. Manipulationen an der Ohrmuschel bzw. am Gehörgang oder die Mundöffnung und Kaubewegungen können schmerzhaft sein.
Die Behandlung besteht in der Säuberung des Gehörgangs und der Gabe von topischen Corticosteroiden, topischen Antibiotika in Form von Ohrentropfen und/oder alkoholhaltigen Zubereitungen in Tropfenform oder in Form von Streifeneinlagen (Alkoholstreifen). Bei Bedarf werden Schmerzmittel verabreicht. Bis zum vollständigen Abklingen der Entzündung ist ein Wasserkontakt zu vermeiden.
Um einer Entzündung vorzubeugen, sollte der Gehörgang nach dem Tauchen trocken gehalten werden und vor Zugluft (Mütze oder Stirnband) geschützt werden. Bei empfindlichen Personen kann der Gehörgang auch vorsichtig mittels eines Föhns getrocknet werden. Wie bereits zuvor erläutert, sollte man keine Q-Tips verwenden!
Prophylaktisch wird ebenfalls die Anwendung von sogenannten „Tauchertropfen“ empfohlen, die das Milieu des Gehörgangs wiederherstellen und Krankheitserreger abtöten sollen (siehe „Taucherohrentropfen“).
Abb. 5.5: Rötung und Verdickung der Gehörgangshaut, die mit weißlichem, schmierigem Sekret belegt ist. Das Trommelfell im Hintergrund ist nur teilweise erkennbar, aber entzündungsfrei.
Taucherohrentropfen
Zur Prophylaxe von Gehörgangsentzündungen wird Tauchern häufig während des Tauchurlaubs die Anwendung von speziellen Ohrentropfen (Tauchertropfen, Taucherohrentropfen) empfohlen. Ziel ist die Aufrechterhaltung bzw. Wiederherstellung eines physiologischen Gehörgangsmilieus unter gleichzeitiger Abtötung von Krankheitserregern, die sich z.B. vermehrt in ungechlorten Schwimmbecken und planktonreichem Wasser befinden.
In der Taucherszene kursieren diverse Rezepte mit unterschiedlichen Zusammensetzungen. Teilweise enthalten diese gehörgangsreizende bzw. gehörgangsschädigende Substanzen. Die wissenschaftliche Datenlage zur systematischen Anwendung ist dünn.
Es ist daher empfehlenswert, sich vor der Anwendung von einem HNO-Facharzt oder erfahrenen Taucherarzt beraten zu lassen.
■ Barotrauma des äußeren Gehörgangs
Der Verschluss des äußeren Gehörgangs, z.B. durch eine eng anliegende Kopfhaube oder eine korkenähnliche Ansammlung von Ohrschmalz (Ceruminalpfropf, siehe Abb. 5.4), kann beim Abtauchen zu einem Unterdruck zwischen dem durch den Fremdkörper abgeschotteten Bereich und dem Mittelohr führen. Dies äußert sich als ein Ziehen/Druckgefühl und Schmerzen beim Abtauchvorgang. Letztendlich besteht beim Nichtbeachten dieser Warnzeichen die Gefahr des Trommelfellrisses.
Prophylaktisch sollte der Gehörgang nicht mit mechanischen Hilfsmitteln gereinigt werden; in der Regel reicht die Spülung mit körperwarmem Süßwasser aus. Sinnvoll kann, v.a. bei der Neigung zu Gehörgangsentzündungen oder bei planktonreichem Wasser, die zusätzliche Anwendung von sogenannten Tauchertropfen sein (siehe Gehörgangsentzündung).
Der Gang zum HNO-Arzt vor einem geplanten Tauchurlaub sollte, insbesondere bei Menschen mit der Neigung zu vermehrter Ohrschmalzproduktion, so selbstverständlich sein wie die regelmäßige Kontrolle beim Zahnarzt!
Mittelohr
■ Akute Mittelohrentzündung (Otitis media acuta)
Die akute Mittelohrentzündung entsteht in der Regel als fortgeleitete, sogenannte „aufsteigende Entzündung“ aus dem Nasenrachen über die Ohrtrompete. Insbesondere bei Kindern prädisponiert dazu die noch unvollständige Tubenfunktion (siehe Anatomie des Mittelohres). Des Weiteren kann die Entzündung über den Gehörgang auf das Trommelfell übergreifen bzw. durch eine Trommelfellruptur in das Mittelohr gelangen.
Therapeutisch wird mit abschwellenden Nasentropfen, antiinflammatorisch-analgetischen Medikamenten sowie Antibiotika behandelt.
Im Rahmen einer akuten Otitis media besteht keine Tauchtauglichkeit. Nach Abheilung und Nachweis der regelrechten Tubenbelüftung kann wieder getaucht werden.
■ Chronische Mittelohrentzündung (Otitis media chronica)
Die chronische Mittelohrentzündung entwickelt sich auf dem Boden einer dauerhaften Mittelohrbelüftungsstörung und führt langfristig zu einem krankhaften Umbau der Mittelohrstrukturen. In manchen Fällen sind sanierende Operationen erforderlich, um den Krankheitsprozess aufzuhalten und die Schäden zu korrigieren.
Bezüglich einer Tauchtauglichkeit entscheidet der (taucherfahrene) HNO-Facharzt.
■ Mittelohrbarotrauma
Im Rahmen einer Tubenventilationsstörung (z.B. durch eine infektbedingte Schwellung der Tubenauskleidung) kommt die Belüftung des Mittelohres zum Erliegen. Eine Druckzunahme beim Abtauchen führt nach dem Gesetz von Boyle-Mariotte zu einer Verkleinerung des Volumens im Mittelohr. Als Folge entsteht ein Unterdruck, der zunächst zu einer Schleimhautschwellung im Mittelohrbereich sowie zu einem „Ansaugen“ des Trommelfells in Richtung Paukenhöhle führt. Im weiteren Verlauf kann es entweder zum Einreißen kleiner Blutgefäße in der Mittelohrschleimhaut mit Bildung eines Paukenergusses oder zum direkten Trommelfellriss kommen. In der Regel wird der Unterdruck durch das Flüssigkeitsvolumen ausgeglichen und somit ein nachfolgender Trommelfellriss verhindert. Die Betroffenen klagen über Ohrenschmerzen, Hörminderung und Schwindel (Vertigo) bzw. Ohrgeräusche (Tinnitus). In einigen Fällen kann es, inbesondere bei vorgeschädigten Trommelfellen, zur Trommelfellruptur kommen.
Somit wird ersichtlich, dass mit einem akuten bzw. chronischen Atemwegsinfekt, der eine Tubenbelüftungsstörung bewirkt, nicht getaucht werden sollte.
Druckausgleichsprobleme und Tubenfunktionsstörungen
Wie bereits dargestellt, ist die geordnete Funktion der Mittelohrbelüftung über die Ohrtrompete nicht nur für den Druckausgleich, sondern auch für den Abfluss des durch die Mittelohrschleimhaut gebildeten Sekrets erforderlich. Wissenschaftliche Daten zeigen, dass insbesondere beim Kindertauchen ein erhöhtes Risiko für Mittelohrbarotrauma [Winkler et al. 2011] besteht. Die Ursachen einer Fehlfunktion sind vielfältig. Es lassen sich vorübergehende von permanenten Störungen unterscheiden.
Vorübergehende Belüftungsstörungen ergeben sich z.B. aus entzündlichen Veränderungen bei viralen Infekten (akuter Tubenmittelohrkatarrh) und allergisch bedingten Entzündungen der Nasenschleimhaut (allergische Rhinitis). Rachenmandelvergrößerungen (Adenoide), die bei jüngeren Kindern gehäuft auftreten, Verbiegungen der Nasenscheidewand (Septumdeviation) oder eine Vergrößerung der unteren Nasenmuscheln (Nasenmuschelhyperplasie) können zu einer chronischen Tubenbelüftungsstörung führen. Gleichfalls kann die Ursache einer Störung in einem fehlerhaften anatomischen Aufbau der Ohrtrompete und ihrer ansetzenden Muskelstrukturen (z.B. Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte) beruhen.
Die Betroffenen klagen über ein Druck- oder Völlegefühl im Ohr, Ohrgeräusche (Tinnitus) und Hörminderung („Watte im Ohr“), Gleichgewichtsstörungen oder rezidivierende Mittelohrentzündungen. Ein Druckausgleichsmanöver ist erschwert oder fällt negativ aus.
Barotraumen lassen sich verhindern, indem man mit Erkrankungen, die eine Störung der Mittelohrbelüftung nach sich ziehen, nicht tauchen geht sowie stets frühzeitig – an der Oberfläche beginnend – den Druckausgleich durchführt. Sollte dies nicht (unproblematisch) möglich sein, sollte der Tauchgang beendet werden!
■ Paukenergüsse (Sero- bzw. Seromucotympanon)
Als Paukenergüsse werden Flüssigkeitsansammlungen im Mittelohr bezeichnet. Sie sind das Ergebnis einer anhaltenden mangelhaften Belüftung des Mittelohres über die Eustachische Röhre, welche zu einem Umbau der Mittelohrschleimhaut mit Sekretbildung führt. Ursächlich können bei dieser Erkrankung, die v.a. Kinder betrifft, beispielsweise Fehlbildungen und Entwicklungsstörungen im Bereich der Ohrtrompete, Adenoide oder akute bzw. chronische Entzündungen im Mittelohr, Nasenrachen oder der Ohrtrompete sein.
Die Behandlung kann medikamentös oder auch operativ (siehe Paracentese und Paukendrainage) erfolgen.
Behandlung chronischer Tubenventilationsstörungen durch Tubendilatation
Die Aufdehnung der Ohrtrompete (Tubendilatation) ermöglicht bei chronischen Tubenventilationsstörungen die Wiederherstellung der Mittelohrbelüftung. Seit ca. 6 Jahren ist diese Methode verfügbar. In Allgemeinanästhesie werden durch Einführen eines Ballonkatheters im unteren Mündungsbereich der Ohrtrompete und anschließende Aufdehnung mittels eines Ballons Verengungen in diesem Bereich beseitigt.
Zu Anfang wurde diese Methode nur bei Erwachsenen angewandt; inzwischen gibt es auch Studiendaten aus der Behandlung bei Kindern.
Abschließend muss festgehalten werden, dass aktuell nur wenige Langzeitdaten zu dieser Methode existieren [Krause].
Innenohr
■ Innenohrbarotrauma (IEBT) / Innenohrdekompressionserkrankung (IEDCS)
Tubenventilationsstörungen bergen neben der Gefahr eines Mittelohrbarotraumas zusätzlich das Risiko eines Innenohrbarotraumas (IEBT). Bei verstärkt ausgeführtem Vasalvamanöver kann dabei die schlagartig einsetzende ausgelöste Druckwelle zum einen indirekt über eine verstärkte Auslenkung der Gehörknöchelchenkette, zum anderen über eine direkte Schädigung der Rundfenstermembran zu einem druckbedingen Innenohrschaden mit Einblutung in die flüssigkeitsgefüllten Binnenräume oder zum Zerreißen der zarten Strukturen führen.
Klinisch macht sich dies in Form eines Drehschwindels mit begleitender Übelkeit und Brechreiz, Hörminderung und Tinnitus bemerkbar. Eine wichtige Differentialdiagnose dieses Krankheitsbildes stellt die Innenohrdekompressionserkrankung (IEDCS) dar, die in vielen Fällen ein ähnliches Beschwerdebild aufweist. Wichtigste Unterschiede sind, dass bei der IEDCS dekompressionspflichtige Tauchgänge erfolgten und in der Regel keine Druckausgleichsprobleme stattgefunden haben.
Schwindel (Vertigo)/Störungen des Gleichgewichts
Viele Taucher hatten in der Vergangenheit schon damit zu tun: Schwindel (Vertigo). Während in den meisten Fällen der Schwindel als eher harmlos einzustufen ist, gibt es Formen, die einer besonderen Beachtung bedürfen.
Schwindel ist keine eigenständige Erkrankung, sondern ein Symptom, das aus dem Zusammenspiel verschiedener Informationsquellen (u.a. visuelle Eindrücke, Rezeptoren in Muskeln und Gelenken und dem Gleichgewichtsorgan im Innenohr), welche im Gehirn zusammengeführt und ausgewertet werden, entsteht. Bei nicht deckungsgleichen Befunden aus den unterschiedlichen Informationszentren wird dieses „Ungleichgewicht“ als Schwindel empfunden.
Neben „harmlosen“ Formen wie dem „Schwindelgefühl“ nach einem zügigen Aufstehen aus liegender Position oder demjenigen, das sich aus Verspannungen der Halswirbelsäule ergibt [Muth 2013], findet man insbesondere 2 andere Formen häufig beim Tauchen, den alternobaren Schwindel bzw. den kalorischen Schwindel.
Der alternobare Vertigo entsteht durch einen zeitlich verzögerten Druckausgleich zwischen rechtem und linkem Mittelohr, z.B. beim Auftauchen, der zu einer Reizung des Gleichgewichtsorgans führt. Von einem kalorischen Vertigo spricht man, wenn es zu einer seitendifferenten Reizung des Gleichgewichtsorgans, z.B. durch kaltes Wasser in einem von beiden Gehörgängen, kommt. Beide Formen sind von kurzer zeitlicher Dauer und primär harmlos. Sie sind abzugrenzen von den schwerwiegenderen Formen (siehe Innenohrbarotrauma/Innenohrdekompressionserkrankung). Diese Schwindelformen zeichnen sich dadurch aus, dass der Schwindel permanent bestehen bleibt und Symptome wie Ohrgeräusche und/oder eine Hörminderung gleichzeitig hinzutreten. Hier ist eine dringende Abklärung durch einen HNO-Facharzt erforderlich!
5.3.2 Nase/Nasennebenhöhlen (NNH)
Allergische Rhinitis (Rhinitis allergica)
Eine allergische Entzündung auf Inhalationsallergene wie z.B. Baum- und Graspollen, Schimmelpilze, Tierhaare oder Hausstaubmilben führt nach Allergenkontakt zu einer Schwellung der Nasenschleimhäute mit Blockade der Nasenatmung, nasalem Juckreiz und vermehrter Bildung eines klaren Sekrets. Wie zuvor geschildert (siehe Anatomie und Physiologie der Ohrtrompete), ist der untere Anteil der Tube mit dem gleichen Gewebeüberzug wie in der Nase ausgekleidet – dementsprechend reagiert diese auch mit und kann zu Tubenventilationsstörungen führen.
Klassische Medikamente wie Antihistaminika sind zur Behandlung ungeeignet, da sie Müdigkeit und Konzentrationsstörungen auslösen können. Empfohlen werden cortisonhaltige Nasensprays. Bei ungenügender Mittelohrbelüftung sollte mit dem Tauchen ausgesetzt werden!
Akute Nasennebenhöhlenentzündung (Rhinosinusitis acuta)
Die akute Rhinosinusitis wird in mehr als 80% der Fälle durch eine Virusinfektion ausgelöst. Durch Schwellung der respiratorischen Schleimhaut kommt es zu einer Minderbelüftung des NNH-Systems mit nachfolgender Sekretbildung und damit zu einer weiteren Verschlechterung der Belüftung. Daher ist das NNH-System in dieser Situation nicht in der Lage, ausreichend und adäquat auf Änderungen des Umgebungsdrucks zu reagieren. Es besteht keine Tauchtauglichkeit.
Therapeutisch werden Dekongestiva, analgetisch-antiinflammatorische Medikamente sowie bei bakterieller Superinfektion Antibiotika eingesetzt.
Chronische Nasennebenhöhlenentzündung (Rhinosinusitis chronica)
Für die chronische Rhinosinusitis gilt das gleiche wie für die akute Entzündung. Bei Behinderung des Druckausgleichs bzw. nachgeschalteter Blockade der Mittelohrbelüftung besteht keine Tauchtauglichkeit.
Die Behandlung umfasst neben konservativen Maßnahmen in vielen Fällen auch Operationen zur Beseitigung von Engstellen im Verbindungsbereich der Nasennebenhöhlen mit der Nasenhaupthöhle.
5.3.3 Rachen
Rachenentzündung (Pharyngitis)/Mandelentzündung (Tonsillitis)
Eine akute Entzündung im Mund-Rachen-Raum stellt eine Kontraindikation für das Tauchen dar.
5.3.4 Sonstiges
Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte
Fehlbildungen im Kopf-Gesichts-Bereich, wie z.B. bei Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalten, betreffen oftmals auch die Konfiguration der Ohrtrompete. Häufig leiden die kleinen Patienten an permanenten Mittelohrbelüftungsstörungen mit den entsprechenden Folgeerscheinungen wie wiederkehrenden Paukenergüssen, die allerdings aufgrund der fehlgebildeten Strukturen ein Dauerproblem darstellen. Daraus ergibt sich, dass Tauchen in diesen Fällen nicht zu empfehlen ist.
5.4 Operationen
5.4.1 Adenotomie (AT)
Bei Kindern und Jugendlichen finden sich häufig Vergrößerungen des lokalen lymphatischen Abwehrgewebes im Kopf-Hals-Bereich. Es dient der Abwehr und Bekämpfung von Krankheitserregern, die über die Nase bzw. den Mund in unseren Körper gelangen. Diese sogenannten „Kinderpolypen“ (Adenoide) können bei Vergrößerung zu einer Verlegung der Mündungsstellen der Ohrtrompete im seitlichen Nasenrachenbereich führen und nachfolgend Druckausgleichstörungen bzw. aufsteigende Infekte zum Mittelohr bewirken.
In vielen Fällen kann die operative Entfernung dieses Gewebes zur Lösung der Problematik führen. Die Adenotomie ist eine Routineoperation, die in Allgemeinanästhesie durchgeführt wird.
Eine Tauchtauglichkeit ist nach wiederhergestellter Mittelohrbelüftung, die sich durch einen unproblematisch durchzuführenden Druckausgleich zeigt, und abgeschlossener lokaler Wundheilung nach ca. 4–6 Wochen möglich.
5.4.2 Tonsillektomie (TE)/Tonsillotomie (TO)
Die Vergrößerung des lymphatischen Abwehrgewebes im Mundrachen kann ebenso zu Problemen führen wie rezidivierende Entzündungen des Mandelgewebes.
Von einer chronisch-rezidivierenden Mandelentzündung (Tonsillitis) spricht man bei mehrfach pro Jahr wiederkehrenden, antibiotikapflichtigen Entzündungen.
Eine Entfernung des Gewebes (Tonsillektomie) in Allgemeinnarkose kann sinnvoll sein, da die ständige Ausschüttung entzündlicher Botenstoffe und Stoffwechselprodukte auch zu dauerhaften Veränderungen an anderen Orten im Organismus führen kann.
Die Teilentfernung der Tonsillen („Mandelkappung“, Tonsillotomie) wird bei einer Vergrößerung der Tonsillen empfohlen, wenn in der Vergangenheit keine gehäuften Entzündungen auftraten, aber aufgrund der Größe der Tonsillen andere Beschwerden ausgelöst werden.
Für die Tauchtauglichkeit gilt ebenfalls, dass die lokale Wundheilung abgeschlossen sein muss (keine Beläge mehr) und eine normale körperliche Belastungsfähigkeit wiederhergestellt ist. Dies ist in der Regel nach 4–6 Wochen der Fall.
5.4.3 Paracentese (PC)/Paukendrainage (PD)
Unter Paracentese versteht man die kontrollierte Trommelfelleröffnung durch einen Schnitt. Diese Maßnahme erfolgt z.B. bei behandlungsresistenten Ansammlungen von Flüssigkeit oder bei dauerhaften Belüftungsstörungen des Mittelohres. Unter bestimmten Voraussetzungen wird dabei ein kleines Röhrchen eingesetzt, das die Schnittöffnung offenhält (Paukendrainage).
Getaucht werden kann erst nach Entfernen der Drainage sowie vollständiger, stabiler Verheilung des Loches im Trommelfell. Natürlich muss der Druckausgleich unkompliziert möglich sein!
Abb. 5.6: Paukendrainage
5.4.4 Mittelohr-Operationen
Für den ausschließlichen Verschluss eines Trommelfelldefektes (Tympanoplastik Typ I/Myringoplastik) wird gefordert, dass eine stabil verheilte Narbe vorliegt. Dies kann durch eine „Unterfütterung“ mit körpereigenem Gewebe in Lokalanästhesie oder Allgemeinnarkose erfolgen. Ziel ist ein stabil eingeheiltes Transplantat, das einem Druckausgleichsmanöver unproblematisch standhält.
Die Bandbreite der weiteren Mittelohroperationen ist vielfältig, die daraus ableitbaren Einschränkungen für eine nachfolgende Tauchtauglichkeit erfordern dementsprechend eine differenzierte Betrachtung, welche den Rahmen dieses Beitrags sprengen würde. Es wird daher auf die Standardwerke zur Beurteilung der Tauchtauglichkeit im HNO-Bereich [Klingmann 2012] verwiesen.
5.4.5 Cochlea-Implantation (CI)
Das Einsetzen eines Cochlea-Implantats erfolgt bei Kindern wie Erwachsenen bei Ertaubung bzw. ausgeprägter Schwerhörigkeit.
Generell kann eine grundsätzliche Aussage über eine Tauchtauglichkeit nicht gegeben werden, da sich nicht alle Hersteller diesbezüglich äußern.
5.4.6 Nasenoperationen (Nasenscheidewandoperation, Nasenmuschelverkleinerung, Nasennebenhöhlenoperation)
Operationen am Nasenskelett bzw. den Nasennebenhöhlen sind bei Kindern und Jugendlichen selten erforderlich.
Bei chronischen Nasenatmungsbehinderungen und einer Vergrößerung der unteren Schwellkörper an der seitlichen Nasenwand (Nasenmuschelhyperplasie), wie sie beispielsweise bei einer Inhalationsallergie auftreten, kann eine operative Verkleinerung der unteren Nasenmuschel hilfreich sein. Dabei werden verschiedene Techniken eingesetzt; der Eingriff kann in Lokalanästhesie bzw. Allgemeinanästhesie erfolgen.
Unter besonderen Umständen wird in dieser Altersgruppe eine Korrektur der Nasenscheidewand (Nasenseptum-Operation) oder die operative Freilegung der Belüftungsspalten zu den Nasennebenhöhlen durchgeführt (Nasennebenhöhlen- bzw. NNH-OP).
Je nach Ausmaß der operativen Maßnahmen ist Tauchen nach 6–12 Wochen wieder möglich. Grundbedingung ist die vollständige Wundheilung mit Fehlen von Krusten und die ungehinderte Mittelohrbelüftung. Die Beurteilung sollte durch einen tauchmedizinisch erfahrenen HNO-Facharzt erfolgen.
5.5 Tauchtauglichkeit
Aus HNO-fachärztlicher Sicht ist bei den nachfolgenden Befunden bzw. Beschwerden keine Tauchtauglichkeit gegeben. Eine fachärztliche Untersuchung, ggf. weitere Diagnostik und Behandlung ist anzustreben.
■ Trommelfellperforation
■ nicht verheilter Trommelfellschnitt/Paukendrainage
nicht verheilter Trommelfellschnitt/Paukendrainage
■ atrophe Trommelfellnarbe
■ akute äußere Gehörgangsentzündung (Otitis externa acuta)
■ akute bzw. chronische Mittelohrerkrankungen mit Tubenventilationsstörungen
■ Schwindel und Gleichgewichtsstörungen
■ akute bzw. chronische Rhinosinusitis
■ Einnahme bestimmter Medikamente (z.B. abschwellende Nasentropfen, Antihistaminika)
Bei in der Vergangenheit durchgeführten Mittelohroperationen sollte nach gründlicher Untersuchung durch den taucherfahrenen HNO-Facharzt über eine Tauchtauglichkeit entschieden werden.
5.6 Zusammenfassung
Die Erkrankungen der Hals-Nasen-Ohren-Region besitzen für die Tauchtauglichkeit eine besondere Bedeutung [Muth et al. 2002, Muth et al. 2007, Ornhagen 2004, Winkler et al. 2011, Klingmann 2011]. Da viele Probleme durch eine vorausgehende Untersuchung erkennbar und auch behandelbar sind, sollte vor geplanten Tauchaktivitäten bei Kindern und Jugendlichen der Gang zum HNO-Facharzt stehen. Dieser kann im Rahmen einer Befunderhebung, zu der neben der mikroskopischen Trommelfelluntersuchung auch eine Funktionsprüfung der Ohrtrompete sowie (orientierende) Hör- und Gleichgewichtsuntersuchung gehören, vorhandene Probleme identifizieren und ggf. eine Behandlung einleiten.
Dr. Andreas Glowania und Dr. Angel J. Lopez
Arbeitsgemeinschaft „Flug- und Tauchmedizin“,
Österreichische Gesellschaft für HNO-Heilkunde und Kopf-Hals-Chirurgie tauchmedizin@hno.at