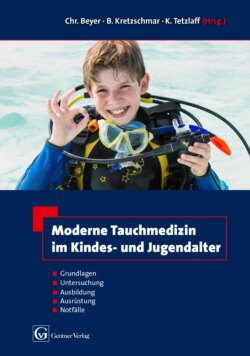Читать книгу Moderne Tauchmedizin im Kindes- und Jugendalter - Kay Tetzlaff - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление4 Tauchsportärztliche Untersuchung – Anleitung
Chr. Beyer
Die Tauchtauglichkeitsuntersuchung von Kindern und Jugendlichen bedeutet für den Untersucher eine besondere Herausforderung. Bei einer Altersspanne von 8 Jahren bis zu 18 Jahren bestehen nicht nur große Unterschiede zwischen den einzelnen Altersgruppen, sondern auch individuelle Unterschiede innerhalb der einzelnen Altersgruppen sind zu berücksichtigen. Dabei kann zum Beispiel ein 13-jähriger Jugendlicher den Entwicklungsstand eines 10-Jährigen oder eines 16-Jährigen haben. Es gilt also bei der Tauchtauglichkeitsuntersuchung festzustellen, ob sich das Kind mit seiner körperlichen und geistigen Entwicklung innerhalb seiner Altersgruppe befindet oder ob es bedeutsam retardiert bzw. akzeleriert ist. Entscheidend ist immer die Frage: Kann dieses Kind oder der Jugendliche mit seinen körperlichen und geistigen Fähigkeiten den Tauchsport gefahrlos ausüben?
Es wurde deshalb ein Untersuchungsbogen entwickelt, der in komprimierter Form einen Eindruck von der körperlichen und geistigen Entwicklungsstufe des Kindes bzw. Jugendlichen geben kann, so dass am Ende der Untersuchung eine Beurteilung der Tauchtauglichkeit möglich ist. Besonderer Schwerpunkt wurde auf die Familien- und Eigenanamnese (Vorgeschichte) gelegt, um bereits im Vorfeld bestehende Erkrankungen oder Risiken zu erkennen. Zusätzliche technische Untersuchungen vervollständigen die Diagnostik.
Dieser Untersuchungsbogen wurde erstmalig 2009 publiziert (CAISSON 24. Jg., Heft 2/2009) und bei dem Treffen der Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendtauchen der Gesellschaft für pädiatrische Sportmedizin 2013 in Eisenach modifiziert. Der aktuelle Untersuchungsbogen kann von der Homepage der GTÜM und der GPS kostenfrei heruntergeladen werden (siehe S. 188 Internetadressen).
Wie gestaltet sich nun der Ablauf der Untersuchung?
Das Kind kann zusammen mit seinen Eltern und der Jugendliche allein die erste und zweite Seite des Untersuchungsbogens ausfüllen (das spart auch Zeit für den Untersucher). Danach können die technischen Untersuchungen wie Größe, Gewicht, Errechnen des BMI, Blutdruck, EKG und Lungenfunktion durchgeführt werden. Der Blutdruck sollte möglichst nach einer Ruhephase (zum Beispiel nach dem EKG) in halbliegender Position mit der Alters- und Größen-entsprechenden Manschette durchgeführt werden. Bei der EKG-Auswertung sind Normwerte für das entsprechende Alter zu berücksichtigen. Gleichzeitig sollte im EKG auf seltene, aber gefährliche angeborene Erkrankungen (siehe Exkurs im Kapitel Herz-Kreislauf-System) geachtet werden. Bei der Auswertung der Lungenfunktion sind aktuelle Normwerte zu benutzen (siehe Kapitel Lunge, Atemwege).
Abb. 4.1: Untersuchungsbogen Seite 1
Abb. 4.2: Untersuchungsbogen Seite 2
Der nächste Schritt ist das persönliche Kennenlernen des Kindes /Jugendlichen und ein Gespräch über den ausgefüllten Anamnesebogen. Dabei können einige Fragen erneut aufgegriffen werden (Fitness, Angst beim Schwimmen/Tauchen, Medikamente, Vorerkrankungen), um bei den Antworten einen Eindruck von dem Kind/Jugendlichen zu bekommen. Möglichst mit den Eltern sollte die Frage nach plötzlichen Todesfällen in der Familie beantwortet werden. Bei der Familienanamnese ist es wichtig, nach hypertropher Cardiomyopathie, häufiger arterieller Hypertonie, Long-QT-Syndrom und Marfan-Syndrom (siehe Kapitel Herz-Kreislauf-System) zu fragen. Für die Evaluation von Risikobereitschaft oder Konzentrationsfähigkeit gibt es Fragebögen, deren Anwendung aber die Dauer der Untersuchung sprengen würde. Es wurden deshalb 4 Fragen in sehr komprimierter Form eingefügt, um möglichst Panikattacken, Konzentrationsstörungen und den oft übermächtigen Wunsch von tauchenden Eltern, das Kind möge doch ebenfalls Taucher werden, zu erkennen. Die Antwort auf die Frage „Ich möchte gern tauchen, weil …“ bietet oft einen guten Start in ein kurzes Gespräch über die Faszination des Sporttauchens. Bei dem Gespräch kann man vom Kind/Jugendlichen bereits einen Eindruck gewinnen von seiner Risikobereitschaft, seinem Verantwortungsgefühl gegenüber Anderen und von der Beurteilung der eigenen Fähigkeiten.
Größe, Gewicht und BMI sollten mit den entsprechenden Perzentilen-Kurven verglichen werden, um die körperliche Entwicklung im Verhältnis zur Altersgruppe zu beurteilen. Die Auswertung der durchgeführten technischen Untersuchungen wie Blutdruck, 12-Kanal-EKG und Lungenfunktion folgen den Empfehlungen der Fachgesellschaften unter Berücksichtigung der altersgerechten Normwerte. Bei pathologischen Werten sind weitergehende Untersuchungen beim Spezialisten, z.B. Kinder-Pulmologe (Spirometrie), Kinder-Kardiologe (Echokardiographie, Ergometrie), Radiologe (MRT, CT, Röntgen) oder Laboruntersuchungen erforderlich, bevor eine Tauchtauglichkeit bescheinigt werden kann.
Die körperliche Untersuchung gestaltet sich bei dem Untersuchungsbogen ähnlich wie beim Erwachsenen, jedoch mit einigen Besonderheiten:
Kopf und Halsbereich
Bei Zahnspangen sollte über mögliche Komplikationen mit dem Mundstück des Atemreglers gesprochen werden.
Brustkorb, Herz und Lunge
Eine bedeutsame Trichterbrust kann zu einer Beeinträchtigung der Lungen- und Herzfunktion führen und bedarf einer weitergehenden Abklärung. Ein auffälliges Herzgeräusch sollte, auch bei guter körperlicher Fitness, immer durch einen Kinder-Kardiologen weiter abgeklärt werden.
Abb. 4.3: Untersuchungsbogen Seite 3
Pubertätsstadien
Eine kurze und zurückhaltende Beurteilung der Pubertätsstadien bei Jugendlichen entsprechend den Tabellen nach Tanner (https://de.wikipedia.org/wiki/Tanner-Stadien) kann die Zuordnung zur entsprechenden Altersgruppe und das Verhältnis zum chronologischen Alter (altersgerecht, retardiert, akzeleriert) erleichtern.
Bewegungsapparat
Die höchste Wachstums-Geschwindigkeit (jährliche Größenzunahme) liegt bei Mädchen im Alter von 12–13 Jahren und bei Jungen um das 14. Lebensjahr (siehe Kapitel Entwicklung). Der pubertäre Wachstumsschub setzt bei Mädchen mit etwa 10 Jahren und bei Jungen mit 12 Jahren ein und dauert 3–4 Jahre. Daraus resultiert eine Anfälligkeit für Störungen und Schädigungen, die bei einer Untersuchung erkannt werden sollten (siehe Kapitel 3: Entwicklung, Kapitel 9: Bewegungsapparat, Anlagen).
Eine systematische kinderorthopädische Untersuchung (nach Hefti et al. 2015) beinhaltet:
| 1. | Körpergröße und Gewicht |
| 2. | Ganganalyse (mit/ohne Schuhe, Fersen-Zehen-Gang) |
| 3. | Untersuchung der Statik (Beckenstand, Bein-Fuß-Achsen, Trendelenburg-Zeichen) |
| 4. | Wirbelsäule (Schulterstand, Beckenstand, Taillendreiecke, sagittales Profil, frontales Profil, Vorneigen, Aufrichten, seitliche Beweglichkeit) |
| 5. | Obere Extremitäten (kursorische Prüfung der Beweglichkeit, Daumenhochschlagen) |
| 6. | Hüften (Beweglichkeit) |
| 7. | Knie (Beweglichkeit, Stabilität, Meniskuszeichen) |
| 8. | Füße (Rückfuß, Vorfuß, Wölbungen, Beweglichkeit) |
| 9. | Torsionen klinisch (Antetorsion, Unterschenkeltorsion, Fußachsen) |
| 10. | Prüfung der Kapsel-Band-Laxität (Überstreckbarkeit der Fingergrundgelenke auf über 90 Grad, der Ellenbogengelenke um mehr als 10 Grad, der Kniegelenke um mehr als 5 Grad, Daumen-Vorderarm-Abstand von weniger als 2 cm). |
Bei Verdacht auf Marfan-Syndrom sollten auch Daumenzeichen, Handgelenkszeichen und Gaumenform („gotisch“) geprüft werden. Das Ziel ist es, Groß-/Kleinwuchs, Gangstörungen, kongenitale Fehlbildungen, Skoliose, Hyperkyphosen, Beinlängendifferenzen, Achsenfehlstellungen an der unteren Extremität und Fußanomalien festzustellen. Die Untersuchung erscheint komplex, erfordert aber bei geübtem Untersucher nur wenige Minuten.
Bei der neurologischen Untersuchung gilt es, eine Auswahl aus vielen Untersuchungsmöglichkeiten zu treffen, um einen guten Überblick zu erhalten. Zu einer zügig durchführbaren neurologischen Untersuchung gehören: Prüfung der Nervenaustrittspunkte im Gesicht, Augenmotilität, Pupillen-Reaktion auf Licht, Muskeleigenreflexe an Armen und Beinen, Fein-/Grobmotorik („Fingertreppe“-Handgriff), Romberg-Stehversuch, Unterberger-Tretversuch und verschärfter Romberg-Stehversuch (Füße hintereinander mit vor der Brust verschränkten Armen und geschlossenen Augen, 1 Minute stehen). Die neurologische Untersuchung als Ausgangsbefund ist deshalb so wichtig, da viele Symptome einer Dekompressionskrankheit neurologische Symptome sind. Die Klinik kann einem akuten Schlaganfall ähneln! Die Kenntnis z.B. einer angeborenen Anisokorie (veränderte Pupille) ist daher sehr wichtig!
Starke Unruhe des Kindes/des Jugendlichen mit Hyperaktivität, „Herumkaspern“ und Nichtbefolgen von Aufforderungen gelten als Hinweis, dass das Kind bzw. der Jugendliche (noch) nicht die persönliche Reife für den Tauchsport besitzt und möglicherweise eine neurologische oder psychische Störung vorliegt. Im Gespräch mit den Eltern sollte dieser Sachverhalt eingehend besprochen und zu einer weitergehenden Diagnostik geraten werden.
Auf Seite 4 des Untersuchungsbogens werden alle Untersuchungsbefunde zusammengefasst, und es muss die Entscheidung getroffen werden, ob das Kind/der Jugendliche tauchtauglich ohne Einschränkungen – mit Einschränkungen – zur Zeit nicht tauchtauglich – oder dauerhaft nicht tauchtauglich ist. Bei den letzten drei Entscheidungen ist eine schriftliche Begründung erforderlich.
Beim Tauchsport im Kindes- und Jugendalter kann es (sehr selten) zu schweren Unfällen mit lebenslangen Schäden oder auch zu Todesfällen kommen. Dies sollte mit den Eltern und dem Kind/dem Jugendlichen kurz angesprochen werden. Dabei kann auch das Elternmerkblatt der GPS-AG Kinder- und Jugendtauchen ausgehändigt werden (erhältlich über die Homepage der GPS oder über die Homepage der GTÜM). Das Nachuntersuchungs-Intervall wird zurzeit noch unterschiedlich angegeben. So empfiehlt die GTÜM jährliche Intervalle bis zum 18. Lebensjahr, während die GPS das Untersuchungs-Intervall ab dem 14. Lebensjahr auf 2 Jahre verlängert. Entsprechend dem Ergebnis der tauchsportärztlichen Untersuchung kann dieses Intervall bei Bedarf verkürzt werden.
In manchen Fällen kann es bei einem vorher unbekannten Kind schwierig sein, am Ende die Tauchtauglichkeit festzustellen. Ist das Kind/der Jugendliche in einem Verein bereits aktives Mitglied, so kann der Tauchausbilder über seine gemachten Erfahrungen befragt werden. Gleiches gilt bei eventuell notwendigen Rückfragen an den Allgemeinoder Kinder-/Jugendarzt. Die Einwilligung durch die Eltern kann man sich per Unterschrift auf diesem Bogen geben lassen.
Zum Schluss dokumentieren die Unterschriften des Jugendlichen, der Eltern und des Arztes, dass über die spezifischen Risiken des Tauchsports und über das Ergebnis der Untersuchung gesprochen wurde.
Abb. 4.4: Untersuchungsbogen Seite 4