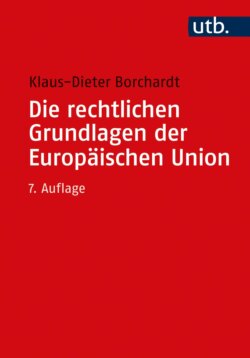Читать книгу Die rechtlichen Grundlagen der Europäischen Union - Klaus-Dieter Borchardt - Страница 27
5. Der Vertrag von Lissabon
Оглавление[29] Nach Verstreichen einer Reflexionsphase von beinahe zwei Jahren gelang es erst in der ersten Hälfte des Jahres 2007, ein neues Reformpaket auf den Weg zu bringen. Dieses Reformpaket nimmt formell Abschied vom europäischen Verfassungskonzept, wonach alle bestehenden Verträge aufgehoben und durch einen einheitlichen Text mit der Bezeichnung „Vertrag über eine Verfassung der EU“ ersetzt werden sollten. Stattdessen wurde ein Reformvertrag entworfen, der ganz in der Tradition der Verträge von Maastricht, Amsterdam und Nizza grundlegende Änderungen an den bestehenden EU-Verträgen vornimmt, um die Handlungsfähigkeit der EU nach innen und außen zu erhöhen, die demokratische Legitimation zu stärken und ganz allgemein die Effizienz des Handelns der EU zu verbessern. Ebenfalls nach guter Tradition wurde dieser Reformvertrag nach dem Ort seiner Unterzeichnung Vertrag von Lissabon getauft.
[30] Die Ausarbeitung des Vertrags von Lissabon ging außerordentlich zügig voran. Das lag insbesondere daran, dass die Staats- und Regierungschefs selbst auf der Sitzung des Europäischen Rates in Brüssel am 21. und 22. Juni 2007 in den Schlussfolgerungen[S. 52] im Detail festgelegt haben, in welcher Weise und in welchem Umfang die für den Verfassungsvertrag ausgehandelten Neuerungen in die bestehenden Verträge eingearbeitet werden sollten. Dabei gingen sie ganz untypisch vor und beschränkten sich nicht, wie sonst üblich, auf allgemeine Vorgaben, die dann von einer Regierungskonferenz umgesetzt werden sollten, sondern entwarfen selbst die Struktur und den Inhalt der vorzunehmenden Änderungen, wobei häufig sogar der genaue Text einer Vorschrift vorgegeben wurde. Besonders strittig dabei waren vor allem die Abgrenzung der Zuständigkeiten zwischen der EU und den Mitgliedstaaten, die Fortentwicklung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, die neue Rolle der nationalen Parlamente im Integrationsprozess, die Einbindung der Charta der Grundrechte in das Unionsrecht sowie mögliche Fortschritte im Bereich der Polizeilichen und Justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen.
[31] Die 2007 einberufene Regierungskonferenz hatte somit nur wenig eigenen Handlungsspielraum und war lediglich ermächtigt, die gewünschten Änderungen technisch umzusetzen. Die Arbeiten der Regierungskonferenz konnten so bereits am 18./19. Oktober 2007 beendet werden; sie wurden auf dem zu gleicher Zeit in Lissabon stattfindenden informellen Treffen des Europäischen Rates politisch abgesegnet. Der Vertrag wurde schließlich am 13. Dezember 2007 von den Staats- und Regierungschefs der damals noch 27 Mitgliedstaaten der EU in Lissabon feierlich unterzeichnet.
[32] Allerdings gestaltete sich auch das Ratifizierungsverfahren dieses Vertrages äußerst schwierig. Zwar nahm der Vertrag von Lissabon, anders noch als der Verfassungsvertrag, die Ratifizierungshürden in Frankreich und den Niederlanden, jedoch scheiterte die Ratifizierung zunächst in Irland in einem ersten Referendum am 12. Juni 2008 (53,4 % Neinstimmen bei 53,1 % Beteiligung). Erst nach Abgabe einiger rechtlicher Zusicherungen über die (begrenzte) Tragweite des neuen Vertragswerkes stimmten die Bürger in Irland im Oktober 2009 in einem zweiten Referendum dem Vertrag von Lissabon zu (67,1 % bei 59 % Beteiligung). Der erfolgreiche Ausgang des Referendums in Irland machte zudem auch den Weg der Ratifizierung des Vertrages von Lissabon in Polen und der Tschechischen Republik frei, wo die Ratifizierung von dem erfolgreichen Ausgang des irischen Referendums abhängig gemacht worden war. Der Vertrag von Lissabon konnte schliesslich am 1. Dezember 2009 in Kraft treten.
[33] Durch den Vertrag von Lissabon werden die Europäische Union und die Europäische Gemeinschaft zur einzigen Europäischen Union verschmolzen. Der Ausdruck „Gemeinschaft“ wird durchgängig durch den Ausdruck „Union“ ersetzt. Die Union tritt an die Stelle der Europäischen Gemeinschaft und wird deren Nachfolgerin. Mit dem Vertrag von Lissabon wird außerdem das „Drei-Säulen-Modell“ der EU aufgegeben. Die erste Säule, bestehend im Wesentlichen aus dem Binnenmarkt und den EG-Politiken, wird verschmolzen mit der zweiten Säule, bestehend aus der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, und der dritten Säule, bestehend aus der Polizeilichen[S. 53] und Justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen. Allerdings bleiben die besonderen Verfahren im Bereich der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, einschließlich der Europäischen Verteidigung, in Kraft; dem Vertrag beigefügte Erklärungen der Regierungskonferenz unterstreichen den spezifischen Charakter und die besondere Verantwortung der Mitgliedstaaten für diesen Politikbereich.
Weiterführende Literatur: Berg/Karpenstein, Änderungen der rechtlichen Grundlagen der EU durch den Vertrag von Amsterdam, EWS 1998, S. 77; Blanke, Der Unionsvertrag von Maastricht – Ein Schritt auf dem Weg zu einem europäischen Bundesstaat?, DÖV 1993, S. 412; Bleckmann, Der Vertrag über die Europäische Union, DVBl. 1992, S. 335; Borchmann, Der Vertrag von Nizza, EuZW 2001, S. 170; Breus/Fink/Griller, Vom Schuman-Plan zum Vertrag von Amsterdam. Entstehung und Zukunft der Europäischen Union, 2000; Fischer, Der Vertrag von Nizza. Text und Kommentar, 2001; Fischer, K.H., Der Vertrag von Lissabon, Text und Kommentar zum Europäischen Reformvertrag, 2008; Glaesner, Die Einheitliche Europäische Akte, EuR 1986, S. 119; Henrichs, Der Vertrag über die Europäische Union und seine Auswirkungen auf die Verfassungen der Mitgliedstaaten; DÖV 1994, S. 368; Hilf/Pache, Der Vertrag von Amsterdam, NJW 1998, S. 705; Hummer (Hrsg.), Rechtsfragen in der Anwendung des Amsterdamer Vertrages, 2001; Kadelbach (Hrsg.), Europäische Verfassung und direkte Demokratie, 2005; Karpenstein, Der Vertrag von Amsterdam im Lichte der Maastricht-Entscheidung des BVerfG, DVBl. 1998, S. 942; Kuschnik, Integration in Staatenverbindungen vom 19. Jahrhundert bis zur EU nach dem Vertrag von Amsterdam, 1999; Lecheler, Die Fortentwicklung des Rechts der Europäischen Union durch den Amsterdamer Vertrag, JuS 1998, S. 392; Lieb/Maurer, Der Vertrag von Lissabon, Kurzkommentar, 3. Aufl. Berlin 2009; Magiera, Die Einheitliche Europäische Akte und die Fortentwicklung der EG zur Europäischen Union, in GS Geck, 1989, S. 509; Sattler, Die Entwicklung der EG vom Ende der Übergangszeit bis zur Erweiterung auf zwölf Mitgliedstaaten, JöR 1987, S. 365; Schmidt, Europäische Union, 2005; Schuppert/ Pernice/Haltern, Europawissenschaft 2005; Schwarze/Hatje (Hrsg.), Der Reformvertrag von Lissabon, EuR Beiheft 1/2009; Seidel, Zur Verfassung der Europäischen Gemeinschaften nach Maastricht EuR 1992, S. 125; Streinz, Der Vertrag von Amsterdam. Einführung in die Reform des Unionsvertrags von Maastricht und erste Bewertung der Ergebnisse, EuZW 1998, S. 137; Vedder/Heintschel, Europäischer Verfassungsvertrag, 2005; Wittinger, Der Europarat: Die Entwicklung seines Rechts und der „europäischen Verfassungswerte“, 2005.