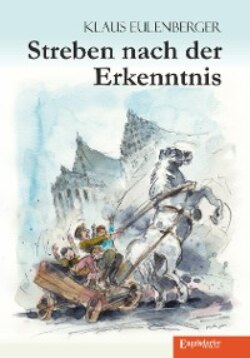Читать книгу Streben nach der Erkenntnis - Klaus Eulenberger - Страница 13
ARMER OPA
ОглавлениеTante Frida hatte sich schon seit einigen Jahren aufs Altersteil zurückgezogen. Sie hatte ihre Bleibe im ersten Stock des Wohnhauses ganz außen am Giebel der Südseite, da, wo wir immer nach knochenharten Brötchen und nach dem Doktorbuch fahndeten. Ähnlich gestaltete sich der neue Wohnraum für Oma Martha und Opa Alfred. Allerdings zogen sie im ersten Stock genau auf die entgegengesetzt andere Seite und zwar den Giebel Nord. Zwischen beiden Wohnungen war ein Abstand von (Gott sei Dank, wie sich später herausstellte) weit über 25 Metern. Sie hatten beträchtlich mehr Wohnraum als Frida, na ja, sie waren auch zwei Personen. Oma und Opa hatten auf der einen Seite des Ganges zwei Zimmer und auf der anderen Seite die Stube und daneben eine längliche Küche. Die zwei nebeneinanderliegenden Zimmer wurden als Schlafzimmer genutzt, wobei Oma behauptete, sie könne mit Opa niemals in einem Zimmer schlafen. Es würde immer klingen, als wenn eine Rotte Waldarbeiter mehrere Hektar Wald zersägen würden. Opa wurde von ihr immer mehr in die kleine Küche gedrängt, wo er sich aufzuhalten hatte – bis auf den Zeitraum, wo sie dort den Ofen fürs Kochen und die Schränke für das Geschirr benötigte. Da kein fließendes Wasser vorhanden war, musste Opa ran. „Alfred, immer muss ich dich auffordern und dann noch hundertmal erinnern, dass du Wasser holen musst. Und zwar mindestens zwei Eimer und zwar – sofort – auf der Stelle!“ Opa stöhnte meist, zündete sich erst einmal umständlich seine Tabakspfeife an und entgegnete: „Gemaaach, gemaaach, Maaaarrrrtha – du kommst mir immer wie ein Feldwebel oder, besser noch, ein General, vor. Die kommandieren genauso rabiat wie du und lassen einen nicht einmal so ein kleines Bedürfnis erledigen wie die Pfeife mit Tabak zu füllen und anzuzünden. Wir haben ja auch nicht mehr so viel toll Schönes auf dieser Welt zu erwarten – da lass mir doch die kleine Freude. Ich lass dir doch auch deinen Willen, wenn du heimlich vom geräucherten Schinken isst bzw. wenn du, falls ausnahmsweise einmal vorhanden, dein Lieblingsessen saure Heringe in dich hineinschlürfst. Hinzu kommt, dass mir zwei Eimer Wasser auf einmal zu viel sind – das packe ich bei dieser verflucht steilen Treppe vom Erdgeschoss hier hoch nicht mehr. Nur, wenn ich meine letzten Körner mobilisiere. In einer Stunde kommt doch der Herbert, vielleicht kann er das für uns erledigen.“
„Du machst es dir verdammt bequem, Alfred“, brüllte Oma cholerisch, „wenn ich täglich für uns das Essen mache, kann ich auch nicht auf den Herbert warten. Also – bewege dich und zwar hurtig!“ Opa knurrte dann sehr, sehr ärgerlich. Manchmal fluchte er sogar laut und verließ erst einmal das Zimmer, um Zeit zu gewinnen. Häufig ging er dann zu seiner Schwester Frida und – das dauuuueeeerte und dauuuueeeerte, bis er zurückkam. Immerhin war es eine verdammt weite Strecke bis zu Frida, und der Schnellste war Opa nun wirklich nicht mehr. Um die Sache zu Ende zu erzählen – der Herbert kam nicht in einer Stunde, da er auf dem Feld arbeitete und nicht abkömmlich war. Also ging die fürchterliche Streiterei zwischen Alfred und Martha weiter. Opa blieb nichts weiter übrig, als wenigstens einen Eimer Wasser zu holen. Mir tat er immer leid, wie er prustete, schnaufte und Mühe hatte, mit seiner Last die nächste Stufe zu erklimmen. War er oben auf der Etage angekommen, hatte er ja immerhin noch eine ziemliche Strecke bis in ihre neue Wohnung zu laufen. Häufig war ich bei Opa oben, um mit ihm zu schwatzen oder, was zwar selten vorkam, aber immerhin, Mensch ärgere dich nicht zu spielen. Wiederholt passierte es, dass ich, schon bei Annäherung an die Wohnung, dunkle Stimmen, mal laut, mal leise, hörte. Lief mir jetzt Oma, die auf der anderen Seite kampierte, über den Weg, hörte ich von ihr verächtlich: „Der redet schon wieder – mit irgendwelchen Leuten. Einfach furchtbar, der Kerl!“ Vorsichtig und leise öffnete ich die Tür zur Stube. Nun konnte ich Opa deutlich hören, denn die Küchentür stand offen. „Jaawollllll, Herr General, ich werde mit meiner Kompanie den Feind rechts umgehen, indem wir, verdeckt vom Wald, lang marschieren und ihn dann von hinten angreifen. Wieso haben Sie Bedenken? Die erste Reihe kniet nieder und schießt – die anderen schießen im Stehen und ich halte mir auch eine Reserve! Nur Mut, Herr General!“ Leise trat ich in die Stube und hörte zu. „OOOpa, mit wem redest du denn da? War das nicht gerade ein General, von dem du Befehle erhieltest? Wer war denn das?“ Opa war keineswegs über mein Kommen erschrocken. Er drehte sich langsam zu mir herum. „Ach, duuu, Klaus, schöööön.“ Opa Alfred freute sich immer sehr, wenn ich auf der Bildfläche erschien. Er hatte eine sehr dicke schwarze Filzjacke an, welche vorn sieben Knöpfe hatte. Entweder er trug sie offen oder es war mal hier und mal da ein Knopf geschlossen. Nie sah ich eine ordnungsgemäß zugeknöpfte Jacke. Die langen Hosen waren auch aus so einer Art braunem Filz. Sie wurden mit einem dicken, schwarzen Lederriemen in der Hüfte gehalten – aber wie? Er machte den Riemen nie ganz straff und das Ende kam nicht in die dafür vorgesehenen Schlaufen, nein, es hing einfach äußerst leger, na ja, eigentlich sehr liederlich, herab. Auch in der Wohnung trug er stets eine flache Schildmütze aus dickem Stoff, die ich schon von seiner Arbeit im Haus und auf dem Feld kannte. Sonst, bei der Arbeit, trug Opa ständig schwarze Stiefel, welche nie eine Bürste, geschweige denn Schuhcreme, gesehen hatten. Er onkelte ziemlich stark, was mich immer sehr verwunderte, denn ich kannte dies nur von kleinen Kindern und war immer der Meinung, dass dies bei Erwachsenen niemals vorkommt. Hier in der Wohnung hatte er natürlich keine Stiefel, sondern Filzpantoffeln an den Füßen. Seine Sachen waren alle fürchterlich veräuft. Irgendwelche grauen Schmierflecke waren an den Hosenbeinen und vor allem an der Jacke. Daneben hatte er aber noch viele braune und schwarze Schmierflecke, welche allesamt mit seiner Pfeiferei zusammenhingen. Oft schaute ich ihm zu, wenn er die Pfeife reinigte. Da kam ja richtiger braunschwarzer Teer aus den Bohrungen seiner Schmaucheinrichtung heraus. Aber wohin denn damit? Ein Teil floss in einen Glasaschenbecher, ein Teil auf den Tisch und viel war auch an seinen Händen hängen geblieben. Letzteres war ja für Opa kein Problem – er schmierte es einfach an die Jacke oder die Hose. Über den Teer auf dem Tisch und dem Aschenbecher gab es prompt am nächsten Tag fürchterlichen Ärger mit Oma Martha. Demgemäß sahen auch seine Hände aus. Diese riesigen Pranken trugen unheimliche Vertiefungen und Schwielen, in denen sich natürlich der Dreck der Zeit angesammelt hatte. Die Hände sahen immer gelb und leicht schwarz aus. Das Schlimmste aber, was sich in letzter Zeit als übelstes Ärgernis herausgestellt hatte, war, dass sich Opa in der kalten Jahreszeit auf den eisernen Ofen setzte, um etwas mehr Wärme in seinen Körper zu bekommen. Die Hosen waren, um die Hüfte herum, vor allem natürlich am Allerwertesten, ziemlich stark angesengt. Ihn störte das natürlich üüüüüberhaupt nicht. Sein Schnauzbart, von Menjoubärtchen konnte man weiß Gott nicht reden, war ungepflegt. Die Haare wurden selten gestutzt und reichten schon weit über die Oberlippe nach unten. Außerdem waren sie stark gelblich gefärbt – das Rauchen, was ihm unheimlich starke Freude bereitete, brachte eben auch so seine Nachteile mit sich. Das Schönste an Opa waren aber – trotz allem – seine sonnige Ruhe, seine Verträglichkeit und seine stahlblauen Augen, die verständnisvoll auf den Betrachter schauten. Wenn ihm aber doch einmal etwas zu viel wurde und etwas generell gegen seinen Strich ging, zum Beispiel, wenn Oma ihn immer wieder bissig attackierte, wurden die blauen Augen grau und es sprühten dunkelrote Funken daraus hervor. Außerdem nahm er zu einem solchen Anlass seine Hände, die er meist tief in den Hosentaschen vergraben hielt, heraus und donnerte zur Erhöhung der Wirksamkeit seiner Sätze mehrfach mit seinen Riesenfäusten auf den Tisch. Eines steht fest und daran ist nicht zu rütteln – Lothar und ich liebten Opa abgöttisch. Wir wurden aber auch immer mehr Zeuge, wie er verstärkt in die Kritik geriet. Aus diesem Grund versuchten wir, Opa zu helfen und ihn zu beeinflussen „Opa, du musst dir mehr deine Hände waschen – so richtig mit viel Seife und mit Bürste und kräftig schrubben. Und dann darfst du deinen Saft von der Pfeife nicht auf deine Jacke und die Hosen schmieren – niemals, bitte, bitte, bitte! Sich auf den Ofen zu setzen ist auch nicht sinnvoll. Du brennst noch einmal an und wir haben keinen Opa mehr!“ Lothar ergänzte plötzlich noch etwas deftig: „Außerdem darfst du deinen Rotz aus der Nase oder sonst woher, ebenfalls nicht an deine Jacke oder Hose schmieren.“ Da Opa traurig zu Lothar schaute, ergänzte dieser: „Wir wollen dir doch nur helfen, Opa. Das musst du doch auch einsehen und vor allem bekommst du immer mehr Ärger mit der Oma und den anderen. Davor möchten wir dich gerne bewahren.“ Wir gingen so weit, dass wir sogar mit Oma Martha über Opa redeten. „Oma, du musst auch etwas Verständnis für Opa haben. Er raucht nun mal gerne und da schmiert er eben dieses schwarze Dreckszeug überall herum. Sei doch so gut und hilf ihm einfach! Gib ihm ein Tuch und sage und zeige ihm, dass er damit alles abwischen soll, auch, dass er diesen Pfeifenreiniger nicht überall herumliegen lassen kann, denn außen an dem Ding ist ja dieses schwarze Teergelumpe dran.“ Generalfeldmarschall Martha wollte uns immer unterbrechen und redete in unsere Argumentation hinein. Sie konnte einfach nicht zuhören und andere Meinungen akzeptieren. Da Lothar und ich dies aber wussten (wir hatten uns schon vor dem Gespräch eingehend unterhalten und etwas Strategie gemacht), sprachen wir einfach weiter mit der Bemerkung: „OOOOma, bitte, lass uns doch auuuuuch mal reden. Wir haben uns das genau überlegt und höööööre uns mal bitte genauuuu zu.“ Das wirkte, wenn sie auch immer wieder versuchte, in unser Gespräch hinein zu kommen. Als wir dann zu Ende deklamiert hatten, kam aber ihre große Rede. „Ihr Kinder macht es euch verdammt einfach. Was denkt ihr denn, wie schwer ich es habe, den Alfred zum Waschen zu bewegen.
Er mault herum, sagt, der Max (sein Bruder) habe es auch nicht so mit dieser blöden Seife und den Handtüchern gehabt und habe trotzdem das Gut ordentlich geführt und sei 76 Jahre alt geworden. Ich kann ihn maximal dazu überreden, sich die Hände zu waschen – selbst das tut er nur im Eilgang und mit äußerster Schnoddrigkeit. Er schmiert alles an seine Sachen, ohne Belehrung anzunehmen. Das, mit dem auf den Ofensetzen, ist die Krönung.“ All das hatte Oma, zwar mit Erregung, aber doch einigermaßen ruhig ausgesprochen. Plötzlich wurde sie aber wieder hysterisch. „Ich muss euch aber sagen, Jungs, so geht das einfach nicht mehr weiter! Hier muss eine Änderung her! Der Alfred gehört in ein Heim und unter Beobachtung! Am Ende brennt er uns noch einmal das gesamte Haus ab. Ich habe schon mit Selma gesprochen und ihr erzählt, was sich hier so abspielt. Übrigens – sie hat die gleiche Meinung wie ich.“ Lothar und ich waren entsetzt. „Das kann nun aber nicht wahr sein, Oma. Ihr wollt den guten Opa abschieben. Das empört uns. Am besten ist, Lutt, wenn wir das Opa einmal selbst erzählen!“ Nun wurde Oma aber ganz verdreht. Sie stand auf. „Wenn ihr das tut, Kinder, dann bin ich längstens eure Oma gewesen. Alfred darf davon nichts erfahren – er ändert sich nicht, und da hat er die Quittung nun eben am Hals!“, bellte sie uns an und marschierte aufgeregt im Zimmer auf und ab. Sie war rot im Gesicht, fuchtelte aufgeregt mit den Armen. Wir versuchten sie zu beruhigen, was nicht gelang. Also verständigten wir uns mit Zeichen hinter ihrem Rücken, dass wir einfach gehen, denn es hatte ja offensichtlich keinen Sinn, uns länger das Gekreische anzuhören. Wir gingen grußlos hinaus und wollten noch einmal über den Gang hinweg zu Opa. Da öffnete sich hinter uns die Tür wieder und wir hörten Omas geifernde Stimme: „Traut euch, zum Alfred zu gehen! Das ist eine Schande! Wenn das die Erziehung eurer Eltern ist – na dann prost Mahlzeit! Ich will euch so schnell nicht wieder sehen!“ Lothar und ich waren schon ziemlich geschockt und berieten. „Weißt du, wir müssen mit unseren Eltern reden – du mit deiner Mutti, ich mit meiner und auch mit Vater, da er ja nun wieder da ist. Wir müssen erreichen, dass das nicht passiert, was Oma vorhat.“
„Genauso machen wir das, Klaus!“ Leider zogen Tante Friedel, Onkel Herbert, Helga und Lothar am nächsten Tag auf die Juchhé in Kleinwaltersdorf. Die Juchhé war der Bahnhof Klewado, welcher mindestens zehn Kilometer fernab, nach einer unbebauten Straße Richtung Hainichen, lag. In der Nähe dieses Bahnhofs waren eine Handvoll Häuser und in eines davon zog die Familie Schulze. Gleich nebenan war auch ein relativ großer Betrieb Müller und Straßburger als Landhandelsfirma, wo mit Holz, Kohle, Getreide und Düngemitteln gehandelt wurde. Das bot sich bei der Nähe des Bahnhofs an, denn hier war der Transport auf Gleisen günstig. Offensichtlich hatte mein Onkel, der Schulze, Herbert, eine Arbeit gefunden. Uns Kindern wurde ja auf diesem Gebiet recht wenig erzählt. Nun war ich also allein mit meinem Kummer zu den negativen Plänen von Oma gegenüber Opa. Ich konnte ja auch nichts weiter tun. In meiner Not erzählte ich es dem Kornblume, Erik, der aber auch nicht recht weiter wusste und den es offensichtlich auch nicht sehr interessierte. Also besuchte ich, außer Frida, vor allem unseren Opa und versuchte, auf ihn einzuwirken, dass er alles etwas sauberer und weniger gefährlich gestalten sollte. Er hörte sich auch meine Ratschläge wohlwollend an, schaute lächelnd und gütig auf mich. „Du bist ein guter Junge, Klaus. Komm nur mal öfter zu mir. Du wirst schon sehen – es wird nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird, und ich versuche schon, den Priem nicht mehr an der Jacke abzuwischen. Mach’s gut – bis zum nächsten Mal, mein junger Freund.“ Ich freute mich über seine Bemerkungen, wollte dies gern Lothar mitteilen, er war ja aber weg und ich konnte ihn nicht einmal per Telefon erreichen. Eine Woche später hatte ich ein teuflisches Erlebnis. Ich war bei Oma, sie hatte mir gerade Erdbeerkompott gegeben und nebenbei erwähnt, dass dann meine Eltern und die Friedel kommen würden. Ich freute mich und das war so etwas von falsch. Sie kamen auch wirklich, auch Tante Friedel, wie angekündigt. Allerdings war in ihrer Begleitung Frau Dr. Erler-Dieda, die ich ja schon von meinem Nabelbruch her kannte. Sie klopften an, kamen herein und sprachen mit Oma. Ich verstand nicht alles, sie flüsterten geheimnisvoll, und ich war, wie immer, zu zurückhaltend, hatte aber begriffen, dass Opa von der Frau Doktor eine Spritze erhalten sollte. Plötzlich kam in mir Angst und Misstrauen hoch. „Verzeihung, weshalb soll Opa eine Spritze bekommen?“ Freundlich wandte sich die Ärztin zu mir hin. „Dein Opa ist sehr krank und aus diesem Grunde muss er ein Medikament gespritzt bekommen.“
„Damit er wieder gesund wird?“ Frau Dr. Erler-Dieda schniefte etwas unsicher. „Na ja, so richtig gesund wird dein Opa nicht wieder. Wir wollen aber das Beste für ihn. Nun geh mal zur Seite. Wir wollen jetzt rüber zu ihm gehen.“ Ich räumte das Feld, ging aber hinterher. Opa lag im Bett und schlief. Mutti sagte zu ihm: „Vater, da du krank bist, gibt dir jetzt die Frau Doktor eine Spritze.“ Opa schaute zu Mutti, sah die Ärztin und drehte sich willig um, nachdem sie ihm gesagt hatte, dass die Spritze in den Po gegeben würde. Mit gemischten Gefühlen sah ich Opas Hintern. Bereitwillig zog er die Schlafanzughose nach unten und ich sah seinen blanken Popo. Er war weiß, fast wie ein Blatt Papier und ich war sehr erstaunt, denn Opa sah immer sehr braun aus. Auf der Stelle kamen in mir starke Mitleidsgefühle hoch, denn ich ahnte Schlimmes. Und Opa, das kleine Dummerle, tat immer alles, was höher gestellte, in diesem Fall sogar eine Frau Doktor, von ihm verlangten. So was aber auch! Die Ärztin knallte brutal und rücksichtslos die Spritze in eine Backe hinein und bat Opa, aufzustehen und sich anzuziehen, was dieser, leider Gottes, auch sehr devot und bereitwillig tat. Misstrauen und Angst stiegen richtiggehend, wie eine Welle von unten beginnend, in mir hoch. „Da soll nun wohl Opa in ein Krankenhaus?“, wollte ich mit ziemlich erregter Stimme wissen. Jetzt schaltete sich Tante Friedel ein. „Der Junge (so anonym hatte meine nette Tante noch nie von mir gesprochen, ich wurde immer unruhiger) sollte doch mal von hier weggehen!“ Prompt kam Mutti auf mich zu, legte mir eine Hand auf die Schulter und wollte mich wegschieben. Jetzt wurde ich aber doch zickig. „Mama, komm! Lass das! Ich will hier dabei sein und den guten Opa betreuen. Nicht, dass hier etwas Falsches passiert!“ Plötzlich rief Vater draußen vom Gang: „Klaus, komm doch mal schnell her – du sollst mal runter zur Selma Kornblume kommen. Die hat für Erik und dich etwas Leckeres gebraten.“ Nun wurde ich doch ziemlich unsicher, vor allem deshalb, weil alle mich so komisch anschauten. Das konnte ich noch nie leiden und machte mich immer verlegen und unsicher. Also ging ich zu Frau Kornblume und sah, dass sie eben erst etwas in die Pfanne legte. Es war also noch nichts gebraten und einfach eine Lüge von Vati. Voller negativer Gefühle rannte ich auf den Hof und konnte gerade noch sehen, wie Opa in ein weißes Auto mit rotem Kreuz, also ein Krankenwagen oder so etwas, hineingeschoben wurde. Jetzt war aber für mich das Maß an Halbwahrheiten und Lügen erreicht. Mir schossen die Tränen aus den Augen und ich rannte dem Auto hinterher. „Opa, guter Opa – pass ja auf, was die mit dir machen! Komm schnell wieder zurück, guter, lieber Opa!“ Ich heulte jämmerlich und ließ mich auch nicht beruhigen. Ich war tief verletzt, ging auch nicht zu Selma hinein. „Die müssen doch alle komplett verrückt sein! Ich soll jetzt etwas Leckeres, in der Pfanne Gebratenes essen, wo der Opa doch jetzt in das Unglück fahren muss! Unverschämtheit!“
Alle, die mich anfassten – Mutti, Vater und selbst Selma – und versuchten, mich zu beruhigen, schob ich empört weg. Mutti war ratlos, sie weinte plötzlich auch. „So habe ich meinen lieben Klausmann noch nie gesehen. Er ist doch so ein folgsames Kerlchen. Was haben wir nur falsch gemacht?“ Im Unterbewusstsein hörte ich das und antwortete mit der in mir vorhandenen, kochenden Wut „So schlecht habt ihr euch noch nie gegenüber Opa und auch mir gegenüber benommen. Ich werde dem Lothar alles erzählen und erwarte, dass Opa in ein paar Tagen wieder gesund zurück ist! Wenn nicht, so wird es die Oma, die an allem schuld ist – ihr aber auch – mit uns zu tun bekommen. Ihr seid Lügner und behandelt den Opa ganz schlecht.“ Mutti kam tränenüberströmt zu mir gerannt und wollte mich drücken. Ich schob sie erneut weg, rannte schluchzend – „Ich will nichts mehr von dir wissen, Mama!“ – davon.
In der nächsten Zeit hatte ich es nicht einfach, da sich alle mir gegenüber, bis vielleicht auf Frau Kornblume und Erik, anders verhielten als sonst. Mutti war traurig und lieb, Vater ernst und lieb, Tante Fridel war auf ihrer Juchhé und Oma schaute an mir vorbei – wenn sie mich einmal anschaute, dann äußerst giftig. Wer sich natürlich nett wie immer zeigte, das war Tante Frida. Also saß ich häufig in ihrem Zimmer und machte Schularbeiten. Das baute mich ein klein wenig wieder auf, lenkte mich ab. Ich getraute mich gar nicht zu fragen, wann Opa denn nun endlich zurückkäme. So vergingen Wochen. Zufällig wurde ich Zeuge, wie Mutti sich mit ihrer Schwester unterhielt. „Ich habe dort angerufen und mir wurde gesagt, dass es ihm den Umständen entsprechend gut gehen würde.“
„Ist er denn gesund?“
„Offensichtlich ja.“
„Trotzdem habe ich manchmal ein schlechtes Gewissen. Geht es dir nicht ähnlich?“
„Gretel, bist wieder mal viel zu weich. Es ging doch nicht anders und die Oma hat unbedingt Recht. Hier wäre noch etwas Schlimmes passiert. Wir mussten doch handeln!“ Nun war es heraus – ich wusste Bescheid. Mit der Aussage, dass Opa gesund sei, fiel es mir Achtjährigem wie Schuppen von den Augen. Jetzt wusste ich, in welchem Ausmaß ich und auch Lothar hintergangen worden waren, denn es wurde uns erzählt, dass er wegen einer Krankheit ins Krankenhaus müsste. Diesmal wurde ich nicht zerrig, heulte auch nicht – mein Schmerz war aber viel größer als zuvor und dies vor allem, weil ich zweifach belogen worden war. Es kam sogar so weit, dass ich mich abends im Bett hin und her wälzte und Mühe hatte, einzuschlafen. Im Geiste sah ich Opa und hörte von irgendjemand, dass er krank sei und dann wiederkäme. Ich sah seine weißen Pobacken, er schlummerte, konnte sich nicht wehren und wurde schmählich hintergangen. Die Spritze wurde rücksichtslos in seine weiße Pobacke hineingehämmert – mir tat der Opa wiederum unendlich leid. Noch nie hatte ich solche Empfindungen in mir gespürt. Ab jetzt war alles anders. Ich war nicht mehr der kleine Klausmann, den man hintergehen konnte, ohne dass ich es erkannte. Menschlich war ich von Mutti, Vater, Tante Friedel und Oma zutiefst enttäuscht. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich gelebt, ohne mir tiefere Gedanken zu machen, ohne Fragen zu stellen. Übergangslos war ich von einem Moment in den nächsten gewechselt. Große Fragen hatte ich mir nie gestellt. Aber jetzt hatte ich Witterung aufgenommen, machte mich auf, meine Persönlichkeit zu finden. Die gleichen Gefühle, die ich damals als Junge auf dem Bauerngut hatte, verfolgen mich heute noch als Erwachsener. Wenn ich dieses Bild sehe, werde ich immer ganz niedergeschlagen, denn das war das Ende, das eindeutige Ende von Opas einigermaßen geordnetem Leben. Viel später – da war ich schon fünfzehn Jahre alt – erfuhr ich von meinen Eltern, dass Opa in ein Heim für Behinderte, wie sie es nannten, eingeliefert worden sei. Sie wollten mir auch erklären, weshalb dies notwendig geworden war. Entrüstet und beleidigt winkte ich nur ab. „Die Zusammenhänge sind mir schoooon bekannt.“ In meinem Berufsleben war ich zuletzt fast zwanzig Jahre als Bauunternehmer tätig. Da hatte meine Firma einen Auftrag erhalten, zwei Häuser an der Außenfassade in der Oberlausitz, im Krankenhaus Großschweidnitz, zu sanieren. Vom Auftraggeber wurde ich informiert, dass diese Gebäude als Irrenanstalten gebaut worden waren und noch in Funktion sind. Sie waren generell denkmalgeschützt und es gab sehr, sehr viele in Gesamtdeutschland. Dort erfuhr ich auch, dass die Patienten mittels Schocktherapie (Elektroschocks) behandelt werden. Ich fragte nach, weshalb dies erfolgen würde, und bekam von einem lustigen Menschen die flapsige Antwort: „Na, damit sich die Synapsen im Kopf, welche offensichtlich alle etwas verrückt sind, wieder ordnen!“ Ich konnte diese lustige Bemerkung nicht so heiter einordnen, da ich an unseren Opa denken musste und außerdem erfahren hatte, dass manche durch die stupide Behandlung in diesen Heimen erst verrückt gemacht wurden, obwohl sie einigermaßen normal hineingekommen waren. Nachdenklich und bedrückt dachte ich so für mich: Die bringen hier in der Irrenanstalt die Synapsen der Patienten in Unordnung, diese Schweine! Mein Onkel Heinel, mit dem ich in den letzten fünf Jahren seines Lebens (er wurde neunzig Jahre alt) im Briefverkehr stand und öfter telefonierte, wurde bei meinen Schilderungen über die Einlieferung seines Vaters unruhig und machte sich große Vorwürfe. „Weißt du, Klaus, ich habe mich viel zu wenig um meinen Vater gekümmert! Gib mir doch mal die Adresse und die Telefonnummer von Hochweitzschen!“ Allerdings musste ich meinen Onkel auf Folgendes hinweisen: „Onkel Heinel, der Opa ist aber ja nun schon lange tot und du kannst ihm jetzt kaum noch was Gutes tun!“ Ich schilderte ihm auch, dass mein Vater Opa einmal in dieser Anstalt besuchte. Dabei kam es zu folgendem Vorfall. Nachdem sie sich ein wenig unterhalten hatten, ging Opa mit seinem Kopf ganz nahe an meines Vaters Ohr und flüsterte aufgeregt: „Herbert, ich weiß genau, wo hier der Ausgang ist. Da können wir beide abhauen! Herbert, komm schnell, damit es ja niemand merkt!“ Als ich diese Bemerkung von Opa aus meines Vaters Mund hörte, kam wieder kurzzeitig die alte Stimmung und Empörung, die aber längst einer tiefen Traurigkeit gewichen war, da alles ja ohnehin keinen Sinn mehr hatte und Vergangenheit war, wieder in mir hoch. Selbstverständlich teilte ich auch meinem Onkel die letzten Sätze seines Vaters mit.