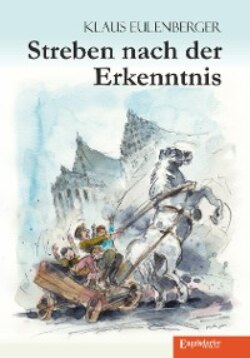Читать книгу Streben nach der Erkenntnis - Klaus Eulenberger - Страница 14
TRAURIGER ABSCHIED VOM BAUERNGUT
ОглавлениеOnkel Heinel war mit seiner Familie bereits umgezogen, Tante Friedel mit ihrer ebenfalls – nun stand das Gleiche für uns an. Meine Eltern informierten mich, dass wir ins Mitteldorf umziehen würden. Ich nahm es zur Kenntnis. Noch heute wundere ich mich, wie gleichmütig, willig, ich solche Veränderungen als gottgegeben zur Kenntnis nahm. Aus heutiger Sicht war ja damit ein äußerst wichtiger Lebensabschnitt zu Ende gegangen. Als Baby war ich Städter in Chemnitz und wurde urplötzlich ein Dorflude auf einem Bauernhof mit völlig anderen Abläufen als in der Stadt. Ich lernte kennen, wie Tiere versorgt werden, wie man Milch gewinnt und diese an eine Molkerei abliefert, genauso, dass Hühner Eier legen, wie gesät, geerntet und weiterverarbeitet wird. Mit dem Einsatz der Kriegsgefangenen hatte ich auch begriffen, wie Menschen mit anderen umgehen und sie ausnutzen. Es war schon eine geballte Ladung an neuen Dingen, Wissen und Erfahrungen, die ich kennenlernen durfte. Das Wesentlichste war sicherlich die Erkenntnis, wie hart Menschen arbeiten müssen, um für sich und andere der Natur Lebensmittel abzugewinnen. Es war aber auch interessant und schön, diesen Prozess zu erleben. Ohne diese philosophischen und theatralischen Betrachtungen anzustellen, verabschiedete ich mich von unserem Bauerngut. Dies tat ich relativ nonchalant, da ich als Kind die Bedeutung dieses Abschnittes noch nicht ermessen konnte. Ich ging zu meiner Lieblingskuh Elsa, drückte ihren Kopf an den meinen, hörte ihr freundliches Brummen und Schnaufen und wischte mit der Hand die paar Spritzer und den Schleim ab, den ich bei diesem freundlichen Akt von ihr abbekommen hatte. Das war meiner guten Elsa scheinbar zu wenig, denn plötzlich schleckte sie, wie in alten Tagen, mein Gesicht von unten nach oben zweimal ab. Mutti, gut, dass du es nicht sehen konntest. Das gehört nun aber eben mal zu einem so lieben Abgang dazu. Zum Abschied klopfte ich ihr noch einmal auf ihren mächtigen Hals. „Lebe wohl, meine gute Elsa!“ Bei meinem Verabschiedungsrundgang besuchte ich auch die Hühner, an der Spitze Huppenan, den es immer noch gab. Als er mich sah, ging er mit dem Kopf wieder stark nach unten, breitete die Flügel aus und demonstrierte mit diesem düsenflugzeugähnlichen Aussehen seinen ungebrochenen Angriffswillen. Ich ging schnell zur Seite. Er beruhigte sich. Natürlich war ich vor allem bei Schimmel und Lore, welche ich übermächtig liebte, vor denen ich aber immer noch Angst wegen ihrer übermächtigen Größe hatte. Ich brachte es gerade fertig, sicher mit sehr ängstlichem Gesicht, beide etwas am Kopf, links und rechts ihrer großen Nase, zu streicheln. Dies gelang mir aber nur, weil ich im Nachbarstall auf einen Schemel gestiegen war und von dort, durch eine Mauer getrennt, diesen meinen Liebkosungsakt ausführen konnte. Als ich zur Tür hinauslief, ging Schimmel mit den Vorderläufen in die Höhe und wieherte wild. Nun wurde mir doch etwas arg traurig ums Herz und ich überlegte, wie ich den beiden noch etwas Gutes tun könnte. Also ging ich zu Frau Kornblume in die Küche, holte mir eine große fette Möhre, zerteilte diese in der Mitte und ging noch einmal zu Schimmel und Lore. Das Spüren der weichen Lippen, ihres Atems sowie das leichte Schmatzen, als sie die halbe Möhre von meiner flachen Hand aufnahmen und verschnurbsten, tat mir richtig gut. In der Tür drehte ich mich noch einmal um und sah, dass mir die beiden äußerst interessiert mit nach vorn stehenden Ohren nachschauten. Jetzt ging es mir doch mächtig an meine Kinderseele. Allerdings überlegte ich mir, dass ich doch häufig hier sein würde, um Erik zu besuchen. Vor allem musste ich Tante Frida und Oma betreuen. Ich besuchte auch die Schweine, die mich, wie immer, schmatzend und grunzend lautstark begrüßten, aber auch die Tauben unterm Dach, um die ich mich eigentlich fast nie gekümmert hatte. Ihr Gurren war mir allerdings sehr vertraut und beruhigte mich immer sehr. Als ich über den Hof ging, stürzte sich ein Gänserich auf mich, vor dem mich aber Tell schützte, indem dieses kleine, tapfere Kerlchen einen Gegenangriff startete. Ich bedankte mich bei Tell für sein immer freundliches Wesen mir gegenüber, was er mit heftigem Schwanzwedeln, starkem Gebell und ständigem Hin- und Herspringen freudig quittierte. Zum Dank gab ich ihm einen Kuss auf die Stirn, was ich bei Opa schon einmal beobachtet hatte. Dann waren die Menschen dran. Ich drückte Erik die Hand. „Wir sehen uns ja dann in der Schule“, und verabschiedete mich von seiner Mutter. „Alles Gute für Sie, Frau Kornblume.“
„Komm doch mal her, Klaus, jetzt drückst du mich noch einmal tüchtig und jetzt esst ihr beiden erst einmal jeder euer Butterbrötchen, was ich euch gemacht habe, und trinkt die heiße Milch. Eine Forelle konnte ich dir jetzt nicht braten, vielleicht fängst du nochmal eine und bringst sie mir. Uns würde es sehr gefallen, wenn du öfter einmal zu uns reinschaust. Du wirst sowieso häufig bei Tante Frida und bei deiner Oma sein und da freuen wir uns dann, wenn du uns besuchst. Wie gefällt es dir denn in eurem neuen Zuhause?“
„Na ja, ganz gut, ich hab auf alle Fälle einen kürzeren Weg zur Schule.“ Als ich nun, mit den besten Wünschen von Frau Kornblume versehen, von der Küche durch den Flur, zur Haustür hinaus, über den Hof und dann durch unser (was heißt hier unser – Kornblums hatten das Gut gepachtet) Holzbogentor lief, wurde mir doch etwas blümerant, unwohl und schmerzvoll ums Herz. So würde ich zumindest heute als Erwachsener meine damaligen Gefühle als kleiner Knirps von acht Jahren beschreiben.
Unsere neue Bleibe war direkt neben dem Mittelgasthof und der Fleischerei Leistner gelegen, nur einhundert Meter entfernt vom Dorfteich, auch Schenkteich genannt. Gleich dahinter war der Fußballplatz; ein Rasenplatz, zumindest dort, wo Rasen war. Meist waren aber nur ziemliche Erdlöcher zu sehen, mit einem Wort – es war ein Huckelplatz par excellence, wo man große Chancen hatte, sich die Fußgelenke zu brechen. Unser neues Haus befand sich auf einer ziemlichen Anhöhe, direkt vor dem erwähnten Fußballplatz, welche über einen ziemlich steilen Anstieg, der schräg von dem Vorplatz des Mittelgasthofes abging, zu erreichen war. Von unserem Haus hatten wir eine gute Übersicht auf den Mittelweg und angrenzende Felder und Wiesen, der auf der anderen Seite von Klewado bis nach Freiberg führte.
Schon seit längerem merkte ich, dass meine Eltern angespannte Debatten führten. Mich jungen Burschen bezogen sie natürlich nicht ein, aber, bedingt durch unsere kleine Wohnung, hörte ich fast alles mit. Zunächst begriff ich noch nicht, um was es sich drehte. Ich hörte, wie sie gemeinsam das Zeugnis der Firma Otto Weber von Radebeul lasen. Diese Firma hatte irgendwie buntes Glas im Angebot. Ich hörte:
Sie waren zuerst in Leipzig und in den letzten zwei Jahren als Hauptvertreter für die Kundschaft in Chemnitz und Westsachsen tätig. Herr Eulenberger hat es durch seinen Fleiß und seine Beharrlichkeit verstanden, für dieses Gebiet in der zweiten Jahreshälfte 1934 12 Prozent mehr Umsatz zu erreichen. Sie können stolz darauf sein, entscheidend zu diesem Ergebnis beigetragen zu haben, wobei wir auch mit unserer Anerkennung nicht zurückhalten wollen. Wenn Sie in diesem Sinne Ihre Arbeit fortsetzen, dann werden wir immer mit Ihnen zufrieden sein und Sie werden im Leben ein gutes Vorwärtskommen haben.
„Herbert, das ist ja bombastisch. Ich wusste schon immer, dass ich mit dir einen exzellenten Könner geheiratet habe!“
„Nun aber Schluss, Gretel, das ist alles Gewäsch, wenn mich die Firma Knorr, Heilbronn, bei denen ich ja zuletzt vor dem Krieg gearbeitet habe, nicht erneut weiter beschäftigt.“
„Ist ja richtig, Herbert, wir gehen gemeinsam noch einmal deine Bewerbung durch, wooobei …“ Mutti stockte, ihre Verwirrung erzeugte plötzlich fürchterlich viele Falten auf ihrer Stirn, „du dich ja eigentlich gar nicht neu bewerben müsstest, denn du warst ja, natürlich vor dem Krieg, angestellt. Sicher brauchst du nur zu schreiben – Bitte um Weiterbeschäftigung bei Ihnen, der Firma Knorr oder so ähnlich, Herbert.“
„Das ist natürlich richtig, Gretel, nur, wäre es nicht gescheit, wenn ich mich parallel dazu hier in der Gegend, zum Beispiel in Freiberg, als Kaufmann bewerbe?“
„Unbedingt, Herbert, tue das! Ich merke, dass du mich dazu nicht brauchst – ich bereite jetzt das Abendessen vor.“
Dann war erst einmal Ruhe mit diesem Thema. Aber schon in einer Woche setzte es sich, nur noch aufgeregter, fort. „Du, die Grube in Freiberg hat sich gemeldet. Ich soll dort nächste Woche vorsprechen.“ Strahlend antwortete Mama: „Herbert, ich hab große Hoffnung, dass wir wieder Wasser unter den Kiel bekommen!“ Ebenfalls überglücklich ging er darauf ein. „Wurde ja auch endlich Zeit – nach diesem unseligen Krieg und all den Sorgen. Auf dem Bauerngut hatten wir zwar eine gute Bleibe mit stabiler Versorgung, aber aus einem Kaufmann kann man so schnell keinen Bauer machen! Übrigens, Gretel, bist du unter die Seefahrer gegangen, weil du vom Kiel und Wasser darunter sprachst?“
„Ach, lass mal, wir hatten neulich in der Gemeinde so ein Thema, weil den Kiesbauers ihr Sohn in der Kriegsmarine war. Uns wurde avisiert, dass er in Kürze zurückkehrt. Er hat seiner Mutter einen fünfseitigen Brief geschrieben, den unser Bürgermeister geöffnet und uns vorgelesen hat. Da war viel vom Kriegsgeschehen auf See und der Hoffnung, dass immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel sein soll, die Rede. Er hatte so lieb an seine Mutti geschrieben. Wir haben fast die gesamte Zeit geweint und geschluchzt.“
„Wieso das, verstehe ich nicht, wenn der Sohn zurückkommt, ist das doch eine Freude.“
„Ach, Herbert, du weißt wieder nur die Hälfte. Man merkt richtig, dass du nicht in Kleinwaltersdorf gelebt hast. Hier sind während des Krieges nur zwei Häuser zerstört worden und eines war das von den Kiesbauers. Sie ist dabei umgekommen – fürchterlich, traaagisch, unheimlich trauuurig!“
Noch vor dem Termin in der Grube Freiberg erhielt Vater einen ziemlich dicken Brief von der Firma Knorr. Aufgeregt nestelte er daran herum, besah ihn von allen Seiten. Mutti sah man die Ungeduld und den Vorwurf gegenüber Vater an, so langatmig zu reagieren. Sie zog ein langes Gesicht, drehte erstaunt ihre Knopfaugen heraus und wunderte sich. Noch immer sagte sie nichts. Nun wurde es selbst Vater zu lang und er schaute hilfesuchend zu mir, der ich ihm gegenüber in der Stube am Tisch über meinen Hausaufgaben saß. Ich begriff schnell und reichte ihm einen Bleistift, den er rasch unter dem Kuvertverschluss hineinschob und hektisch nach oben riss. Laut knisternd zerriss der Verschluss. Ich fand – ziemlich liederlich. Muttis Gesicht veränderte sich aus der Vorwurfsausführung in ein normales, mir geläufiges, aber neugieriges. „Nun, los, Herbert, wird Zeit, dass du aus dem Knick kommst! Gib mir mal rasch her!“ Erstaunt, aber willig, reichte Vater ihr den Briefinhalt. Danach war längere Zeit Ruhe. Mutti las und Vater ärgerte sich schrittweise offensichtlich immer mehr. „Nun gib mal her oder lies vor! Du denkst wohl, ich hab nicht mitbekommen, wie vorwurfsvoll du vorhin geschaut hast, nur, weil ich ein bisschen überlegt habe. Jeder Mensch hat das Recht, auch mal in sich zu gehen. Schließlich war ich dort angestellt und nicht du. Lies endlich vor!“
„Herbert, die von Heilbronn loben dich über den grünen Klee, haben dich aber entlassen!“
„Gretel, jetzt langt’s! Du liest jetzt vor – aber ohne zu kommentieren! Denken kann ich schließlich selbst!“ Er sah, dass ich zusah und zuhörte und gab, ziemlich barsch, an meine Adresse von sich: „Weißt du, Klaus, man darf es, also, ich meine, wir Männer, dürfen es nicht mit der Gleichberechtigung der Frauen übertreiben. Du siehst ja hier selbst, was da für emanzipatorische Vorherrschaftsgebaren entstehen. Du solltest dir das für die Zukunft merken!“ Mutti schüttelte ziemlich energisch den Kopf, wollte kontern, aber man spürte, dass ihr der Inhalt des Briefes jetzt wichtiger war. Sie begann: „Hier erst mal das Zeugnis, Herbert“, sah mich an und ergänzte, „und Klaus. Herr Herbert Eulenberger, geboren 21. 11. 1908, stand vom 1. März 1938 bis zu seiner Einberufung zur Wehrmacht im September 1939 als fest angestellter Reisender in unseren Diensten … wurde er mit unsere Vertretung in Chemnitz betraut. Während seiner, leider nur eineinhalbjährigen praktischen Tätigkeit für unsere Firma hat sich Herr Eulenberger als geschickter Verkäufer erwiesen, der infolge seiner Beliebtheit bei der Kundschaft ansehnliche Umsätze erzielte. Seine Haltung war stets einwandfrei, auch seine verbindliche Art im geschäftlichen Verkehr mit der Leitung unseres Außendienstes war erfreulich. Wir hegten die Erwartung, dass sich Herr Eulenberger zu einer unserer besten Reisenden entwickeln würde. Leider unterbrach der Krieg den weiteren Einsatz. Die wirtschaftlichen Verhältnisse haben sich zu unserem Bedauern nach Kriegsende so entwickelt, dass wir uns gezwungen sehen, Herrn Eulenberger, wie die meisten früheren Mitarbeiter im Außendienst nach ihrer Rückkehr aus der Gefangenschaft zu entlassen. Wir wünschen Herrn Eulenberger alles Gute für seinen ferneren Lebensweg.“
„Mensch, Vater, du musst ja wirklich richtig gut gewesen sein!“, entfuhr es mir. Ich sah, dass Vater sich über meine Bemerkung freute. „Schau mal hier, Herbert“, sie hielt ihm das Papier vor die Nase, „hier in deinem Anstellungsvertrag. Erstens … erhält gegen Erfüllung der Vertragspflichten ein monatliches Gehalt von RM 350 und zweitens an Reisearbeitstagen folgende Spesen: RM 4 bei Tätigkeit am Wohnort einschließlich der Auslagen für Straßenbahn, RM 5 für Abstecher in die Umgebung, wenn abends Rückkehr zu dem Wohnsitz möglich ist, RM 10 für eigentliche Reisetouren, wo auswärts übernachtet werden muss. Außerdem vergüten wir das Eisenbahnfahrgeld 3. Klasse.“
Als ich jetzt diese Zeilen schrieb, musste ich schmunzeln. Die 3. Klasse gibt es schon lange nicht mehr. In Gedanken sah ich ganz deutlich deren herrlich körpergerecht geformten Sitze aus meist hellem, tadellosen Holz und darüber die grünen Netze, die in Stahlhalterungen hingen. Meine Frau erzählte mir, dass, wenn sie an die Ostsee fuhren, diese Netze nicht für Koffer genutzt wurden. Vielmehr legte ihre Mutti Decken darauf und sie konnte wunderbar süß neben ihrer ein Jahr jüngeren, vierjährigen Schwester bis nach Rostock schlafen.
Die Diskussion um Vaters hervorragende Leistung bewegte mich und veranlasste mich zu der Bemerkung: „Das wird ja immer toller, Vater – Respekt! Deine Arbeit wird ja enorm anerkannt. Aber sag bitte mal: Ihr habt da also in der Firma Weber und Knorr nichts hergestellt, ich meine, keine Produkte gefertigt?“
„Aaaaber, Klaus, die Firma Weber stellte buntes Glas her, für verschiedene Anwendungen, und die Firma Knorr Fertigsuppen, Maggi, Knorrsauce, Salatkrönung, Spaghetti, während des Krieges Zichorie als Kaffeeersatz und vieles andere mehr.“
„Ja, ja, Vater, aber du hast sie nur vertrieben?“
„Na klar, das war aber schwierig genug und verlangte immer eine enorme und vor allem geschickte Überzeugungsarbeit. Wie kommst du denn darauf?“
„Der Herr Jesus, dein Freund, erzählte unlängst in der Schule, wie wichtig es ist, Produkte herzustellen, die das Land braucht – von Brot und Brötchen über technische Geräte bis hin zu Autos und so weiter. Er sprach auch über den Vertrieb dieser Waren und wie wichtig der Handel sei. Doch prägte er auch den Satz: Allerdings ist es so, dass man mit Handel und Wandel immer mehr Geld verdienen kann als mit richtiger, ehrlicher Arbeit!“ Vater überlegte, zog plötzlich den Unterkiefer nach unten, verkniff die Augen und zeigte ein unheimlich beleidigtes Gesicht. „Also, Kleener, werde erst einmal erwachsen und leiste selbst etwas! Da wirst du sehen, wie schwer das ist! Eigentlich eine Frechheit von dir! Die Firma Knorr hatte einen Bienenkorb, Symbol für ein „fleißiges Völkchen“ als Markenzeichen der Firma und so handelten wir alle, ob sie nun in der Fabrik etwas herstellten oder vertrieben! Ende, Schluss!“ Schlagartig wurde ich mir der Bedeutung meines Satzes bewusst – obwohl, ich hätte ihn in jedem Fall angebracht, da er mir so gefiel und ich mein Wissen auch loswerden wollte. Mutti schaute, etwas besorgt und ängstlich, auf Vater und versuchte, die gerade wunderbare Stimmung, die in extremem Lob der Leistung meines Vaters gipfelte, zu bewahren. „Klausmann, ob nun Herstellung von Erzeugnissen bzw. deren Vertrieb – es muss alles mit Fleiß, Geschick und Intelligenz in die Reihe gebracht werden!“ Etwas kleinlaut warf ich ein: „Ja, ja, Mutti und Vati, das ist keine Frage! Ich wollte nur den Satz vom Jonas, der ja nun wirklich euer Freund ist, loswerden.“ Schon ein klein wenig besänftigt meinte Vater: „Mit dem Kerl werde ich ein ernstes Wörtchen zu reden haben! Machen wir doch einfach mal weiter mit dem anderen Schreiben, Gretel. Während ihr diskutiert habt, habe ich parallel mal weiter geblättert. Das ist ja mehr als beeindruckend, wie die Firma Knorr zu ihren Mitarbeitern – und das war alles vor dem Krieg – steht! Wahnsinn!“
Dieses Schreiben der Firma Knorr vom 4. Februar 1948 liegt nach 66 (!!!) Jahren jetzt vor mir. Es ist wirklich mehr als beeindruckend. Damit ich nicht wieder versucht bin, so viel zu kommentieren, gebe ich hier die wesentlichsten Inhalte wieder. Nachdem wir seit Jahren ohne jedes Lebenszeichen von Ihnen waren, war uns Ihre Nachricht, dass Sie jetzt endlich aus russischer Gefangenschaft zurückgekehrt sind, eine rechte Freude. Leider müssen wir aber nach unseren bisherigen Erfahrungen die Befürchtung hegen, dass Sie nicht ohne gesundheitlichen Schaden die Leidensjahre überstanden haben. Wir wünschen Ihnen aufrichtig, dass Sie körperlich sowie seelisch die Widerstandskraft aufbringen mögen, um nun auch die tiefgreifenden Veränderungen, die inzwischen in unserer Heimat stattgefunden haben, zu verkraften und den Anschluss an das neue und so viel schwerere Leben in dem zertretenen Deutschland finden. Wie aus Ihren Zeilen hervorgeht, haben Sie sich schon ohne jede Illusion den nüchternen Einblick in die jetzigen Verhältnisse verschafft und entheben uns damit der schweren Aufgabe, Sie von der vorläufigen Unmöglichkeit einer Weiterbeschäftigung zu überzeugen. Unser Heilbronner Werk ist zwar mit einem 50-prozentigen Kriegsschaden über das Kriegsende hinweggekommen. Werk Posen und unsere sämtlichen Läger haben wir verloren. Von unserer Berliner Tochtergesellschaft sind wir getrennt, von Wales ganz abgeschnitten. Wie Sie schon haben feststellen können, ist die russische Zone für uns wie ausländisches Gebiet in das wir nicht liefern dürfen und nicht liefern können. Der Einsatz von Reisenden in der russischen Zone wäre ein Unsinn. Von unserem früheren Reisenden Kuhn in Gotha werden Sie von uns auch noch die Übergangsentschädigung erhalten. Wir haben aus vorstehenden Gründen weder heute noch in absehbarer Zeit eine Beschäftigungsmöglichkeit für Sie und müssen Ihnen deshalb mit diesem Schreiben unsere Kündigung aussprechen. Obwohl die Verhältnisse es verbieten, dass Sie ihre Arbeitskraft unserer Firma während der Kündigungszeit zur Verfügung stellen, gewähren wir Ihnen nach unseren Richtlinien für die Dauer von vier Monaten eine Übergangsentschädigung in Höhe von 75 Prozent Ihres letzten Bruttogehaltes von RM 350, also brutto RM 262,50.
Von diesem Stil, von dieser Kultur der Firma Knorr bin ich ganz einfach beeindruckt. Man muss sich das einmal überlegen. Es waren fast sechs Jahre Krieg. Da erinnert sich diese Firma noch ihrer Mitarbeiter, einverstanden, mein Vater war mit ihnen in Kontakt getreten – trotzdem! Wenn ich da an die heutige Zeit denke, an den politischen Konkurrenzkampf, an das Wort Ego, welches bei 99 Prozent der Geschäftsführer auf der Stirn geschrieben steht. Zur jetzigen Zeit hätte, schlitzohrig, wie die meisten sind, teilweise korrupt, nur an sich denkend, kein Firmenchef sich der Mitarbeiter nach dem Zusammenbruch infolge eines teuflischen Krieges mit immenser Zerstörung der Moral, der menschlichen Seele und des Landes erinnert, um sie zu trösten, wieder aufzubauen und ihnen gar eine Abfindung zu geben. Ich verneige mich tiiiiief vor einer solchen Haltung!
Mein Vater hatte eine Einstellung in den Bleierzgruben Albert Funk Freiberg gefunden und die Abteilung Einkauf übernommen. Allerdings war nun für ihn folgendes Problem zu lösen: Wie komme ich möglichst schnell und ohne Umsteigen und Wartezeiten dorthin? Er kaufte sich ein kleines Motorrad mit 125 Kubikzentimeter Hubraum – eine ILO. Diese kleine Knatterkiste hatte hinter dem Fahrersitz nur einen kleinen Metallgepäckträger. Vater hatte sicherlich nicht die große Erfahrung mit Kraftfahrzeugen, auch wenn er dies immer wieder betonte. So erzählte er uns, dass er während des Krieges einen hochrangigen Nazioffizier mit einem PKW chauffieren musste. Als er ihn einmal zu einer Beratung an einem kleinen Wäldchen gefahren hatte, passierte ihm ein ziemliches Missgeschick. Der Offizier ging zu seiner Beratung. In der Zwischenzeit spürte Vater Blasendruck und stellte sich dazu an einen Baum. Plötzlich kam sein Kommandeur zurück mit dem schnoddrigen Befehl: „Eulenberger, fahren Sie retour!“ Vater suchte krampfhaft den Zündschlüssel, fand ihn weder in Hose noch Jacke. Der Offizier schnarrte: „Na, was ist denn los, Eulenberger? Aber nun, hopp!“ Vater wurde immer nervöser und erinnerte sich daran, dass er an dem Baum viel Flüssigkeit verloren hatte. Vielleicht ist da der Schlüssel herausgerutscht, dachte er sich, wahnsinnig nervös und inzwischen mit zittrigen Händen. Er kniete sich hin (während der Rückfahrt stellte er fest, dass seine Hosen an den Knien arg durchgeweicht waren) und suchte krampfhaft auf dem durch die gelbe Flüssigkeit durchweichtem Boden nach dem Schlüssel, was ihm dann auch mit mehreren Verletzung durch Tannennadeln, die ihm in die Fingerkuppen und Fingerballen eingedrungen waren, gelang. Dass sein General zwischendurch weiter knarrende Befehle gab, musste er ganz einfach verkraften. Endlich saß er wieder im Auto und wurde mit der folgenden, unwilligen Anbrüllrede konfrontiert: „Das passiert mir nicht noch einmal! In Zukunft muss das schneller gehen! Sie sind ja so langsam wie eine Schnecke – da ist ja längst der Feind da! Was riecht hier denn so komisch, fast so süßlich wie Pisse? Ist ja auch egal, ich zünde mir halt eine Zigarette an!“
Mit seiner ILO kam Vater scheinbar recht gut zurecht, allerdings schrammte er einmal – Gott sei Dank! – knapp an seinem Ende vorbei. Er kam zügig, vom Unterdorf her, angefahren, vorbei am Dorfteich links und dann rechts an der Gaststätte Leistner. Nun brauchte er nur noch den schmalen Weg mit steilem Anstieg zu unserem neuen Haus hochfahren. Schlagartig kam ein Traktor mit Hänger vom Sportplatz heruntergefahren und querte seinen Weg. Vater wollte das Gas wegnehmen aber – um Himmels willen, um Himmels willen! – er gab Gas und seine ohnehin schon schnelle ILO jagte auf den Traktor zu. Gedankenschnell fuhr er mit Schenkeldruck nach links, dann nach rechts, am Traktor vorbei, und raste den Anstieg hoch. Oben bremste er stark und stand. Sicher war er sich der Gefahr bewusst, denn er pumpte aufgeregt Luft und es dauerte ein Weilchen, bis er ruhiger wurde. Dann aber, typisch Vater, kam sein ständiger Optimismus und seine Lebensfreude sofort schlagartig wieder in ihm hoch, er lachte schallend, stieg ab und ging zügig zu dem Traktorfahrer hinunter, welcher ihn mit ernstem Gesicht erwartete. „Herbert – das war fast dein Exitus! Wie konntest du nur? Hast du mich zu spät gesehen? Für mich hast du ja noch einmal enorm Gas gegeben, als du mein Fahrzeug sahst, wiiiie das?“ Er war aschfahl im Gesicht, seine Hand zitterte, als er sie meinem Vater gab. Mit strahlendem Gesicht gab Vater ihm zur Kenntnis, dabei feixte er noch laut: „Weißt du, Arthur, das ist mein neuer Fahrstil! Sprunghaft und zügig an Gegnern vorbei und hoch zu der 78 (das war unsere Hausnummer). Du siehst doch, wie souverän mir das gelungen ist.“ Dann unterhielten sich beide in Ruhe und Vater erzählte: „Kannst du dir vorstellen, dass ich den Gänsehals aufdrehte, anstatt ihn zuzudrehen.“ Mein Vater war immer lustig, fast immer, sprach gern von Gänsehals und auf- und zudrehen, anstatt vom Gasdrehgriff zu sprechen. „Ich wollte also den Gänsehals von mir wegdrehen, also nach vorn drehen, d. h. Gas wegnehmen, und nicht zu mir drehen und damit Gas geben, Arthur. Glaub mir, auch ich war zu Tode erschrocken.“ Arthur gab ihm noch ein paar Ratschläge, in Zukunft etwas bedächtiger unterwegs zu sein. Vater versprach es.
Nun wohnten wir also nicht mehr auf dem Bauerngut, sondern in einem nicht sehr großen Mietshaus. Wir hatten eine Wohnung im Erdgeschoss, was meinen Eltern überhaupt nicht behagte. Auf meine Frage gaben sie an, lieber im, ihrer Meinung nach, vornehmen ersten Stock, logieren zu wollen. Prompt ergab sich auch später – als wir nach Freiberg zogen: In der ersten und zweiten Wohnung wohnten wir auch dort – natürlich! Ich meine – im Erdgeschoss. Vom Hausflur aus trat man rechts in unsere Küche, von der ging es weiter in die Stube und von da in die Schlafstube. Bad war nicht vorhanden, die Toilette (Plumpsklo) war draußen vom Flur aus zugänglich. Der Hausbesitzer und unser Vermieter, Herr Schnatterer, war ein älterer Mann, den ich nie einmal lachen sah. Er trug eine starke Brille und hinter der blickte er immer sehr bösartig in die Welt, flößte mir große Angst ein. Nie sagte er ein freundliches Wort zu mir und ich war immer froh, wenn ich ihn überhaupt nicht zu Gesicht bekam. Sein Charakter zeigte sich, wenn auf dem Huckelfußballfeld nebenan ein Spiel lief. Wie gesagt, dieses Spielfeld lag gleich neben einem kleinen Garten hinter unserem Haus und streckte sich von da ab längs hin, d. h., gleich hinter unserem Garten war eines der beiden Fußballtore – und dies war ein Drama und eine Tragödie, vor allem natürlich für Herrn Schnatterer. Natürlich wurde viel auf dieses Tor geschossen, wie das halt so in dieser Sportart üblich ist. Zum Schutz von Haus und Garten war ein riesiges Stahlnetz hinter dem Fußballtor aufgebaut, welches aber genauso viele freie Stellen wie intaktes Stahlnetz besaß. Infolgedessen landete der Ball häufig im Garten, mitunter knallte er auch an die Hausfassade. Lautes Schimpfen und Fluchen, danach polterndes, eiliges Hinabrennen auf der Holztreppe vom ersten Stock in das Parterre – Schnatterer rückte wutschnaubend an. Er rannte in den Garten und mit wilden Flüchen gegen die Sportler nahm er den Ball auf und verschwand im Schuppen. Meist kamen danach ein, zwei Spieler, um den Ball wieder einzufordern. Ohne ein Riesengeschrei ging dies nicht ab und meist zogen sie auch wieder ohne Ball ab. Was das in dieser Zeit nach dem Krieg, wo es kaum etwas gab, bedeutete, ist sicher klar. Auf alle Fälle war diese Streiterei recht unangenehm für uns und meist ging ich raus (manchmal ging auch Vater mit) auf den Fußballplatz, um dem Geschehen beizuwohnen. So war ich nur von dort aus Zeuge von Schnatterers Entrüstungsanfällen und seiner Kleptomanie. Das Schlimmste, was einmal passierte, war, dass ein Ball, der in den Himmel ging, an ein Fenster im ersten Stock flog – Glas splitterte. Ich war dieses Mal nicht auf dem Fußballfeld und stürmte hinaus, um meine Neugier zu befriedigen. Herr Schnatterer holte den Ball, rannte in den Schuppen, nahm ein riesenlanges, spitzes Messer und stach damit einfach hinein. Dort, wo er hineinstechen wollte, war aber das Leder noch einigermaßen dick und intakt. Die Schneide rutschte ab und stach in seinen Zeigefinger – das Blut tropfte beträchtlich. Plötzlich kamen drei Spieler und sahen das Dilemma. „Herr Schnatterer, sind Sie verrückt? Das ist unser letzter Ball. Sie haben kein Recht dazu!“ Schnatterer kam, durch seine Verletzung wahrscheinlich noch mehr, in Rage und brüllte wie ein Vieh: „Und ob ich das kann! Dies ist mein Privatgrundstück und ihr habt kein Recht, mein Fenster zu zerstören. Ich werde euch verklagen und jetzt verschwindet von meinem Grundstück!“ In erneuter Entrüstung nahm er wiederum das Messer und stach an einer anderen Stelle hinein. Diesmal glückte sein Vorhaben. Zischend ging die Luft heraus. Die Spieler schauten empört und rachsüchtig. „Das werden Sie bereuen! Da brauchen wir auch nicht ihr Fenster reparieren lassen, wenn sie unser Eigentum kaputt machen.“ Kopfschüttelnd und schimpfend gingen die drei wieder auf den Fußballplatz.
Es war aber keinesfalls so, dass es keine Steigerung mehr gab. Sonntag zehn Uhr – wunderschönes Wetter, mild und Sonnenschein. Angesetzt war das Spiel Rotation Freiberg gegen FSV Hainichen. Mein Freund Günther und ich sind pünktlich zur Stelle und setzen uns bequem auf die oberste Wölbung der Böschung. Alles läuft gut für die Heimmannschaft. Der Rechtsaußen will wahrscheinlich eine Flanke hereingeben, es wird aber mehr ein Torschuss, welcher über den Torwart hinweg ins Dreiangel geht und sich am Ende stark senkt. Wir sind begeistert und pfeifen um die Wette. Günther hat es drauf, mit einem gekrümmten Zeigefinger zu pfeifen. Ich benötige dafür vier Finger, habe aber vielmehr Dampf bei meiner Pfeiferei, d. h. es ist schriller und deftiger, was ich zustande bringe. Unsere Abwehr lässt von der Mitte des Feldes einen Befreiungsschlag los, welcher weit über das Tor geht und prompt eine Kluft im Stahlnetz findet. Sofort tritt der Hausbesitzer auf den Plan, hält beide Handinnenflächen an den Mund, um seiner donnernden Schimpfkanonade mehr Nachdruck zu verleihen. „Ihr Verbrecher – das ist das allerletzte Mal, dass ich das zulasse. Morgen gehe ich zum Regierungspräsidium, damit eure Spiele ab sofort verboten werden!“ Er nahm den Ball und verschwand wiederum laut schimpfend im Schuppen. Gott sei Dank war noch ein Ball da und somit ging das Spiel weiter. Inzwischen war Halbzeit und diese Pause nutzte der Trainer von Rotation Freiberg, um die Gegner von Hainichen zu bitten, sich etwas in der Höhe zurückzunehmen, wenn sie in der zweiten Halbzeit auf das Tor, hinter dem sich Schnatterers Grundstück befindet, schießen. Es wurde auch erläutert, weshalb – die anderen hatten das Problem schon längst erkannt. Es lief auch alles einigermaßen gut bis zehn Minuten vor Schluss. Es war wieder mal einer von den Wilden, die nie so recht hören können. Auf jeden Fall knallte der Ball in großer Höhe durch das Netz und an das Haus von Schnatterer (Glas splitterte allerdings nicht). Es passierte sinngemäß das Gleiche wie vorhin, nur dass er diesmal nicht wie ein Sprachrohr agierte. Er meckerte stark, nahm den Ball und verschwand im Schuppen. Nun war aber ein großes Problem gegeben, denn es war schlicht und einfach kein Ball mehr vorhanden. Alle schauten sich ratlos und entrüstet an. Der Trainer reagierte als Erster. „So geht das einfach hier nicht weiter! Jedes Mal haben wir das gleiche Problem und wir haben in dieser Zeit, wo es nichts gibt, einfach keine Fußbälle mehr. Hier muss das Bezirksamt eine Regelung treffen und jetzt gehen wir alle geschlossen zu diesem bösartigen Sportgegner. Ich muss aber bitten, nicht handgreiflich zu werden, denn das verschlechtert nur unsere Lage.“ Nach fünf Minuten kamen die abgekämpften Spieler mit Trainer bei Herrn Schnatterer an. Günther und ich, die neugierig hinterherliefen, haben heute noch das Geräusch, was die Fußballstollen auf dem erdigen Weg verursachten, im Gedächtnis. Es klang fast so, als wenn eine Kompanie Soldaten marschiert. Die Gespräche während des Soldatenmarsches verliefen folgendermaßen: „Der hat uns jetzt sofort die Bälle herauszugeben, sonst kriegt der eins in die Fresse. Wir wollen doch keinen Spielabbruch, noch dazu, wo wir 1 : 0 führen. Der muss einmal Angst vor uns bekommen und so sollten wir auch auftreten.“ Der Trainer klingelte – es dauerte vielleicht geschlagene fünf Minuten, bis Schnatterer sich endlich bequemte. Inzwischen kam auch der Schiedsrichter den Berg hochgelaufen und rief schon von Ferne: „Was wird denn nun? Das Spiel muss weitergehen! Das ist ja ein Skandal!“ Als Schnatterer herauskam, ging sofort der Schorsch Mächtig (so war der auch in der Realität, ein Meter und neunzig groß und wahnsinnig kräftig) auf ihn zu, stellte sich provozierend vor ihn und sagte: „Geben Sie uns sofort die Bälle heraus – ich will sehen, wo sie liegen. Die sind unser Eigentum. Und wenn Sie das nicht tun, zwinge ich Sie dazu und werde Sie altes, kleines Männlein vor mir her treiben!“ Der Trainer kam sofort angeflitzt, stellte sich zwischen Mächtig und Schnatterer. „So auf keinen Fall. Wir wollen vernünftig mit Ihnen reden, Herr Schnatterer. Ich rate Ihnen aber auch, uns sofort dorthin zu führen, wo die Bälle liegen. Handeln Sie bitte auf der Stelle!“ Das Letzte hatte der Trainer so markant und mit Nachdruck gesagt, dass Schnatterer unsicher wurde. „Kommen Sie!“ Er führte alle weiter nach hinten, machte die Schuppentür auf und da sahen alle das Ärgernis. An der Seite hing ein riesengroßes Netz mit vielleicht zwanzig Bällen darin. Die Spieler, der Trainer und der Schiedsrichter sperrten Mund und Nasen auf, als sie das sahen. Nachdem das Erstaunen gewichen war, brachen in den Sportlern alle Zurückhaltungsdämme. Alle schrien: „So ein Schuft – der Verbrecher hindert uns am Ausüben unseres geliebten Fußballspiels. Der muss sofort alle Bälle hergeben und sich entschuldigen.“ Einer, es war nicht der Mächtig, stürzte auf Schnatterer zu, fasste ihn derb am Oberarm, zerrte mit einer Wahnsinnskraft daran und forderte: „Her mit den Bällen, sonst wirst du jetzt schon und sofort erledigt, du alter verhärteter Knochen!“ Herr Schnatterer fiel hin und schaute – für mich war es das erste Mal – verängstigt in die Welt. Der Trainer und der Schiedsrichter kamen an, halfen Herrn Schnatterer hoch. „Herr Schnatterer, das wollen wir nicht! Entschuldigung! Wir sollten uns jetzt hier und sofort, damit so etwas nie wieder vorkommt, vernünftig wie Erwachsene unterhalten und eine Regelung treffen, damit für immer Ruhe wird!“ Der Trainer rannte noch schnell zu dem Oberarmzieher hin und stellte sich zackig vor ihm auf. „Ralf, noch einmal so eine verbotene Aktion und ich stelle dich nie wieder auf! Überlege es dir!“
„Herr Schnatterer, der Sportverein repariert das Fensterglas, Sie geben uns jetzt alle Bälle zurück und wir werden uns in Zukunft bemühen, nicht mehr durch das Schutznetz zu schießen! Einverstanden?“ Schnatterer schaute, für seine Verhältnisse, relativ ruhig. „Ich bin einverstanden, viele denken – und so wird ja fast schon im gesamten Dorf über mich geredet –, dass ich ein Stänkerer und Streitkopf wäre. Dem ist aber nicht so. Ich will auch einmal meine innere Ruhe haben. Mir ist nach alldem Hin und Her und dem Geschreie immer ganz schlecht. Allerdings muss ich verlangen, dass nicht mehr durch das Schutznetz geschossen wird!“ Jetzt schaltete sich allein der Schiedsrichter ein. „Ich schlage vor, dass das Netz unter Zuhilfenahme der Fußballspieler durch eine Firma dicht gemacht wird, so dass das Durchschießen in Zukunft ausgeschlossen wird.“ Jetzt schaute selbst Herr Schnatterer ziemlich ruhig und offensichtlich zufrieden. Mir schien es, als wenn er sogar ein ganz klein wenig lächelte. „Hier meine Hand darauf – so kann endlich Eintracht werden!“
Für mich war das Leben in der neuen Wohnung natürlich eine riesige Veränderung. Mir fehlten Lothar, Helga und meine Kumpels vom Unterdorf. Mutti ging immer früh 7 : 00 Uhr ins Gemeindeamt und kam, wenn sie nicht wieder einmal Überstunden machte, gegen 17 : 00 Uhr zurück. Vater fuhr noch früher als sie mit seiner ILO los. Urplötzlich war ich allein gelassen, bekam einen Haustür- und Wohnungsschlüssel. Das war’s dann! Ich hatte ja aber genug mit der Schule zu tun, die mich mehr, als mir lieb war, mit Unterricht und Hausaufgaben zudeckte. Der Unterricht begann im Allgemeinen 7 : 30 Uhr und endete gegen Mittag. Mit meinen Kumpels, vor allem mit meinem neuen Freund Klose, Günther gingen wir dann nach der Büffelei nach Hause. „Ich stelle nur meinen Ranzen zu Hause ab, esse etwas – mal sehen, was mir Mutti hingestellt hat – in zirka einer halben Stunde, Günther, bin ich wieder draußen und wir können etwas unternehmen!“ Günther schaute mich etwas missbilligend und leicht überheblich an. „Zunächst mache ich Hausaufgaben und erst danach gehe ich raus! Hast du nicht mitbekommen, dass wir in Deutsch den einen Textteil von Heinrich Manns Buch abschreiben und kommentieren sollen und in Mathe haben wir auch drei Aufgaben.“
„Das können wir doch später machen, Günther! Hab dich mal nicht so! Die Lehrer haben doch auch gesagt, dass wir einmal ausspannen sollen.“
„Meine Mutti hat das so festgelegt und so mache ich das auch! Kannst doch in der Zwischenzeit mal mit dem Escher, Elmar raufen, der dich immer so mit Wenn die Eule mit der Keule übern Hackstock springt und die Wurst verschlingt … in Rage bringt. Schließlich wohnt er jetzt nur dreihundert Meter von deiner neuen Wohnung entfernt – im Gegensatz zu früher.“ Mein folgender herrlicher Singsang Muttersöhnchen, Muttersöhnchen – du bist ein supergroßes Muttersöhnchen! brachte den Günther vollkommen außer Fassung, wozu übrigens nicht viel gehörte. Sein Gesicht verzog sich merklich – er war beleidigt, verletzt – und das in hohem Maße. Mehrfach passierte es dann, dass er handgreiflich wurde. Meist riss er an meinem Ranzen herum und das war deshalb so grauenhaft und ärgerlich, weil ich durch die Hebelwirkung vollkommen aus dem Gleichgewicht kam. Leider war der Günther wesentlich kräftiger als ich, aber ich wehrte mich tapfer und wenn die Sache kulminierte und ich in Wut kam, zog er meist den Kürzeren. Groll brach manchmal so plötzlich über mich herein, dass ich mich hinterher selbst wunderte und erstaunt war, wieso dieser so schlagartig in mich hineinschoss. Mit diesem urplötzlichen Zornesausbruch wuchs aber in mir eine bernalische Kraft. Ich kann mich noch gut erinnern, welch enorme Energie durch diesen Jähzorn in mir entstand, als es ihm gelungen war, mich auf den Rücken zu legen und er mit seinen überlangen Haaren in meinem Gesicht herumwedelte, indem er sein Gesicht möglichst nahe zu meinem absenkte und den Kopf bewusst hin und her schüttelte. Es gelang mir, ihn hochzustemmen, zur Seite zu drücken und als wir beide wieder auf den Beinen standen, ein Bein zu stellen, ihn gewaltig zu schubsen und als er auf den Rücken fiel, knallte ich mich drauf. Er behauptete, ich hätte ihm ein paar Rippen gebrochen, zumindest geprellt, und außerdem meinen Ellbogen in sein rechtes Auge gestoßen. Zu Tode beleidigt ging er sofort nach Hause und sprach mehrere Tage nicht mit mir. So war er halt – wollte immer der Klügste, Kräftigste, Intelligenteste und Hübscheste von allen sein. Allerdings muss ich der Wahrheit die Ehre geben – am nächsten Tag war der Bereich um sein rechtes Auge doch ein klein wenig geschädigt. Erst war der Fleck rot, dann wurde er blau, dann gelb und dann verschwand er. Günther wohnte vielleicht fünfhundert Meter von mir entfernt neben dem Feuerwehrgebäude und in der Nähe des Gemeindeamtes. Sein Vater war Baumeister, hatte dieses Einfamilienhaus gebaut. Seine Mutter ging nicht auf Arbeit, war nur zuhause und daraus resultierte die Möglichkeit, Günther zu verwöhnen. Meine Mutti war sicherlich genauso lieb wie Frau Klose, nur hatte sie nicht die Gelegenheit so wie sie, sich um mich zu kümmern. Wenn Günther, nachdem er an dem ihm zugewiesenen und extra für ihn gestalteten Arbeitsplatz an einem kleinen Pult seine Hausaufgaben erledigt hatte, sagte er seiner Mama Bescheid. „Fein, Günther! Wir trinken jetzt noch heiße Schokolade und dann kannst du spielen gehen!“ Wenn Günther dann erschien, sah er wiederum wie aus dem Ei gepellt aus. Er hatte offene Sandalen an, weiße lange Kniestrümpfe, eine kurze, braune Hose und ein schönes Nicki. Gegenüber seinem Schulgang war das Ganze jetzt schon etwas abgemildert, denn früh sah er noch schnuckeliger aus. Die Haare waren fein gescheitelt und mit irgendeiner Klebemasse in ihrer Lage ziemlich haltbar gemacht, so dass er selbst nach einer Schularbeit, wo man sich vor Verzweiflung am Kopf kratzt, noch genauso aussah wie früh, als er tadellos gepflegt ankam. Wenn ich ehrlich sein soll – das Ganze regte mich ziemlich auf. So picobello wie er hergerichtet war, benahm er sich auch – immer etwas besonders fein, arrogant und überheblich. „Was wollt ihr denn von mir, ihr kleinen Scheißer auf diesem Dorf? Ich werde euch noch zeigen, wer ich bin und vor allem, wie viel ich drauf habe, ihr kleinen Dilettanten!“ Günther war vielleicht eine Stirnbreite größer als ich, dafür etwas breiter und kräftiger. Er trug lange blondbraune Haare. Im Gesicht hatte er ziemlich viele Sommersprossen, welche besonders dicht um seine etwas zu groß geratene Nase, besonders an den Nasenwurzeln, auftraten. Mich störte auch, dass die Backenknochen etwas zu weit vorstanden. Das ging aber vielleicht noch, allerdings war seine Mundpartie eine echte Scheiße. Meine Mutter unterschied immer zwei Kategorien an Mundausführungen. Bei der einen sagte sie verächtlich: „Die oder der hat eine Überknöpflippe!“, bei anderen: „Die oder der hat eine Unterknöpflippe!“ Günther hatte auf alle Fälle eine Überknöpflippe, d. h. seine Oberlippe ragte beträchtlich über die untere hinaus. Man hatte den Eindruck, dass die Kinnlade ein klein wenig weiter nach vorne hätte geschoben werden müssen. Dem war aber eben nicht so und da sah es eben ziemlich dämlich aus, fand ich. Günther hatte ziemlich große und lange Schneidezähne, welche aber nicht, wie üblich, senkrecht nach unten gewachsen waren – nein, diese Hauer ragten etwas schräg nach vorn. Es ist deutlich erkennbar, dass ich den Günther, von Anfang an, nicht so recht leiden konnte. Schließlich war er aber der Einzige, der bei mir in der Nähe wohnte. In der Schule war ein ziemlicher Konkurrenzkampf um gute Zensuren zwischen uns, was ihn aber offensichtlich mehr belastete als mich.
Mir fällt jetzt schlagartig ein wunderschöner Witz ein, den mir mein großer Sohn Sven erzählte. Er betrifft die zwei Mundpartiekonstruktionen, welche meine Mutter offensichtlich immer sehr berührten. Mit Sicherheit ist es allerdings mehr ein Witz zum Zuhören und vor allem Zuschauen – ach was! Ich versuche es trotzdem einfach einmal! In einer Kneipe sitzen zwei junge Männer bei zwei Dingen – beim Rotwein und beim Kerzenschein. Der eine der beiden hat eine Oberknöpflippe, der andere das Gegenteil davon. Nachdem sie lange getrunken und erzählt hatten, sagte der mit der Oberknöpflippe zu dem anderen mit der Unterknöpflippe: „Lass uns nun den schönen Abend beenden. Wir sollten jetzt gehen. Blase doch bitte mal die Kerze aus!“ Der mit der Unterknöpflippe bläst auf die Kerzenflamme, aber leider geht sein warmer Luftstrahl nur vom Unterkiefer knapp am Oberkiefer vorbei senkrecht nach oben. Enttäuscht sagt er „Blase du doch einmal, bitte!“ Der mit der Oberknöpflippe bläst, aber leider geht der warme Luftstrahl nur von der Oberlippe am Unterkiefer vorbei senkrecht nach unten. Beide sind ziemlich enttäuscht, rufen den Kellner. „Herr Ober, bitte blasen Sie mal die Kerze aus!“
„Selbstverständlich, meine Herren!“ Der Ober bläst mit beiden Lippen, welche, schön anzuschauen, fein übereinander angeordnet sind. Dazu öffnet er leicht den Mund und der warme Luftstrahl, welcher waagerecht seine Lippen verlässt, bläst sofort das Kerzenlicht aus. Der mit der Oberknöpflippe und jener mit der Unterknöpflippe reagieren mit enormer Empörung. „Hast du diese blööööööde Gusche gesehen?“
Als Schlüsselkind, das ich war, ging ich mittags nach Hause, trat durch die Haustür in den Flur, schloss die Tür zur Küche auf und war daheim. Rasch legte ich meinen Ranzen auf das Sofa, schlüpfte in die Hauspantinen, wusch mir befehlsgemäß (laut Papa) die Hände und lief zu meinem Versorgungszentrum. Mutti hatte immer in der Sofaecke einen Topf drapiert, welcher in eine Decke eingewickelt und zur besseren Wärmehaltung in eine Menge von Sofakissen eingepackt war. Mitunter war Eintopf darin enthalten. Es kam aber auch vor, dass ich mehrere Töpfe auspacken musste und zwar dann, wenn es Kartoffeln mit Fleisch in der entsprechenden Sauce und irgendein Gemüse, zum Beispiel Spinat, zusätzlich gab. Nach dem Essen musste ich nicht aufwaschen – diese Order hatte ich nicht. Also spülte ich leidlich ab und ließ dann überall Wasser hinein, denn ich hatte mitbekommen, dass ein „Anbacken“ der Lebensmittel an den Topf sehr nachteilig war. Danach war ich dann frei für den Ausgang. Häufig kam es vor, dass Mutti im Gemeindeamt länger, d. h. sehr lange arbeiten musste. Dazu kam sie meist kurz nach Hause, um dann nach einer halben Stunde wieder zu verschwinden. Es war ein herrlicher Sommertag gewesen, sehr freundliches, laues Wetter. Mutti brachte mich 21 : 00 Uhr ins Bett. „Schlaf schön, mein guter Klausmann, ich muss noch zwei bis drei Stunden arbeiten.“
„Immer musst du länger arbeiten. Was macht ihr denn da so?“
„Wir müssen alle Viehbestände und später sämtliche Feldbelegungen pro Bauernwirtschaft zusammenstellen und alles dem Kreisamt übermitteln. Wir stellen also zusammen, wie viel Hühner, Hähne, Schafe, Schweine, Rinder, Pferde uns so weiter und so fort der entsprechende Bauer sein eigen nennt. Jetzt muss ich aber gehen. Schlaf schön, Klaus! Bis morgen früh! Die Fenster lasse ich angekippt, damit du frische Luft hast, bei dieser Wärme.“ Als braver Junge schlief ich natürlich rasch ein. Auf einmal hörte ich Stimmen, Schreien, Lachen, irgendein Gepolter und Gekreische, wurde munter. Ich ging in alle Zimmer. Niemand da! Draußen ging der Lärm weiter. Dieses Mal hörte ich bedrohlich tiefe Männerstimmen. Vor diesem lauten, krächzenden, teilweise bassartigem Geschrei hatte ich schon immer Respekt und Angst – genau diese beschlich mich jetzt. Ich wurde fahrig, nervös, hatte Manschetten. In äußerster Hast zog ich mir meine Turnschuhe an, öffnete das Erdgeschossfenster und mit dem linken Fuß von einer Fußbank abgestoßen, kam ich flott auf die Sohlbank und sprang hinaus. Haste was kannste rannte ich mit schnellen Schritten und keuchendem Atem zum Gemeindeamt, stellte mich auf die Sohlbank des Kellerfensters und konnte geradeso das Parterrefenster erreichen, damit ich an das Glas klopfen konnte. Das Fenster öffnete sich und heraus schaute – nicht meine Mutti oder die gutmütige Lisbeth, sondern der Bürgermeister. Ich erschrak und antwortete auf seine Frage „Zu wem willst du denn, kleiner Junge?“ mit zittriger Stimme: „Zu meiner Mutti – die muss doch hier drin sein.“ Der Bürgermeisterkopf verschwand und rasch erschien das aufgeregte und ängstliche Gesicht meiner Mama. „Oh Gott, Klausmann, ist was passiert?“
„Nein, ich habe aber Angst. Bei uns waren so böse, schreiende Männerstimmen.“ Mutti schloss das Fenster und kam durch den Haupteingang heraus. „Du musst keine Angst haben, Klausmann. Ich bring dich jetzt nach Hause und dann wird alles gut.“ Als wir losgingen, öffnete sich erneut das Hochparterrefenster und der Bürgermeisterkopf erschien erneut. „Du kommst aber wieder, Gretel. Spätestens 23 : 00 Uhr hören wir auf, denn da müssten wir die Listen geschafft haben. Nun habe ich endlich mal deinen Sohn kennengelernt. Bis gleich!“ Mutti brachte mich nach Hause und das Prozedere des ersten Zubettgehens von 21 : 00 Uhr wiederholte sich. Am nächsten Tag sagte Mutti zu mir: „Klausmann, bei deiner gestrigen Laufaktion im Schlafanzug zum Gemeindeamt hat dich eine große Corona gesehen. Die kamen alle vom Biertrinken bei Leistners und waren sehr erstaunt, dass Jungs in Kleinwaltersdorf im Schlafanzug durch die Gegend rennen. Hast du denn davon nichts gemerkt?“
„Klar habe ich die gehört. Die wollten mir Angst machen und haben gesagt, sie kämen vom Mummum und ich sollte nur sehen, dass ich schnell wegkomme, sonst würde der mich abfangen und in den tiefen, dunklen Wald mitnehmen. Da bin ich natürlich noch schneller gerannt.“ Mama umarmte mich. „Ach, du lieber, kleiner Klaus – du tust mir so leid.“ Vierzig Jahre später, als wir wieder mal in unserer Erinnerungsrunde mit Tante Friedel zusammensaßen, schüttelte Mutti nur den Kopf. „Wie konnte ich damals nur so gefühllos sein. Ich habe den Klaus wieder nach Haus gebracht, dann ins Bett und bin wiederum ins Gemeindeamt gegangen. Aus heutiger Sicht finde ist das ganz einfach herzlos gegenüber dem damals kleinen, zurückhaltenden Jungen. Das würde ich nie wieder tun und bereue es!“
Als ich wieder einmal meine Mutti nach der Schule im Gemeindeamt besuchte, wurde ich Zeuge einer verrückten Begegnung. Wie manchmal, wenn der Bürgermeister nicht im Hause war, durfte ich in die Büroräume gehen, indem Mutti an einer Stelle die Tresenplatte hochklappte. Ich ging zu Tante Ursula, die kurz aufschaute und mir freundlich die Hand drückte. „Ach, der Klaus ist wieder einmal da. Da wird sich deine Mutti freuen.“ Diese kam auch gleich von einem hinteren Raum hereingestürmt und drückte mir zwei schmatzende, sehr feuchte Küsse auf die Wange. „Du sollst dich doch nicht immer nach jedem Kuss abwischen, noch dazu, wenn er von deiner Mama ist, Klausmann, das beleidigt mich. Ich bin doch deine liebe Mutti.“
„Das hat doch damit nichts zu tun. Es ist einfach ekelig – diese Spuckeschmiererei!“ Mutti schaute sehr gekränkt und wollte etwas erwidern – da ging die Tür auf und ein Schwall an begeisterten Reden, enthusiastischem Gezwitscher, Tatütata erfüllte den Raum. Tante Ursula schaute äußerst missbilligend, da sie in ihrer Arbeit gestört wurde. „Hier ist das Gemeindeamt und kein Tollhaus! Ich brauche Ruhe zum Arbeiten! Der Umsatzplan für das laufende Jahr muss morgen stehen!“ Dagegen schauten Mutti und ich fasziniert auf die zwei jungen Frauen, die, wie im Theater hergerichtet, aufgeregt und vergnügt herumtobten. Wie sich herausstellte, war die eine die Susi, des Bürgermeisters Jupp junge Frau. Wie mir Mutti später erzählte, war sie erst Mitte zwanzig und damit zirka zwei Jahrzehnte jünger als er. Sie hatte sich als Schulmädchen verkleidet und sah wahnsinnig adrett aus. Mir gefiel sie sehr. Die Haare hatte sie zu einem Pferdeschwanz gebunden, Lippen, Wangen, Augenbrauen und Lider stark übertrieben geschminkt. Besonders gefiel mir aber ihr äußerst kurzes Faltenröckchen, knallgelbe Absatzschuhe mit vielleicht fünfzehn Zentimeter Länge. Sie hatte lange, schlanke Beine und dies gefiel sogar mir jungem Knirps. Auf dem Rücken trug sie einen Schulranzen, drehte und wiegte sich in den Hüften aufgeregt hin und her. „Komm, Gretel, du musst dich auch arrangieren! Heute ist Fasching und bei Leistners eine große Fete. Die ist aber erst heute Abend. Jetzt gehen wir erst einmal hübsche Männer küssen und an Haustüren Lieder singen und Bettelverse vortragen. Vielleicht bekommen wir zur Belohnung eine Praline oder einen feinen Likör.“ Die andere Junge bewegte sich ähnlich, ließ aber die Susi reden. Sie war ganz anders gekleidet – hatte lange dunkle Hosen an, darunter aber auch Absatzschuhe, die knallrot waren. Oben trug sie eine Jacke mit senkrechten roten und schwarzen Streifen und um den Hals wiederum ein knallrotes Tuch. Auf dem Kopf war eine Schärpe, seitlich gebunden. Der Rest dieser Schärpe hing bis auf eine Schulter herab. Nun kam das ganz Fantastische – das rechte Auge war mit einer schwarzen Binde verschlossen, wobei die Bänder, die diese Binde hielten, diagonal um den Kopf verliefen und offensichtlich hinten verknotet waren. Noch verrückter war, dass sie in der Hand eine Pistole hielt. In meiner Fantasie sah ich ein Schiff mit einer Meute an Seeräubern. Geschminkt war sie wie Susi, vielleicht noch auffälliger. Nachdem die beiden so erst einmal im Vorraum für Aufregung und Furore gesorgt hatten, stürmten sie am Tresen vorbei in die Arbeitsräume. Als Erstes kam Ursula an die Reihe. Sie erhielt von Susi einen schmatzenden Kuss auf eine Wange. Ursula war sichtlich erschrocken (hätte sie die Attacke rechtzeitig gemerkt, wäre sie sicherlich davongerannt oder hätte ihr Gesicht mit beiden Händen zugehalten), lachte aber (mir kam es etwas pflichtgemäß vor) und flitzte zum Spiegel, wo sie sofort mit Taschentuch und Spucke das kirschrote Etwas wegzumachen versuchte. Dann war ich dran. Die andere, Muttis Freundin Zielonka, Anne, kam zu mir geflitzt, gab mir zunächst die Hand, dann aber blitzplatz hatte ich auch, und zwar rechts und links, einen knallroten Mund als Abdruck auf meinen Wangen. Mutti sah zu, lachte und war sehr fröhlich. Anschließend ließ sie sich auch von Susi auf beiden Wangen markieren und fragte, ich fand, etwas zappelig: „Weiß denn dein Mann, der Jupp, davon, was du vorhast? Er ist doch zurzeit zu einer Weiterbildung in Chemnitz.“
„Liebste Gretel, was redest du denn jetzt über meinen Mann? Heute zum Faschingsdienstag geht es doch nur um uns, viel Spaß, tanzen und schönen Wein trinken.“
„Susi und Anne, ihr dürft aber nicht vergessen, dass die Ursula und ich hier stramm zu arbeiten haben.“ Ursula nickte energisch und pflichtgemäß. „Genau so ist das!“
„Ich will euch beiden Superbeamten nur mal Folgendes sagen. Bei uns im Rheinland machen Leute wegen Fasching drei Wochen Urlaub. Ihr könnt ja mal den Jupp dazu fragen. Da machen wir es eben so – jetzt ist es 13 : 00 Uhr. Ihr beiden macht 14 : 00 Uhr Schluss und arbeitet später die zwei Stunden nach.“ Sofort rief Ursula aufgeregt: „Mit mir auf keinen Fall! Ich habe den Termin vom Kreisamt bis morgen! Lasst mich bitte in Ruhe mit eurem Rumgespringe und dem Getöse. Ich habe daran absolut kein Interesse!“ Jetzt zwitscherten die beiden jungen Damen. „Aber du, Gretel, auf jeden Fall bist du dabei. Wir haben uns auch schon überlegt, als was du gehen solltest.“
„Ja, das interessiert mich.“
„Du könntest als Spanierin gehen. Ich habe in unserer Wohnung dazu fast ein komplettes Kostüm liegen. Freust du dich?“
Am nächsten Tag hatten wir erst 10 : 00 Uhr Schulbeginn, da die Schabracken erkrankt war. Im Allgemeinen weckte mich Mutti, wir frühstückten zusammen, danach marschierte sie in das Gemeindeamt und ich in die Schule. An diesem Morgen war offensichtlich alles anders. Ich wurde durch lautes Rufen und Klopfen an unser Fenster in der Stube im Erdgeschoss geweckt, sah, wie sich Mutti aus dem Bett quälte, dabei stöhnte und ächzte. Sie ging zu dem Fenster und öffnete es. Draußen stand, vollkommen aufgeregt und aufgelöst, Ursula. „Gretel, die ersten Bauern sind schon da. Um Himmels willen – was ist denn los mit dir?“ Mutti stand da wie eine Bogenlampe. Sie schwankte. Auf dem Kopf hatte sie unheimlich viel Haarwickel, welche notdürftig von einem hellblauen Netz, welches offensichtlich die Haare zusammenhalten sollte, überspannt waren, was nur notdürftig gelang. Diese chaotische Situation mit herabhängendem Haarnetz um ihren Kopf herum, hatte ich schon häufig bei ihr gesehen und kopfschüttelnd meinen Kommentar in etwa so gegeben: „Weißt du, Mutti, mit deiner Sturmhaube und den vielen Wickeln siehst du aus wie eine Eule. Ich habe mal Bilder von Panzerfahrern gesehen – die haben Ledermützen auf, wo auch solche wickelähnlichen Lederpuffer angebracht sind, damit sie sich nicht im Inneren des Panzers an den vielen Ecken und Kanten stoßen können. Kannst du dir nicht, bei Gelegenheit mal, eine andere Gestaltung für dein oberstes Ende vom Kopf einfallen lassen?“ Mir kam es vor, als wenn sie ihr Gleichgewicht nicht halten konnte und kurz vor dem Umfallen war. Mutti war schlank und hielt sich sonst immer sehr gerade – heute kam sie mir eher wie ein Fragezeichen vor. Ich schaute sie mir näher an – sie sah blass und irgendwie zerknittert aus. Die Augen lagen tief in den Höhlen, die Ringe unter den Augen waren dunkel. So richtig war das nicht meine Mutti, zumindest so, wie ich sie kannte. „Was ist denn los Mutti?“, hängte ich mich in die Absprache mit Frau Walther hinein. Zu Ursula gewandt, sagte sie: „Kleinen Moment, liebste Ursula – am besten du hörst einmal zu, was ich zu erzählen habe.“ Sie drehte sich halb zu mir hin. „Was soll denn los sein, Klausmann? Wir haben bis 2 : 00 Uhr gefeiert und ich habe unheimlich viel Wein, Bier und auch Schnaps getrunken. Die Susi hat mir noch eine Zigarre angedreht. Mir geht es gar nicht gut, habe schon zweimal gebrochen. Ich muss mich sofort wieder hinlegen, aber erst einmal muss ich die Ursula beruhigen.“
„Gretel, was machst du denn für Sachen? Wir können doch froh sein, dass wir die feine Einstellung im Gemeindeamt haben, müssen uns aber auch danach verhalten. Du weißt doch, dass ich heute Termin gegenüber dem Kreisamt habe und dazu die Aussagen der Bauern brauche.“
„Sie haben ja so recht, Frau Bürgermeister! Ich werde es auch nie wieder tun!“
„Du immer mit deinem Quatsch, von wegen Bürgermeister. Ich tue nur mein Bestes!“
„Für mich bist du der eigentliche Bürgermeister, Ursula. Das weißt du auch ganz genau. Sei doch bitte so lieb und regle das mit den Bauern. Ich verspreche dir auch, dass ich morgen nicht erst um acht, sondern bereits um sieben im Gemeindeamt bin. Tschüss, meine Ursula. Ich muss mich schnell wieder hinlegen, mir wird schon wieder ganz schwindlig.“ Ich führte Mutti zu ihrem Bett. Als sie lag, sagte sie: „Hole mir doch bitte mal ein großes Glas mit Wasser, aber kalt muss es sein!“ Als ich mit eisgekühltem Wasser wieder an ihrem Bett stand, war sie bereits wieder eingeschlafen. Sie war offensichtlich fix und fertig.
In unserem neuen Zuhause hatten meine Eltern urplötzlich wahnsinnig viele neue Bekannte. Manchmal, vor allem abends, wenn alle von Arbeit kamen, war es bei uns wie in einem Taubenschlag. Eine Taube kam, plapperte mit den anderen, flog wieder weg, kam wieder und blieb länger. Zwischendurch kamen viele andere und plapperten ebenfalls wild durcheinander. Mitunter war das Chaos perfekt. Dieses Taubenschlagmilieu gefiel aber meinen Eltern offensichtlich sehr. Selbst wenn sie müde waren und plötzlich an das Fenster geklopft wurde (wie damals Ursula), waren sie stets freudig bereit, den Begehrenden Einlass zu gewähren. Allerdings fiel mir (selten, aber immerhin) auf, dass sie doch ab und an einmal die Augen verdrehten und ich hörte leises, stöhnendes Geflüster. „Ach, die schon wieder. Muss das sein?“ Ging aber die Tür auf und der- oder diejenige trat ein, gab es stets ein freudiges Begrüßungsgezwitscher von Mutti oder Vati oder beiden. Meist füllte sich der Taubenschlag ganz rasch und vor allem Mama flitzte dann geschäftig hin und her. „Moment mal, wir haben doch den schönen Hagebuttenwein in Arbeit. Der müsste fast ausgegoren sein. Einverstanden? Wir probieren den einfach einmal. Das wird ein Spaß!“ Die Gästetauben klatschten begeistert Beifall – schließlich wurden sie mit etwas köstlich Trinkbarem bewirtet. Am häufigsten flatterten die zwei Schäfer-Tauben herein, dies waren der Schäfer, Bernd und seine Frau Leni. Während er mit ruhigem Flügelschlag in das Taubenzentrum einflog, war das bei seiner Frau ganz anders. Wahnsinnig hochfrequente Flügelschläge und dazu ständiges Geplapper, sprich Gezwitscher, kündigten ihr Kommen an. War sie da, erstarben alle anderen Gespräche, da sie sich sofort in den Mittelpunkt stellte und jede bisherige Rede übertönte und im Keim erstickte. Ein ganz behäbiger Tauberich kam langsam und mit müden Flügelschlägen daher. Das war der Opel, Hugo, seines Zeichens Förster und eingefleischter Junggeselle. Ursula war auch dabei, fehlte allerdings häufig – weshalb wohl? Richtig, sie hatte natürlich wieder eine Erfassung oder irgendeine andere Zuarbeit im Gemeindeamt für das Kreisamt zu leisten. Ohne meiner Mutti wehtun zu wollen, sah es manchmal so aus, als wenn diese die Einzige sei, die im Gemeindeamt Leistung erbrachte. So war aber der Taubenschlag noch nicht komplett. Es fehlten noch der Schuldirektor Jesus, Jonas mit seiner Frau und der Hartmann, Hagen, der Biolehrer, mit seiner Gerdi. Diese vier kamen auch normal dahergeflogen. Der einzige Vitale im Kommunizieren und Plappern, manchmal auch aufgeregt zwitschernd, war der Jesus, Jonas. Das nützte ihm aber nichts, denn er kam ja sowieso bei dem Tatütata und Gezwitscher der Schäfer, Leni nicht zum Auftreffen. Damals war ich als kleiner Steppke bei diesen Treffen der lebenshungrigen und -lustigen Leute des Taubenschlags mehr im Wege, denn dass die Taubengesellschaft sich für mich interessiert hätte. Natürlich wurde ich häufig angesprochen, so zum Beispiel vom Schäfer, Bernd. „Ach, hier ist ja der Absenker von Eulens, die kleine Eule. Wie geht es dir denn, Klaus? Kommst du gut in der Schule klar, oder musst du dich über den Hartmann, Hagen und den Jesus, Jonas immer sehr ärgern? Ich könnte mir das an deiner Stelle sehr lebhaft vorstellen, denn die Lehrer sind ja für die Schüler immer eine Last. Ohne die könnte es in der Schule zehnmal besser sein!“ Die beiden Lehrer zogen die Stirn in Falten. „Schade, dass du nicht mehr als Schüler bei uns bist. Dich würden wir schon in die Mangel nehmen, du fauler Sack. Als Hausaufgaben würden wir dir aufgeben, tausend Mal zu schreiben: Ich darf nicht böse und schlecht über meine Lehrer Hartmann, Hagen und Jesus, Jonas sprechen! Sollte dies noch einmal vorkommen, so werde ich jeden Tag die Schuhe meiner Lehrer wunderbar sauber putzen!“
Dann war aber meist schon die Aufmerksamkeit für mich erloschen und ich zog mich aus dem Taubenschlag mit seinem Gezwitscher und mir auf die Nerven gehendem Geplapper zurück. Meist setzte ich mich dann in eine Ecke und las. Da unsere Wohnung aber zu klein war, als dass ich mich in eine absolut ruhige Ecke hätte zurückziehen können, hatte ich immer die Störgeräusche, die aus dem Taubenschlag zu mir drangen, zu verkraften. Das passte mir auf gar keinen Fall und ich sprach auch mal mit meinen Eltern darüber. „Mama und Papa, müsst ihr denn immer so viele Leute zu uns bitten und bewirten? Hinterher seid ihr doch immer ganz müde und müsst noch lange aufwaschen und abtrocknen. Außerdem habe ich häufig Schularbeiten zu machen und da stört mich das Gekreische von eurer Gesellschaft. Vor allem die Leni macht dermaßen Hektik und schreit herum, als wenn sie allein wäre. Ich hab schon mitbekommen, dass sie sich mit ihrem Mann nicht gut versteht, frage mich aber, ob sie das so hektisch und lauthals nun allen andern erzählen muss. Wenn sie ihren Mann dann in großer Runde so angeht, wird das gegenseitige Verstehen sicher auch nicht besser!“ Meine Eltern hatten aufmerksam und erstaunt zugehört. „Das sind ja wertvolle Erkenntnisse und Schlussfolgerungen, Klaus, die wir dir gar nicht zugetraut hätten. Du hast sicher vollkommen Recht, wenn du sagst, dass das Anschreien ihres Mannes kaum Besserung bringt. Das ist auch unsere Meinung und wir sind erfreut über dein umfassendes Denken und dies mit ganzen neun Jahren. Komm her, Klausmann, ich möchte dir ein Küsschen geben.“ Natürlich weiß ich heute, dass meine Eltern und all die anderen die schlimme Zeit und die Entbehrungen der Kriegszeit vergessen wollten und deshalb viel feierten. Sie wollten ganz einfach nachholen und leben. Bei einer dieser Unterhaltungsfehden im Taubenschlag wurde vereinbart, dass die gesamte Truppe am übernächsten Tag zu uns zum Essen kommt. Meine Mutti hatte eine wunderbare Spargelsuppe, wunderbare Steaks vom Fleischer Leistner, Kartoffelmus und grüne Bohnen in Aussicht gestellt. Und die Schäfer, Leni sagte euphorisch: „Ich bringe ein herrliches Dessert mit, Gretel. Ei das wird fein! Hinterher rauchen wir noch von meinen Zigaretten. Ich habe ganz neue und zwar Orient – die sind zwar schweineteuer, schmecken aber wunderbar, einfach schnaffke. Die gibt es erst seit kurzem im Verkauf. Da freust du dich doch vor allen Dingen, Herbert?“ Herbert nickte begeistert. Der vorgesehene Tag war ein Sonnabend, das Essen für abends geplant. Nun rotierten meine Eltern ganz schön, um alles Notwendige zu besorgen, aber auch ich kam nicht ungeschoren davon. Dabei hörte ich das erste Mal, dass sie etwas bedenklich über die große Summe Geldes sprachen, die das gesamte Spektakel verschlingen würde. „Weißt du, Herbert, wir machen wieder einmal eine solche Großveranstaltung, wo sich zum Beispiel der Hugo, der uns noch nie eingeladen hat, wieder nur durchfrisst und den Dreck von seinen Stiefeln, den er seit einer Woche im Wald angesammelt hat, bei uns genüsslich auf dem Teppich verteilt. Außerdem kostet das Ganze immens viel, was wir uns eigentlich gar nicht leisten können.“
„Na ja, meine gute Gretel, du hast schon Recht, aber denke einmal daran, welche Entbehrungen wir in der Kriegszeit hatten und außerdem – wenn ich manchmal an meine Kameraden denke, die dieses Inferno nicht lebend bzw. nicht in voller Gesundheit überstanden haben, werde ich ganz traurig und bedrückt. Wir können ja froh sein, dass ich überhaupt einigermaßen gesund aus diesem fürchterlichen Krieg zurückgekommen bin. Stell dir nur mal vor, ich wäre bei Stalingrad eingesetzt worden. Das Leid dort war unermesslich groß. Von 300.000 deutschen Soldaten wurden 90.000 gefangen genommen und von diesen kamen vor einem halben Jahr nur 9000 zurück.“
„Bei Gott, mein liebes Herbert’l, ich denke genauso wie du. Ich bin so glücklich, dass ich dich wiederhabe und denke einmal an unseren Klausmann – wie wichtig das ist, dass er seinen Vati zurück hat.“ Auf alle Fälle musste ich wieder einmal zum Simonbäcker und zum Fleischer Leistner, was Gott sei Dank ja gleich nebenan war. Inzwischen hatte ich eine große Errungenschaft und zwar ein 28er Fahrrad mit Vollgummibereifung. Mein Vater hatte dieses Rad irgendwoher besorgt – es fehlte aber die Bereifung. Nun kam aber ein Glücksumstand dazu. Vater war ja bekanntlich Einkäufer. Offensichtlich war aber selbst für ihn in der günstigen Situation, an der Quelle zu sitzen, dies in der damaligen Zeit recht schwierig. Eine Gummibereifung mit Schlauch war einfach nicht zu besorgen und Vater war glücklich, mir diese Vollgummilösung präsentieren zu können. Er kam mit dem strahlendsten Lächeln der Welt mit seiner ILO nach Hause und hatte vier Meter von diesem Hartgummi als Ring um Hals und Schultern zu hängen. Wir schnitten das dann auf die exakte Länge, wobei wir unheimliche Probleme mit dem Trennvorgang hatten. Ich erinnere mich noch gut an die vielen fruchtlosen Versuche, wo ich das Gummiding mit den Händen halten musste, dieses aber nicht recht zu Wege brachte, da bei dem versuchten Schnittvorgang immer viel zu viel seitliche Kräfte auftraten, die mir den Gummi aus den Händen rissen. „Klaus, verdammt nochmal, halte doch nun endlich mal den Gummiring fest! Man merkt eben doch, dass du noch ein ziemlich kleiner Junge bist. Dir fehlen halt noch die großen Muskelpakete!“ Angesäuert schaute ich auf Vati. „Verfügst du über die großen Muskeln, Vater?“ Er hielt inne, hob energisch den Kopf und ich sah schon, wie sich die Zornesader anfing zu formen. Nun sah er in mein zartes Kindergesicht, welches deutlich zeigte, dass ich mich sehr angestrengt und bemüht hatte. Ihm wurde sofort klar, dass er falsch lag und dass ich schon alle meine Kraft eingesetzt hatte. Ich bin überzeugt, dass seine enorme Liebe und Anhänglichkeit zu mir sofort das in die Zornesader fließende Blut zurückbeorderte. Er lachte freundlich und lieb zu mir. „Ist schon gut, Kumpel. Hast ja dein Möglichstes getan. Warte ab, wir schaffen das! Ich gehe mal zum Herrn Woitanowsky, der hat doch einen Schraubstock.“ So wurde dann der Protagonist fest in diese eiserne Zwangsjacke eingespannt (ich musste nicht mehr halten) und mit einer Eisensäge exakt zertrennt. Dann mussten die Enden noch mit Eisendraht fest miteinander verbunden werden. Dazu mussten seitlich Schrauben in den Gummi hineingedreht werden, welche dann durch den Eisendraht miteinander fest verzurrt wurden, indem wir die Enden des Drahtes mit einer Zange fest verdrehten. Dieses musste aber rechts und links des Gummiringes passieren und zwar so, das Schrauben und Draht nicht mit der Straße in Berührung kommen konnten. Wir hatten also damit eine ganz schöne Aufgabe. Es dauerte über zwei Stunden – dann konnte ich losradeln. Es war natürlich bei weitem nicht so komfortabel wie bei einer Luftbereifung. Es polterte und rumpelte in einem fort und wenn die Stoßstelle die Straße berührte, gab es ein derbes Pipp, Popp – man muss sich aber im Klaren sein, dass dieses Pipp, Popp jeweils für Vorder- und Hinterrad galt. Also radelte ich mit ständigem Gerumpele und fortwährendem Pipp, Popp, Pipp, Popp zum Simonbäcker und wieder zurück. Natürlich war das auch viel anstrengender, da die Reibung zwischen Vollgummi und Straße offensichtlich stärker war als bei Luftbereifung. Spott gab es natürlich auch – von wem sonst, als dem Escher, Elmar. Wenn die Eule mit dem Vollgummi zum Simonbäcker springt und die Wurscht verschlingt … Er versuchte mich, wie üblich, aufzuhalten, was ihm aber nicht gelang, da ich voll auf ihn zu fuhr und drei Meter vor ihm einen ziemlichen Haken mit meinem Superfahrrad schlug. Schlagartig wurde mir wiederum klar, wie sehr mir Lothar und seine Unterstützung fehlte. Es war ja aber leider nicht mehr zu ändern – die wunderschöne Zeit der Großfamilie auf dem Bauerngut Straßburger war eben passé.
Der Sonnabendabend mit dem geplanten Essen rückte immer näher und die Hektik in der Küche und vor allem bei Mutti nahm immer mehr zu. Als ich in der Stube Schularbeiten machen wollte, ergab sich, dass dort eingedeckt werden musste und so war auch dieser Arbeitsplatz für mich im Moment nicht nutzbar. Also ging ich zum Klose, Günther und wir stromerten durch die Gegend. Schmutzig und verdreckt kam ich nach Hause und wurde sofort mit unwilligen Vorwürfen, sowohl von Mutti als auch Vati, überschüttet. „In einer Viertelstunde kommen unsere Gäste und du siehst aus, Klausmann, wie durch den Schlamm gezogen. Wasche dich sofort, zuvor musst du aber deine verdreckten Sachen ausziehen und die Schuhe im Wasserbad abbürsten!“ Es war wieder einmal Hektik und ich schmollte. „Muss das sein? Immer diese blöden Gäste! Nichts kann man mal in Ruhe tun, nicht mal die Schularbeiten erledigen!“ Etwas hektisch, aber trotzdem freundlich schaute mich mein Vater an. „Sohnemann – sonst bist du doch auch nicht so übereifrig im Erledigen deiner Hausaufgaben. Sollte dies jetzt ein neuer, schöner Beginn auf diesem Gebiet sein? Mich würde es sehr freuen!“ Ich schaute ihn an, dachte nach und mir war absolut klar, dass mich Vater ein klein wenig oder doch etwas mehr auf die Schippe nahm. Also knurrte ich nur etwas vielsagend vor mich hin und schwieg. Das erschien mir am Schlauesten. Vater hatte aber gar keine Zeit mehr und hetzte der Restaurantchefin und Oberkellnerin Mama hinterher, mit dem Ziel, all das in der verbleibenden Viertelstunde zu schaffen, was sie sich vorgenommen hatten, bis die Gäste eintreffen. Dazu kamen sie aber nicht mehr, denn plötzlich donnerte es (mir kam es vor wie mit zwei Fäusten) an unsere Wohnungstür. „Klaus, schau mal nach und öffne die Tür!“ Ich öffnete. „Tachchch, ich weiß, ich bin etwas zu früh, aber ich bin ja an den Bus gebunden!“
„Guten Tag, Herr Opel, ich sag meinen Eltern Bescheid.“ Die beiden hatten das schon mitbekommen und riefen: „Komm rein, Hugo, ist schon in Ordnung. Setz dich einstweilen in die Küche – der Klaus wird dich betreuen!“ Gott sei Dank hatte Herr Opel nicht gehört, was Mutti entnervt mit halblauter Stimme, einen Moment vorher, von sich gegeben hatte. „Der Hugo kann einem wirklich auf den Geist gehen. Ich sehe schon jetzt seine Schlammstiefel vor mir – und dann noch zu zeitig kommen!“ Vati schaute erschreckt auf Mutti, hielt den rechten Zeigefinger senkrecht auf die Lippen und brummelte erschreckt: „Pst, pst – bist du verrückt, Gretel?“ Gleich rechts von der Eingangstür stand ein Stuhl. „Herr Opel, bitte sind Sie so gut, nehmen Sie Platz. Meine Eltern kommen gleich.“ Hugo setzte sich hin und streckte die Stiefel weit von sich. Von Beruf war er Förster, riesengroß und hatte immer äußerst schmutzige Stiefel. Ich habe Herrn Opel nie anders als in beträchtlicher Schräglage sitzen gesehen. Vor allem jetzt, wo er warten musste, hatte er fast eine 45 Grad Neigung. Aber auch sonst, wenn er in Gesellschaft am Tisch saß, war seine Körperschräge bemerkenswert und oftmals beschwerten sich die ihm gegenüber Sitzenden, da sie mit seinen Füßen in Kollision kamen. Herr Opel hatte grundsätzlich einen grünen Lodenmantel an und auf dem Kopf einen grünen Hut mit Gemsbart. Wenn er Mantel und Hut abgelegt hatte, sah er aber immer noch komplett grün aus, da er eine grüne Hose, grünes Hemd und grüne Jacke trug. Er war vielleicht fünfundfünfzig Jahre alt und nach den Bemerkungen meiner Eltern ein urtypischer Junggeselle. Er lebte allein und Mutti sagte häufig: „Mich interessiert brennend, wie es bei dem zuhause aussieht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da alles ordentlich, sauber und frisch geputzt ist. Und außerdem möchte ich mal wissen, wie er sich denn so versorgt, denn kochen kann der keinesfalls. Sicher schlingt er nur Gekauftes aus dem Papier in sich hinein. Es ist für mich absolut verständlich, dass da überhaupt keine Frau einen Bock darauf hat, mit ihm zusammen zu sein.“ Da er häufig bei uns war, konnte ich auch miterleben, wie das dann war, wenn Minustemperaturen waren und das Eis an seinen Stiefeln auftaute. Sofort bildeten sich regelmäßig um die Stiefelfersen (mit Sicherheit hat er eine Schuhgröße von 26 - 28), denn nur mit denen hatte er Bodenberührung, kleine Pfützen, die immer größer wurden und am Ende schon als Lachen bezeichnet werden mussten. Mutti kam dann immer mit einem Scheuerhader und Eimer angeflitzt, trocknete und wischte den Fußboden, aber auch seine Stiefelenden, denn die waren ja letztlich die Verursacher der Dreckorgie. Glücklicherweise war der Untergrund Linoleum, so dass keine bleibenden Schäden entstanden. Nun kamen aber meine Eltern, einverstanden, etwas nervös und aufgeregt, aus der Stube. „Hugo, schön dich zu sehen, hast du deinen Dienst am deutschen Wald heute erfolgreich zu Ende gebracht?“
„Ja, ja, Gretel, mir ist etwas sehr Dummes passiert. Ich wollte euch doch als Gastgeber eine Flasche selbstgemachten Stachelbeerwein mitbringen. Ich habe ihn leider vergessen, sehr peinlich!“ Mutti schaute verständnisvoll und lieb, wie immer. „Ist nicht so schlimm, Hugo – bringst sie eben das nächste Mal mit!“ Plötzlich sah sie auf seine Füße, die in riesenlangen Stiefeln steckten, welche schon zwei braune Schmutzlachen und ein paar kleine Schlammbatzen, mit etwas Gras darin, auf dem frisch gebohnerten Linoleum hinterlassen hatten. Augenblicklich schlug ihre gute Laune in zornige Kratzbürstigkeit um. „Aber, Hugo, bei aller Liebe, wir erwarten außer dir noch sieben Gäste und das kannst du denen und uns nicht antun! Die Stiefel müssen auf der Stelle runter – du bekommst ein paar Hauslatschen – und ich kann unser schön gepflegtes Linoleum wieder in Ordnung bringen!“ Vater schaute erstaunt. „Du bist doch einverstanden, Hugo? Die Gretel hat schon Recht – es sollte so sein, auch für unsere Besucher!“, versuchte er mit sanfter, ich fand, leicht bebender Stimme, zu vermitteln. Es war aber auch zu erkennen, dass Herr Opel ziemlich irritiert war. „Das war doch noch nie bei euch notwendig. Ich hab doch meine Filzhausschuhe gar nicht mit.“
„Du warst ja auch noch nie in der Stube, wo unser bester Perserteppich liegt. Bisher waren wir ja nur hier in der Küche, wo du vor dich hinschmanden konntest“, hängte sich Mutti mit inzwischen ziemlich zittriger Stimme hinein. „Außerdem bekommst du von uns ein paar Pantoffeln, was Herbert schon erwähnte. Nun aber endlich los – mir wird so sachte angst, denn unsere Gäste kommen und ich muss auch sehen, dass meine schönen Steaks nicht verbrennen und so weiter und so fort. Ich hab viel zu tun!“
„Gretel, du warst doch bisher immer so sanft. Was ist denn los heute? Bei mir zuhause habe ich einen wunderschönen Stiefelknecht, der im Vorsaal fest im Fußboden verankert ist und oben habe ich eine Reckstange, die mein Vorgänger immer für sportliche Übungen benutzt hat. Was denkt ihr denn, wie schwer das ist und wie viel Kraft das erfordert, die Stiefel runter zu zerren?“
„Hebe doch mal dein rechtes Bein, Hugo. Ich ziehe jetzt. So schwer kann das doch gar nicht sein. Du weißt, ich habe Bärenkräfte“, sagte Vater und trat in Aktion. Zuvor muss ich sagen, dass mein Vater zwar nicht sehr groß (wie schon erwähnt – sehr zum Leidwesen meiner Mutter), aber, für meine Begriffe, enorm muskulös war. Sein Brustkorb war enorm. Vater zog und ich fand, dass dies mit enormer Zugkraft geschah. Ich ertappte mich dabei, dass ich genauso wie Vater vor Anstrengung mitstöhnte, obwohl ich nur zusah. Hugo hielt sich an seinem Stuhl fest und zog dagegen, aber es passierte nicht viel, d. h. der Stiefel löste sich keineswegs vom rechten Fuß. Jetzt wurde Mutti, die zwischenzeitlich nach ihren Steaks geschaut hatte, so richtig energisch. Für mich war es in dieser hektischen Art das erste Mal und sehr erstaunlich. „Also, Herbert, streng dich an! Nein, besser, ich ziehe mit, sonst sind die anderen da, ohne dass hier etwas Entscheidendes passiert ist!“ Um es kurz zu machen – Mutti kochte vor Wut. „Herbert, lege beide Hände um die Ferse und ziehe wie ein Bulle! Ich lege meine Hände über deine und versuche mein Maximales! Ziiiiiiiiiehe – jetzt!“ Beide waren knallrot im Gesicht, besonders Vater, seine Zornesader trat hervor und war so prall wie nie zuvor. Außerdem keuchten sie wie wahnsinnig! Hugo klammerte sich am Stuhl fest und versuchte den Fuß im Stiefel zu bewegen, damit er locker wurde. Herbert schrie: „Gretel, meeeehhhehr!“ – und stöhnte wie verrückt. Schlagartig löste sich der Stiefel (wahrscheinlich durch die inneren Bewegungen von Hugo) und mit angstvollem, lautem Geschrei stürzten Herbert und Gretel auf ihren Rücken. Ehrlich gesagt – ich war sehr erschrocken. Man hörte nur noch, wie beide jammerten. Besorgt hörte ich, wie Vater ächzte und lamentierte. „Mein Hintern! Oh, tut das weh. Das ist ja fürchterlich!“ Ich stürmte zu den beiden hin. Mutti stand schon wieder, war etwas irritiert und schüttelte sich, war aber wieder gut drauf. „Hugo, geschafft! Das kannst du nicht noch einmal mit uns machen! Um Himmels willen! Herbert’l, was hast du denn?“ Ich versuchte, Vater aufzuhelfen, hatte aber zu wenig Kraft. Er schaffte es mit der rechten Hand an die Türklinke zu kommen und zog sich hoch. Dabei stöhnte er mächtig gewaltig. Mir wurde regelrecht angst. „Vati, wo tut es dir denn weh?“
„Ach, ich bin hier oberhalb vom Hintern auf den Rücken gefallen und das schmerzt enorm.“ Er zeigte mit dem Handrücken oberhalb vom Popo und Hugo rief: „Herbert du bist auf dein Becken geflogen. Das kann lange dauern, bis der Schmerz vergeht, weil das dort meist geprellt ist!“
„Du machst mir ja mächtig Hoffnung, Hugo. Wegen dir …“ Weiter kam er nicht, denn es klingelte. Mutti ließ die Gäste herein, die alle auf einen Schlag gekommen waren – Herr Jesus und Frau, Hartmann, Hagen und seine Frau Gerdi, Ursula, Schäfer, Bernd und seine Frau Leni – großes Begrüßungsszenario! Etliche riefen: „Was ist denn los, Hugo? Wieso hast du nur noch einen Stiefel an? So was aber auch!“ Nachdem Mutti alle abgeschmatzt und begrüßt hatte, erklärte sie: „Wir haben gerade, Herbert und ich, mit Gewalt Hugos rechten Schmutzstiefel heruntergezerrt. Beim plötzlichen Lösen sind wir zwei auf den Rücken gestürzt und Herbert hat sich wahrscheinlich das Becken geprellt. Das war vielleicht eine Kraftaktion! Na eben! Wer hilft denn nun dem grünen Oberförster bei der Aktion Linker Stiefel runter, ohne auf den Rücken zu fallen?“ Alle Gäste schauten belustigt, begriffen irgendwie, dass hier eine ziemlich peinliche Situation, geradeso, bewältigt wurde und Hilfe für den Rest der Aktion vonnöten war. Die sonst nur sinnloses Zeug redende Leni, benahm sich plötzlich und erfreulicherweise recht praktisch. „Bernd und Hagen, ihr kräftigen Kerle, nehmt euch mal Hugos linken Stiefel vor, damit endlich einmal Ruhe wird und unsere Feier beginnen kann!“ Die beiden ließen sich nicht zweimal bitten, feixten kurz, bückten sich und zogen gemeinsam. Mit einem kräftigen Ruck war das Ganze geschafft. Bei dem Stimmengewirr und Begrüßungsdurcheinander wurde ich übersehen und dachte nach. Mit mir sind es damit elf Personen. Ich schaute bei dem Durcheinander einmal in die Stube, da ich wegen der Anzahl der Stühle Bedenken hatte. Das Sofa auf der Längsseite und die Liege auf der anderen lösten aber das Problem. Na gut, dachte ich. Ist ja nicht mein Problem. So dürfte es schon gehen. Dann kamen alle in die Stube und plötzlich wollten mich alle gleichzeitig begrüßen, wahrscheinlich, weil sie mich in dem Begrüßungstrubel einfach übersehen hatten. Das war ich aber schon gewöhnt. Nachdem sich das Begrüßungsgeplapper im Taubenschlag etwas gelegt hatte, gab es nur ein Thema. „Nun erzählt mal, was mit dem Hugo und seinen Stiefeln los war und warum dir dein Hinterviertel weh tut, Herbert.“ Mit immer noch leicht schmerzverzerrtem Gesicht erzählte mein Vater, Mutti ergänzte und Hugo saß unangenehm berührt da. Man sah es deutlich daran, wie er die Mundwinkel nach unten zog und leicht stöhnte. Offensichtlich war es ihm fürchterlich unangenehm, so im Mittelpunkt zu stehen und dazu noch mit solchen schlechten Nachrichten über ihn selbst. Alle lachten und machten so ihre Späße auf Kosten derer, die irgendwie leicht angeschlagen und geschädigt waren, so wie das halt in solchen Situation üblich ist. „Herbert, da wirst du nicht mehr mit deiner ILO auf Arbeit fahren können. Überleg dir mal, wenn die Erschütterungen von der Straße über dein Motorrad bei deinem Becken landen, Auweia! Die Liebe mit deiner Gretel im Bett ist nun endgültig vorbei. Bei solchen Beckenschäden muss man vorsichtig sein bei jeder Bewegung des Unterleibes.“ Sofort schaltete sich seine Frau Gerdi ein. „Schäme dich, Hagen, du sollst nicht immer so frech sein!“ Trotzdem schob er noch nach (und bekam dafür nun aber einen ernsthaften Ellbogencheck in die Rippen). „Das mit der nicht mehr möglichen körperlichen Liebe kann ein Leben lang dauern, sehr traurig für euch, Gretel und Herbert!“ Schäfer, Bernd beschäftigte sich mehr mit dem Förster. „Sage mal, du Waldarbeiter, musst du denn immer solche riesenlangen Stiefel anhaben, die den armen Herbert ins Verderben bringen, nicht ausziehbar sind, wie sich hier wieder einmal gezeigt hat, und überall Schmutz und Dreck hinterlassen!“ Jetzt war Herr Opel aber richtig beleidigt. Nicht nur die Mundwinkel blieben unten, auch die Oberlippe ging schmerzhaft auf eine Seite. Er war tief in seinem Inneren getroffen und beleidigt. „Bernd, du hast überhaupt keine Ahnung! Man merkt deutlich, dass du nur ein Bürohengst bist und von der Natur überhaupt keine Ahnung hast! Im Wald müssen wir nun mal geschützt sein gegen Steine, Geröll, sogar Schlangen und andre Unbill, die da auf uns zukommen kann!“ Plötzlich wurde er knallrot, verlor die Beherrschung und schrie: „Du bist so ein richtiges Büroarschloch! Ich werde jetzt die Gesellschaft verlassen, da ich hier nicht hingehöre!“, stand auf und wollte die Stube verlassen. Vater sprang erschrocken auf, legte eine Hand mit schmerzverzerrtem Gesicht auf sein Becken. „Hugo, das kannst du uns nicht antun, nachdem wir dir so fein die Stiefel ausgezogen haben und ich dabei fast im Krankenhaus gelandet wäre!“ Alle lachten und freuten sich königlich. Auch all die anderen redeten auf Hugo ein. „Sei doch nicht so beleidigt, sei ein Mann, wir wollen doch jetzt mit dir königlich speisen, Förster. Du kannst doch nicht schmollen wie ein kleines Kind!“ Man sah deutlich – Hugo war beeindruckt. Und, man muss es ja auch einmal so sehen, was sollte er denn zuhause? Keiner erwartete ihn, zu essen gab es auch nichts, also gab er von sich: „Ihr seid aber manchmal ganz schöne Biester und habt kein Verständnis dafür, wie schwer es ein Mensch hat, der von früh bis spät, bei Regen, Wind und Sturm im Freien ist“ und setzt sich wieder hin. Alle schmunzelten spöttisch und schadenfroh. „Ach, du armer Großwildjäger. Wie schwer du es doch in deiner Natur hast. Musst stundenlang auf dem Anstand sitzen. Das ist schlimmer als richtig schwer im Steinbruch zu arbeiten. Nun setze dich endlich hin und gib Ruhe, damit die Gretel ihr Supermenü auftragen kann. Hier, iss ein paar Hauspflaumen aus Schäfers Garten.“ Auf dem Tisch stand eine große Schüssel mit schönen dunkelblauen Pflaumen. Ich hatte auch schon häufig gekostet – einfach ein Genuss. Am meisten aber aß der Schäfer, Bernd selbst, obwohl er sie für alle anderen mitgebracht hatte, bis er plötzlich mit der erneut zugreifenden Hand zurückzuckte. „Schmecken wunderbar, aber jetzt ist Schluss! Die viele Blausäure bekommt meinem Corpus gar nicht gut!“ Dabei schaute er mich an. Offensichtlich hatte er diese Bemerkung für mich gemacht. Jetzt meldete sich aber noch einmal der Hartmann, Hagen. „Jetzt habe ich den Eindruck, dass das Thema mit dem Stiefelausziehen vom Hugo und dem Hinstürzen von Gretel und Herbert und der Beckenschädigung abgeschlossen ist. Damit das Thema nun einmal richtig ausgereift wird, müssten wir darauf einen richtigen Schnaps trinken. Herbert, ihr habt doch gemäß der neuen Regelung einen Schachtschnaps, den ihr einmal im Monat bekommt. Ich meine den Kumpeltod. Das wäre doch etwas, um den ganzen Ärger und Schmerz runterzuspülen.“
„Keine Frage, das ist ein guter Gedanke, du alte Säuferseele, Hagen“, bestätigte Vati und holte schnurstracks eine Halbliterflasche, welche mit (ich dachte, es wäre Wasser, denn so sah es aus) dem erwähnten Kumpeltod gefüllt war. Mutti holte ein paar kleine Schnapsgläser und Vater füllte fleißig ein. Frau Jesus fragte interessiert: „Herbert, wieso heißt denn das Kumpeltod?“
„Einfach deshalb, weil dieser Schnaps für die Bergleute, d. h. Kumpels unter Tage, als Anerkennung und Entschädigung für ihre schwere Arbeit gedacht ist. Wir im Büro bekommen aber auch etwas davon ab.“
„Auf euer Wohl – vor allem, dass die Schmerzen im Becken bei Herbert vorbeigehen und er bald wieder lachen und auch das wieder erledigen kann, von dem wir vorhin gesprochen haben, nicht wahr, liebste Gretel?“ Jetzt schimpfte aber Mutti: „Schluss mit den frivolen Andeutungen – zum Wohl!“ Alle tranken und verzogen durchweg das Gesicht, vor allem die Frauen, die das halbvolle Glas wieder hinstellten und sich schüttelten. „Ihr habt schon recht – das ist wahrhaft ein Kumpeltod!“ Nun ging es endlich ans Essen. Alle Frauen halfen Mutti beim Auftragen. Ich saß neben Mutti, etwas auf die Ecke gedrängt und durfte natürlich mittun. Ständig fragte mich Mutti: „Schmeckt es denn, Klaus?“ Ich bejahte immer, obwohl ich ehrlich sagen muss – so berauschend war das Ganze gar nicht. Außerdem interessierten mich die Reden der Erwachsenen über wunderbare Steaks, Lenden, deren Zubereitungszeiten, Spargelsuppe und all diesen Kram betreffend nicht die Bohne. Schlichtweg – es war für mich langweilig. Nicht so für die Erwachsenen. Sie aßen mit Genuss, klapperten, schmatzten und plapperten, wie eigentlich immer, über Gebühr. Es war und blieb eben ein Taubenschlag. Sie redeten über die Faschingsveranstaltung bei Leistners und wie schlecht es ihnen am Tag darauf ging. Mutti erzählte ihre Story von der Umbestellung der Bauern durch Ursula, da sie nicht in der Lage war, die Beratungen zu führen. Ich sah sie noch in Gedanken mit ihrer Sturmhaube zum Fenster wanken, als sie dann Ursula ihr Vergehen beichtete. Vati schien es wieder besser zu gehen. Er hatte eine Superlaune und war, wie immer, der Mittelpunkt der Gesellschaft. Im Witzeerzählen war er immer Spitze und erzählte sehr viel – alle bogen sich vor Lachen (na ja, Ursula vielleicht nicht, sie war die Einzige, die nur vornehm und zurückhaltend lächelte). Meinen persönlichen Lieblingswitz, den er mir mindestens fünfmal schon erzählt hatte, brachte er auch an. Oma Elsa und Fritzchen sind zu Besuch bei einer vornehmen älteren Dame. Mitten im Kaffeetrinken ruft Fritzchen plötzlich äußerst aufgeregt „Omma, Omma, Omma! Sieh mal dort an der Wand – eine Wanze!“ „Ach, Fritzchen, du dummer Junge, du kleines Dummerle, das ist doch ein Nagel! Und nun sei endlich still!“ Oma Elsa ist das Ganze wahnsinnig peinlich und sie hofft innig, das Fritzchen nun endlich Ruhe gibt. Fritzchen ist auch wirklich zunächst still, meldet sich aber nach geraumer Zeit, vollkommen aufgelöst „Omma, Omma, Omma – sieh mal, jetzt looooft der Nagel!“ Er erzählte wahnsinnig viel, unterhielt alle mit seinen Anekdoten und Witzen und was markant war an seiner Art – er belustigte sich selbst am meisten. Schon beim Erzählen, noch mehr kurz vor der Pointe und dann bei dieser selbst, schüttete er sich fast vor Lachen aus und ich hatte den Eindruck, dass die meisten mehr über meinen Vater lachten als über den Witz selbst. Mutti fragte während des Essens: „Wünscht noch jemand Nachschlag an Sauce?“ Vater bestätigte und nachdem Mama diese gebracht hatte, monierte er: „Gretel, die ist aber nicht mehr ausreichend heiß, schade.“ Mutti konterte: „Herbert, sei nicht immer so pingelig. Die Sauce ist heiß genug.“ Vater wiegte den Kopf hin und her, schmunzelte. Dann lachte er schallend. „Es ist doch eiiiiiigenartig, dass die Frauen immer Recht haben wollen.“ Er brannte sich erneut eine ovale Zigarette von Leni an (meiner Meinung nach war es schon die achte, was mir überhaupt nicht passte, denn es roch schon fürchterlich in unserer Stube) und sagte: „Da fällt mir noch ein schöner, aber trauriger Witz dazu ein. In einem Ort ist ein Mord begangen worden und ein Ehepaar streitet sich hinsichtlich der Tatwaffe. Der Mann sagt: „Es war eindeutig ein sehr langes Messer.“ Die Frau behauptet stur und steif, es wäre eine Schere gewesen. Sie streiten und streiten – die Angelegenheit kulminiert und der Ehemann bekommt eine fürchterliche Wut und Rachsucht auf seine Frau: „Wenn du noch einmal behauptest, es wäre eine Schere gewesen, dann drücke ich dich in unserem Swimmingpool unter Wasser.“ Die Frau sagt kalt: „Das kannst du wegen mir tun – es war aber eine Schere!“ Der Mann kocht, zerrt seine Frau zum Swimmingpool und drückt sie unter Wasser. Nach kurzer Zeit lässt er sie wieder Luft holen und fragt: „War es immer noch eine Schere?“ Die Frau holt hastig Luft und sagt bestimmt: „Wie sollte sich das bei deiner blöden Aktion geändert haben? Selbstverständlich war es eine Schere!“ Der Mann dreht durch und drückt seine Frau längere Zeit unter Wasser, so dass sie halb erstickt hochkommt und auf seine provokante Frage, nach Luft schnappend angibt: „Es war eine Schere und es bleibt eine Schere!“ Der Zorn bei dem Ehemann nimmt immer mehr zu und er drückt seine Frau so lange unter Wasser, dass nur noch ein paar Luftperlen nach oben dringen. Plötzlich kommt aus dem Wasser eine Hand nach oben, macht mit dem Zeigefinger und dem großen Finger eine Schere, die mehrfach auf und zugeht. Dann verschwindet der Arm im Wasser.“ Vater lachte sich wiederum halb tot und die Gesellschaft mit ihm. Mir gefiel der Witz überhaupt nicht, denn für mich war es gar keiner. Ich fühlte mit der armen Frau, sie tat mir herzlich leid. So was Blödes aber auch, Vater! Dieser Witz, nachdem Frauen immer Recht haben wollen, war für die Schäfers Anlass, sich gleich wieder gegenseitig Vorwürfe zu machen. Vor allem Leni schimpfte auf ihren Mann, was darin gipfelte, dass er überhaupt kein Interesse mehr an ihr und bereits eine Freundin habe, eine auch aus Kleinwaltersdorf. Mir wurde die Sache nun bald zu dumm und ich verzog mich in die Küche, las in meinem Buch von Lederstrumpf, was mir Tante Frida geschenkt hatte. Zu sehr später Stunde kam endlich das Ende der Zusammenkunft. Der Riesenlärm, welcher zuvor von der Stube zu mir in die Küche drang, mich beim Lesen störte, schwappte auf einmal mit voller Wucht in die Küche. Mit einem Wort, der Taubenschlag wurde von der Stube in die Küche verlegt, leerte sich aber so sachte. Mir fiel allerdings auf, dass fast alle – bis auf Ursula – anders waren als sonst, aufgedreht, enorm laut, brüllend und schreiend, laut lachend und fast alle hatten mit dem Gleichgewicht Probleme. Mich nervte das gewaltig und ich antwortete nur ganz zurückhaltend auf die vielen Fragen, zum Beispiel, ob ich froh sei, dass nun wieder Ruhe eingekehrt, ob ich mich auf den nächsten Tag in der Schule freuen würde und lauter solchen Blödsinn. Ich hatte schlechte Laune, las weiter in meinem Buch. Meine Eltern räumten auf, wuschen auf. Der Teppich in der Stube wurde mit dem Staubsauger abgesaugt. Plötzlich: „Das kann doch nicht wahr sein, Herbert. Hier liegt noch eine Kippe – sicherlich von der Leni. Das ist aber nicht in Ordnung!“ Vater trocknete fleißig ab und der gesamte Küchentisch wurde voller Geschirr gestellt. Ich saß auf dem Sofa und hatte für mein großes, dickes, fettes Lederstrumpfbuch höchstens fünf Zentimeter vom Tisch zur Verfügung. Unwillig schob ich mit dem schweren Buch, vielleicht zehn Zentimeter weit, das Geschirr zurück. Da knallte es jählings auf der anderen Seite des Tisches – dort, wo mein Vater fleißig abtrocknete. Gestapelte Teller und auch zwei Schüsseln und eine Sauciere knallten in die Tiefe und zerschellten. Die beiden hatten sich noch unterhalten – plötzlich herrschte eisige Stille. Ich war mir der Bedeutung meiner überhasteten Tat schlagartig bewusst. Auweia! Mutti wurde aschfahl im Gesicht, Vater stand vor Schreck plötzlich wie zur Salzsäule erstarrt. Ich brammelte tonlos: „Verzeihung, das wollte ich nicht!“ Nach geraumer Zeit, die mir wie eine Ewigkeit erschien, sagte Mutti: „Das war ein Teil des Rosenthaler Porzellans, was der gute Johann aus unserem zerbombten Haus in Chemnitz geborgen hat.“ Vati drückte Mutti, schaute zu mir und sagte: „Klaus, du musst immer vor jeder geplanten Handlung nachdenken, bevor du sie ausführst.“ Dann stöhnte er herzerweichend, kniete sich hin und arbeitete mit Handbesen und Kehrschaufel. Dabei ächzte er beträchtlich, ob wegen des großen Schadens oder wegen seiner Beckenschmerzen blieb ungeklärt. Mutti saß da und schaute still zu. Noch heute wundere ich mich als Erwachsener, wie entgegenkommend sie mir diesen enormen Schaden verzeihen konnten. Zwei Fragen kommen mir in den Sinn. Erstens: Weshalb hat mein Vater mir nicht sofort die strenge Marschroute verpasst, das zerbrochene Porzellan aufzunehmen und zu entsorgen? Und zweitens: Weshalb kam mir denn nicht in den Sinn, bzw. was hat mich denn eigentlich geritten, nicht sofort schuldbewusst aufzuspringen und wenigstens die Entsorgung zu übernehmen? Da mir natürlich, moralisch und seelisch, vollkommen beklommen zumute war, wählte ich den Weg zur Toilette, genauer gesagt zu dem fürchterlichen Plumpsklo, wo mir die kalte, stinkende Luft, die von unten nach oben blies, die Sinne noch völlig vernebelte.