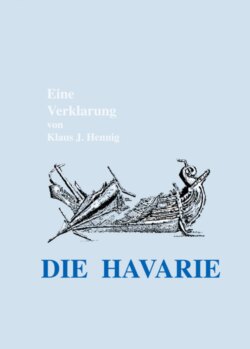Читать книгу DIE HAVARIE - Klaus J. Hennig - Страница 10
VIII
ОглавлениеDer tote Briefkasten war derzeit eine Höhlung unter einer Bodenplatte des Grabmals eines Munnius, der sich schon vor drei oder vier Generationen zu seinen Vätern versammelt hatte. Brennesseln wucherten zu beachtlicher Höhe und hielten die Reisenden davon ab sich hier zu erleichtern. Näher an der Straße mußte man aufpassen wo man seinen Fuß hinsetzte und Zartbesaitete hielten sich die Nase zu. Dieser Teil der Nekropole vor der Porta Romana konnte von der belebten Straße aus nicht eingesehen werden, und Philippos hatte dem Vorschlag amüsiert zugestimmt, den Nachrichtenaustausch mit dem Tabularium ausgerechnet hier vorzunehmen. Philippos war Arzt im Haus der heutigen Munnius, immer noch crème de la crème der Importeure und Reeder in Ostia. Diesmal hatten sie wissen wollen wer da neu ins Seeamt gekommen war, in wie gearteten Beziehungen der zu wem stünde, so das übliche für ein erstes Dossier.
Bald darauf hatte er den Griffel im Seeamt plaziert, einen verschlagenen griechischen Gemeindesklaven aus dem neuen Hafen, der seinen Namen wegen seines überaus schlanken Penis bekommen und freudige Erleichterung gezeigt hatte, von den salzigen Matrosenärschen wegzukommen und sich den Friseur in der Forumstherme leisten zu können. Auf dem Seeamt hatten sie genügend Schreiber, es war relativ kostspielig gewesen, diesen Griechen dort unterzubringen. Aber selbst Beamte des höheren Dienstes sind manchmal knapp bei Kasse ... Mit Unbehagen dachte Philippos an die Auseinandersetzungen mit seinen zwei OBEs, von denen er sich seine Auslagen erstatten lassen mußte. Die taten immer so als ob sie selbst das Geld auf Galeeren verdienen mußten, dabei hatte die Behörde alle Quellen des I.R. zur Verfügung, saß am Forum Romanum direkt neben dem Saturnustempel wo der Staatsschatz lagerte.
Doch für Informationen über D. Aelius Tullius war er nicht nur auf den Griffel angewiesen, denn dieses Ostia war ein einziges großes Quatschnest. Auf dem Forum und besonders bei den maritimen Corporationen hinter dem Theater galt der neue Sachbearbeiter des Kaiserlichen Seeamtes als ein wenig bemerkenswerter, mäßig befähigter, älterer Beamter, der in Gallien oder Germanien seine Zeit beim Militär abgesessen hatte und dessen juristische wie nautische Kenntnisse zu unbedeutend waren, als daß sie ihm den Haarausfall eingebracht haben könnten, unter dem er offensichtlich zu leiden begann. Von einer Wesensart wie Land und Wetter der Batavier, sagten einige, die sich da auskannten, also irgendwie grau und unzugänglich, kalt. Ältere nannten ihn einen 'verkehrten Claudius', weil er, anders als der vorige Kaiser, nicht selbst bei seinen Amtshandlungen einschlief, sondern die Beteiligten gähnen machte.
Einiges erfuhr er auch von den Albinozwillingen, den Haussklaven des Ex-Senators. Einige Tage, nachdem dieser ausgemusterte Feldwebel erstmals frühmorgens zur üblichen Klientelstunde in der Villa am Meer erschienen war, hatte L. Aelius Aquila mit einigen Bekannten zu Abend gegessen. Niemand von außerhalb, aus Rom etwa, ausschließlich hiesige Hautevolee. Philippos kannte sie alle, kannte ihre Wehwehchen, denn sein Eigentümer lieh ihn bei Bedarf an Familien seines Standes aus, so wie man es auch mit einem Sklaven zu tun pflegte, der ein besonders guter Koch war.
Die Aquilaeische war bei weitem nicht die ausladenste in der Reihe der Villen, die sich südlich der Tibermündung am Meer hinzog, aber ihre Proportionen, ihre Ausstattung konnten einem das Wasser im Maul zusammenlaufen lassen. Der zur Straße gewandte Trakt war zweistöckig, von seinen Enden zogen sich die beiden Seitenflügel westlich gegen das Meer hin. Der Eingang von der Straße war schmucklos, abweisend fast. Zwei Halbsäulen unter einem nur angedeuteten Portikus. Doch schon das Atrium war in pompejanischem Rot gehalten, in hellem Grau und Weiß die Grisaillen. Stelzvögel und Wasserpflanzen, Kraniche, Reiher. Die Bodenmosaiken in schlichten, schwarz-grau-weißen, geometrischen Ornamenten, zu den Wänden hin in ein raffiniertes Blau übergehend. Vom Triclinium aus konnte man, in Gesprächspausen beim Essen, hinter dem Peristyl das Meer hören. Wenige Skulpturen, die aber von erlesener Qualität. Eine Diana zeigte den schönsten Bronzearsch, der jemals einem Griechen gelungen war. Die Penaten dagegen primitiv, barbarisch, wie aus grauer Vorzeit. Uralter Familienbesitz sicherlich. Das Mosaik des Wasserbeckens nahm das Atriumsmotiv auf, variierte es in blau und grün. Im Südflügel die Bibliothek, viermal so groß wie der Schlafraum daneben. Das Ganze aber von einer Intimität, einer Atmosphäre, von der man nur träumen konnte.
An besagtem frühen Morgen war Tullius der einzige Besucher und dem Ex-Senator zu dieser Zeit noch völlig unbekannt. Die Zwillinge hatten anfangs versucht, ihn nicht einzulassen, was einem beinahe einen gebrochenen Arm eingebracht hatte. Welchem von ihnen war Philippos gleichgültig, er war schließlich nicht verknallt in sie. Das war nur der dicke Ex, dem Tullius an diesem Morgen seine Lebensgeschichte erzählen sollte, das heißt, er hatte kaum dazu angesetzt, als er schon unterbrochen wurde: Gewiß, gewiß - an einen Ziegeleiverwalter Cosimus könne er, Aelius Aquila, sich vage erinnern.
»Verstehe, mein Vater damals den deinigen freigelassen. Müßte zu meinem achtzehnten gewesen sein, hatte viele freigelassen damals. Diese Ziegeleien über dem Tiber, diesem Steilufer da, sag mir, mein Lieber, alles in Ordnung da derzeit? Erwarte eigentlich Abrechnungen.«
Tullius hatte eben angesetzt zu erklären, daß angesichts seiner zwanzig Jahre in Gallien und Niedergermanien die Fortexistenz der Geschäfte in einigen Schuppen und Brennöfen am Uferhang des oberen Tiber ihm eigentlich nicht gegenwärtig sein könne, als der Ex glücklich abwinkte, geistesabwesend fragte, ob er schon gefrühstückt habe, um, ohne eine Antwort abzuwarten, wieder in den Ozean seiner Erinnerungen einzutauchen. Was immer Aelius Aquila an diesem fernen Tage seines achtzehnten Geburtstags im weiteren erlebte, Tullius hatte verstanden, daß er als Klient seines verfetteten Patrons zum Zuhören verurteilt sein würde.
Bei dem erwähnten Abendessen in der Villa am Meer war Tullius' Zukunft in Ostia eher beiläufig besprochen worden, irgend etwas Subalternes in einer der hiesigen Behörden würde sich für einen altgedienten Feldwebel und Zahlmeister immer finden lassen, ganz köstlich, diese Wachteln, woher beziehst du sie?
Zur Herkunft der Vögel, der Koch hatte sie mit Feigen und Thymianhonig geschmort, konnten die Zwillinge artigen Bescheid erteilen, zu Tullius blieben sie maulfaul. Sie schienen ihn wirklich nicht zu mögen. Erst als Philippos ihnen einige der Möglichkeiten andeutete, die einem Arzt zur Verfügung stünden, der der Bitte des Hausherrn, sich einmal seine Sklaven anzuschauen nachkäme, eine kurze Schilderung endoskopischer Instrumente genügte - sie erinnerten sich an gewünschte Details. Danach war dieser Tullius ein eher atypischer Klient des Hauses Aquila, ging weder Geschäften nach, an denen der Patron zu beteiligen war, noch hatte er Darlehen bei ihm aufgenommen oder gedachte dies zu tun. Und nach zwanzig Jahren in Legionsbaracken hatte er einen Rechtsanspruch auf eine Beamtenstelle, benötigte im Grunde also die Hilfe seines Patrons gar nicht.
Der Griffel sprach über ihn nur mit hochgezogenen Augenbrauen, mokant, als lägen Welten zwischen ihnen. Dieser gemütsarme Kommißkopf habe jetzt zum ersten Mal einen Fall, über den man sich in der Stadt die Mäuler zerrisse. Schadenfreude. Man riebe sich die Hände, weil die Geldsäcke aus Trastevere jetzt nicht mehr zurück könnten, schon der Kautionen wegen, die zu stellen waren, damit die Anwälte den Orion-Fall überhaupt anfaßten. Wieviel Geld sie in dem Unternehmen hätten, wüßten natürlich nur sie selbst. Jetzt steckten sie mit den Hiesigen die Köpfe zusammen, draußen vor der Porta Marina in ihrer Synagoge. Der kleine Tempel, der eigentlich nur Lauf von den Tiberschiffern hatte, könne die Aufgeregten kaum fassen; man 'zerbösere' sich.
Hinter dem Theater bei den Corporationen dagegen sah man sie eher gemessen auftreten, wollten sich wohl keine Blößen geben dort. Beliebt oder nicht, für die Reedereien und seemännischen Berufsvereinigungen sind sie wichtigste Kundschaft. Den Verlust der Orion hätten sie endlich offiziell anhängig gemacht, Unterschlagung und Kreditbetrug unterstellt, bestritten Ort und Zeitpunkt, den Hergang der Havarie, sogar diese selbst. Stritten um Ort und Zeit und Sesterzen gegen alle und jeden, auch untereinander. Und hätten doch so gut wie nichts in der Hand. Luftgeschäfte, meinten die Spötter, von ihren dreißig Prozent für Seekredite weiter entfernt als von den Pyramiden am Nil.
Auch auf dem Seeamt am Tiberius-Forum bedauerte niemand Tullius, der den Anwälten aus Trastevere keineswegs gewachsen schien; es sah einfach nach einer spannenden Würfelpartie aus. Unstrittig war nur, daß die Orion Getreide geladen und, unter militärischer Bewachung, auch Gefangene an Deck hatte, als sie den lycienischen Hafen Myra verließ, an einem Herbsttag vor nun fast zwei Jahren. Die Frage ist nur, warum sie nicht in einem kretischen oder griechischen Hafen überwintert hatte. Der Soldaten und Gefangenen wegen? Die waren immerhin zu ernähren. Oder ging es mehr um den Wert der Ladung, um die Winterpreise, die man in Rom für Brotgetreide zu zahlen bereit war? Zur Persönlichkeit des Schiffers, eines syrischen Freigelassenen, hörte man bei den Corporationen, wo man ihn zu kennen schien, daß sie ihren Ausdruck in einer nicht alltäglichen Mischung aus Halsstarrigkeit und Geldgier fände. An seinen seemännischen Qualitäten hegte jedoch niemand einen Zweifel. Doch blieb es einstweilen bei Mutmaßungen über einen Abwesenden, von dem es hieß, das Seeamt suche ihn dringend, wenngleich bislang ohne jedes Ergebnis, zu einem Vernehmungstermin einzubestellen.
Inzwischen sank die Stimmung und stiegen die Kosten derer aus Trastevere, die, auf eben diesen Termin wartend, täglich übelgelaunter die Geschäfte der Kneipiers und Herbergswirte in Ostia belebten. Die Gerüchte wucherten wie das Unkraut im Aprilregen. Natürlich wurde auch mit Wonne an den weithin beliebten Seewurf erinnert, das Überbordwerfen von Ladung in angeblich schwerer Seenot, die in Wahrheit irgendwo an Land verkauft worden war. Dieser Brauch war so populär geworden, daß die kaiserlichen Behörden inzwischen hart durchgriffen, bei leisem Verdacht schon schwere Folter gegen mögliche Beteiligte anwendeten.
In den Tavernen bot man die ersten Wetten an: »Daß man nicht würde finden dem Schiffer oder dem Steuermann, daß man möchte se finden und se möchten beschwören dem Seewurf, daß alles verkäuft ist, Schiff, Gefangene und Ladung, und de Seeleut' halbe-halbe gemacht mit de Herren Soldaten.«
Beim Gamaliel, wo alles doppelt so teuer war, weil sie dort auf koschere Küche achteten, gab man sich gedämpfter. Gewiß, die Schuldfrage, gäbe es denn eine, müsse geklärt werden zuerst. Man wolle doch, rechtlich denkend und Gott soll schützen, niemals nicht etwas präjudizieren, aber angenommen, und man hat gehört, daß Sprüche dieser Art schon ergangen sind amtlicherseits, also angenommen den Schiffer, und angenommen man findet ihn, träfe alle Schuld - ja, dann nähmen die Zores doch überhaupt erst ihren Anfang.
»Sein Schiff, möglich schon alt, war es noch seetüchtig?«
»War es überhaupt sein Schiff? Besaß er wenigstens Anteile an dem, was möglich nur noch nasses Kleinholz ist?«
»Möglich, jemand kennt ihn?«
»Möglich, man könnte klären, ob er hat ein Eigentum auf'm Land?«
»Ein Haus.«
»Eine Landwirtschaft.«
»Ein paar Sklaven.«
»Man könnte pfänden...«
»Mer kann nuscht pfänden einem Schiff, wos liegt oif'm Grund vom Meer und in Stickel. Brotweizen, wos liegt auf'm Grund vom Meer, ist nicht mehr zum verkäufen. Weil - er ist naß und mer kann ihn nicht finden!«
»Von wos is de Red', an keinem Tag nicht hat gehört die Ladung dem Schiffer. Bar Meir Lev in Alexandria haben expediert und in Trastevere hatten se's vorfinanziert und spekuliert oif'm Termin.«
»Wie viele noch haben gegeben auf die Ladung Kredite und glauben bis heut' sie wären die einzigen dabei? Wenn dieselbe Fracht, dieselbe Reise sagen wir nur fünf-, sechsmal finanziert wird, und keinem Banker weiß nichts vom anderen, und das Schiff liegt oif'm Grund vom Meer, so ist der Schiffer e reicher Mann. Er muß nur überleben.«
»Hat man geschrieben Bodmerbriefe in Myra?«
»Und wenn man nicht findet dem Schiffer?«
»Wenn man findet ihn und er hat nicht eine Schuld?«
Denn, war das zu glauben, keine Todesopfer sollte es gegeben haben bei diesem Schiffbruch, wo immer er stattgefunden haben mochte.
»Alle Seeleut' sind geblieben am Leben, alle Soldaten, sie haben nicht hingemacht einem Gefangenen und kein einer ist vertrunken in diesem Meer, ich weiß es von einem, wo dabei war, ein Wunder sag ich.«
»Wer läßt Gefangene am Leben in einem solchen Schlamassel?«
»Was ist mit'm Rebbe Schaule? Schaul aus Tarsos? In Rom soll er sein, schon mehr als ein Jahr?«
»Er is gewejn oif dem Schiff Orion. Er hat gerettet alle. Es is ihm gescheh'n e Wunder oif dieser Insel. Nu in Rom er be'etzt unsere Leut. Messias is schojn gekommen, sogt er, und is auch an ihm e Zeichen gescheh'n, als er ist nicht gestorben ist von der Schlange oif der Insel, und er sogt de Leut man soll nicht mehr leben nach der Halacha, Gott soll schützen!«
Auf welcher Insel? Dutzende zwischen Judäa und Italien, Hunderte, wenn man auch die unbewohnten zählen möchte. Viele griechisch oder barbarisch, manch eine römisch wie Delos. Wäre es nun an einer römischen Insel geschehen, hätte da nicht der claudinische Erlaß noch Gültigkeit, und die kaiserliche Kasse bezahlte das verlorene Getreide? Bei Schiffsverlusten in der Winterfahrt?
Wie gesagt, Aelius Tullius hatte ein Problem, dessen finale Dimension Philippos zunächst nicht klar war. Er schien nur ein Appendix des Ex-Senators zu sein, sein Klient, nicht mehr. Erst als er ihn einmal auf dessen Bitte chirurgisch behandelte, ergab sich die Möglichkeit einer Exploration, einer sicher noch oberflächlichen Anamnese, wie im Folgenden ausgeführt:
Betr. D. Aelius Tullius, Ermittlungsbeamter, Seeamt hier, Sohn eines Freigelassenen der Aeliusschen Ziegeleien am oberen Tiber. Volle Bürgerrechte. Zwanzig Jahre Militärdienst in Niedergermanien. Anhänger des Mithraskultes. Alleinlebend, keine engeren Freundschaften. Heterosexuell orientiert, seltene Kontakte zu Prostituierten, Masturbation überwiegt. Neigt zu Geiz. Alkoholkonsum für ehemaligen Militär eher mäßig, empfindet auffällige Abneigung gegen möglichen Kontrollverlust. Verdeckte Symptome neurotischer Aggressionsunterdrückung. Chronisches Epidermis-Syndrom, wahrscheinlich psychogen: Kratzspuren in allen Abheilungsstadien im Haarbalg am Kopf, im Schamhaarbereich, auch an Schienbeinen u. Kniekehlen. Vermutlich eine biographiebedingte Störung der Reizverarbeitung in Form nachhaltiger vegetativer Affektreaktionen, bedingt-reflektorischer Fehlfunktion oder psychischer Fehlentwicklung. Eine Organneurose, bzw. psychosomatische Störung mit ihren körperlichen Symptomen scheint evident. Die Abgrenzung zur Psychoneurose ist jedoch schwierig, letztere ist lediglich in unbestimmten charakterlichen Veränderungen wie Kontaktstörungen, Selbstunsicherheit, depressiver Verstimmung zu vermuten.
Gez. IM Aesculap
Wenn er derlei unter der Bodenplatte zwischen den Brennesseln am Munniusgrabmal abgelegt und durch den Latrinengestank zur Straße zurückgefunden hatte, fragte er sich, was Lupus Mielus, seine OBEs, damit wohl anfangen mochten. Beschwert hatten sie sich in all den Jahren noch nicht, waren wohl zufrieden, ihren Vorgesetzten damit Diensteifer und anschwellende Aktenbestände vorweisen zu können.