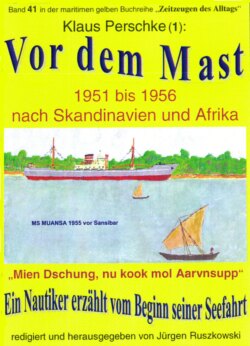Читать книгу Vor dem Mast – ein Nautiker erzählt vom Beginn seiner Seefahrt 1951-56 - Klaus Perschke - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Meine ersten Schritte an Bord eines schwimmenden Untersatzes
ОглавлениеNachdem ich im März 1951 aus der Volksschule entlassen worden war, ging es zunächst darum, dass mein Vater mir seine schriftliche Einwilligung zur Seefahrt gab. Seine Vorurteile konnte ich in einem andauernden Gespräch inhaltlich ungefähr so abfedern: „Zum einen fahre ich nicht nach Halchter zur Gerda, da ich keine Lust auf Landwirtschaft und Kuhstallausmisten habe“, worauf mein Vater konterte: „Aber die Landwirte sind schon immer gut durch die mageren Jahre gekommen.“ Als er noch der große Oberzahlmeister von Führers Gnaden war, wollte er mich in Paris Kunst studieren lassen. Doch jetzt, wo der Führer ihn in Stich gelassen hatte, sollte ich mein künstlerisches Talent im Kuhstall eines Gutshofs verbraten! Verrückt! Egal, er merkte, dass er mir nicht mit seinen Drohungen und schon gar nicht mit der Landwirtschaft imponieren konnte. Außerdem bestand für mich die Chance, dass ich aus dem verdammten Steckrüben- und Kohlsuppen-Speiseplan meiner Mutter ausbrechen und dem Chef eventuell Tabakwaren von Bord mitbringen konnte. Also, die erste Hürde war geschafft. Jetzt ging es darum, eine vernünftige Arbeitsbekleidung für den zukünftigen Seemann zu organisieren. Da ich immer noch die Fischkutterkarriere im Kopf hatte, brauchte ich nun in erster Linie „wullen Ünnertüüg“, warme wollene Unterwäsche aus Mako, denn die war entscheidend beim Arbeiten an Deck, um auch bei Kälte und Nässe gesund durch den Winter zu kommen. Da die Fischerei auch bei schlechtem Wetter stattfindet und man dabei öfters nass wird, war es wichtig, Wollklamotten auf dem Körper zu tragen. Aber die waren teuer, jedenfalls für einen arbeitslosen Vater. Dazu kam kräftige Oberbekleidung (wullen Obertüüg), z. B. zwei Buscherumps (Arbeitskittel), wullen Pullover, wullen Strümp, gleich mehrere Paare, wullen Fischerbüx, die ingelnschleddern Büx, eine Arbeitshose aus Baumwollstoff, Hultpantinen (Holzpantinen) und Eultüüg, früher geöltes Leinenzeug, wie es mein Vater noch als Leichtmatrose und Matrose getragen hatte, nach dem letzten Krieg gab es bereits schon Gummijacken und die Gummiüberhosen und die dazugehörigen Gummistebel, also Gummistiefel mit Rosshaarsocken. Man konnte den Einkauf beim Seemannsausrüster anschreiben lassen und in Raten abbezahlen. Wir taten das auch, weil wir keine andere Wahl hatten. Nur den Zampel (Seesack) konnte mein Vater von sich aus beisteuern, denn den hatte er aus britischer Gefangenschaft gratis mitbekommen.
Als nächstes war das Seefahrtbuch fällig.
Doch dieses gab es nur auf Vorlage der väterlichen Einwilligung, und, wenn der Vertrauensarzt der Seeberufsgenossenschaft in Cuxhaven grünes Licht gab. Ersteres konnte ich dem Beamten der Heuerstelle übergeben.
Der Vertrauensarzt unterzog mich einer kritischen Untersuchung, wobei der Farbunterscheidungstest eine wichtige Rolle für die spätere Laufbahn an Bord darstellte. Die Ergebnisse dieser Untersuchung wurden im Gesundheitspass eingetragen und an die SeeBG nach Hamburg übermittelt. Aus dem Gesundheitspass konnte man entnehmen, ob man für den Decks- oder den Maschinendienst qualifiziert war. Mein Vertrauensarzt hielt mich für die Deckslaufbahn tauglich. Ich durfte also an Deck und später in weiter, weiter Ferne vielleicht als Nautiker auf der Brücke den Wachdienst ausführen.
Wieder war eine Hürde genommen und am 6. April 1951 wurde mir in Cuxhaven vom Seemannsamt das Seefahrtbuch mit der Nummer 243/51 ausgehändigt
Mein erstes Seefahrtsbuch, ausgestellt am 6. April 1951 vom Seemannsamt in Cuxhaven.
Die letzte Hürde war der fehlende schwimmende Untersatz. Der Zufall wollte es, dass der Hochseekutter „DOGGERBANK“, HF 400 zu diesem Zeitpunkt gerade im Hafen vor der Drehbrücke am Bunkerkai lag. HF 400 hatte Getriebeschaden. Ich machte mich also auf und besuchte den Schipper Jan Külper, den ich noch von unserer Begegnung im Sommer 1950 kannte. Ich begrüßte ihn ehrfurchtsvoll, und er konnte sich auch noch an den Jungen, der das „Vater Unser“ durch die Backen blasen konnte, erinnern. Und dann fragte ich mit stockendem Atem, ob die Chance noch bestehen würde, bei ihm an Bord anzumustern. Tja, viel gab es an Bord nicht zu tun, denn sie lagen an der Kaimauer und warteten auf Ersatzteile des Getriebeherstellers. Dann, als der Bestmann noch dazu gekommen war, beschnackten sie die Frage, „neuer Moses an Bord oder nicht“, denn der alte hatte vorher gerade abgemustert. Nach einiger Zeit einigten sie sich und gaben mir ihr Einverständnis, dass ich anmustern könne. Dieser Moment war für mich umwerfend. Am nächsten Morgen nahm ich meinen Zampel (Seesack) und schleppte ihn von der Gorch-Fock-Straße bis zur Drehbrücke im Alten Hafen, wo die meisten Kutter Gasöl bei der Firma Glüsing bunkerten. Der Bestmann führte mich nach vorn unter die Back, damit ich den Zampel auspacken und die Koje beziehen konnte.
An- und Abmusterung auf FK Doggerbank, HF 400
Was war das also für ein Fischereifahrzeug? Nun, der FK DOGGERBANK war ein Stahlkutter, der in der mittleren Nordsee fischte und eine Vermessung von 63,55 BRT und eine Länge von 19,21 m hatte. Er war einer der ersten Fischkutterneubauten nach dem Krieg, also 1946 auf der Kremer-Werft in Elmshorn gebaut worden. Die Eigner waren W. Tietgen und A. Naatz, und der Kutter sollte noch im gleichen Jahr nach Chile verkauft werden. Nun aber lag er „nicht betriebsklar“ in Cuxhaven und wartete auf Ersatzteile. Das hieß jeden Tag Verdienstausfall, keine Fische im Netz und im Fischraum. Für den Schipper ein nerviges Warten. Keine gute Stimmung. Wie sollte es weitergehen?
Es ging nur 14 Tage gut, da sagte der Schipper, Jan Külper, zu mir: „Moses, dat het keen Tweck mehr. Du musst wedder afmustern. Ick kann di nich mehr betohlen. Wi fangt nix un de vadammte Getriebereparatur duart imma länga, seug di n annern Kutter, Dschung!“ Das war höhere Gewalt. Es sollte also nicht sein, dass ich Fischer werden sollte. Also musste ich den alten Seesack wieder packen und zurück zu den Eltern in die Gorch-Fock-Straße. Das war damals die traurige Realität für meinen Anfang.
Ein jämmerlicher Anfang in der so genannten Christlichen Seefahrt. Wie sollte es weitergehen? Zurück in die Buchhandlung? Damit die anderen sich totlachten? Keinesfalls! Ich wollte beweisen, dass ich durchhalte, meinen eingeschlagenen Weg weitergehe. Ein gekränkter trotziger Junge im Alter von 16 Jahren !
Mein Vater hatte nach dem Motto gehandelt: „Man kennt einen Freund, der wiederum einen Freund kennt“. Der Berufseintritt wurde dadurch ziemlich erschwert, dass es gerade Ende der vierziger, Anfang der fünfziger Jahre eine Schwemme von arbeitslosen Kriegsmarine- und Handelsschiffsseeleuten gab, die an der Küste in die sich gerade wieder entfaltende Seefahrt hinein drängten. Auf einen Platz an Bord bewarben sich zehn Arbeitslose. Also der „Freund“ meines Vaters war ein Cuxhavener Kriegskamerad, gebürtiger Finkenwerder, den mein Vater in britischer Kriegsgefangenschaft kennen gelernt hatte, und beide waren fast zur gleichen Zeit nach Cuxhaven entlassen worden. Paul Meier, mein großer Gönner und ehemaliger HAPAG-Offizier, Inhaber des nautischen Patents A6 (Kapitän auf Großer Fahrt), stammte aus einer alteingesessenen Finkenwerder Fischerfamilie. Seine Eltern und Geschwister lebten alle noch in Finkenwerder. Selbstverständlich hatte er dort auch seine alten Schummis, Schulfreunde, die selbstständige Fischkuttereigner und auch Küstenschiffer waren. Wohl eher aus Mitleid ließ er seine Beziehungen in seine alte Heimat spielen. Mit Erfolg.
Da war ein Kumpel aus alten Tagen, der ein Jahr nach Kriegsende, also 1946, als man die Küstenschifffahrt wieder erlaubt hatte, mit seiner alten Nobiskruger „BERTA VON BUSCH“ nach Flensburg segeln wollte.
So sah der ehemalige Nobiskruger Dreimaster „BERTA VON BUSCH“ aus.
Auslaufend Kieler Förde nahm er eine Abkürzung, die leider quer durch ein Minenfeld verlief, welches nicht in jeder normalen Seekarte eingezeichnet war. Mit diesem Abkürzungsversuch war er mit seiner BERTA VON BUSCH über eine Mine gelaufen und in die Luft geflogen. Bei diesem Unglück verlor Kapitän Fritz von Busch nicht nur seinen Matrosen, sondern auch seine Ehefrau, die damals an Bord als Koch und Leichtmatrose mitfuhr. Er und sein Schiffsjunge überlebten schwer verletzt den Untergang des Motorseglers und kamen in Kiel in die Universitäts-Klinik, wo Kapitän von Busch über ein ganzes Jahr verbringen musste, um wieder zusammengeflickt zu werden.
Nachdem er endlich als geheilt aus dem Krankenhaus nach Finkenwerder entlassen worden war, gab er in Finkenwerder bei der August-Pahl-Werft Mitte 1950 einen Neubau in Auftrag. Am 21. März 1951 war Stapellauf und am 21. Juni 1951 fand die Übergabe an den Eigner Fritz von Busch und die Probefahrt auf der Elbe statt.
Das Küstenmotorschiff war für die damalige Zeit ein sehr moderner Neubau, seine Vermessung nach dem Oslo-Abkommen betrug 299 BRT und 127 NRT. Getauft auf den Namen „ACHILLES“ hatte er eine Länge über alles von 42,52 m, eine Breite von 7,83 m und einen Tiefgang im Seewasser von 2,30 m. Sein Klassenzeichen: +100 A4KE, bei seiner Klassifikationsgesellschaft der Germanische Lloyd.
MS „ACHILLES“ – Eigner: Kapitän Fritz von Busch, Indienststellung am 19.Juni 1951
Das Kümo hatte eine Klöckner-Humboldt-Deutz-Hauptmaschine, 6 Kolben mit 650 PS, allerdings mit gedrosselter Maschinenleistung. Weiterhin hatte das Küstenmotorschiff etwas für damalige Zeiten relativ Neues: es hatte eine Vorpiek und Doppelbodentanks, die man sowohl als Ballasttanks als auch für die Aufnahme von Gasöl, also Bunker, unterteilen und verwenden konnte. Dieses war in der Konstruktionsphase von der Schiffswerft eingeplant und festgelegt worden.