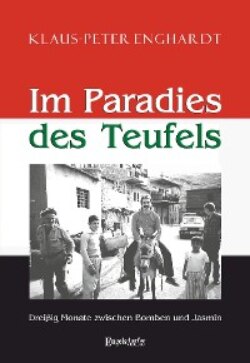Читать книгу Im Paradies des Teufels - Klaus-Peter Enghardt - Страница 9
DAS CAMP, DIE BAUSTELLE, BAGDAD UND DER MITTELIRAK
ОглавлениеAm vierten Juni 1982 wurde ich, gemeinsam mit einigen Kollegen, auf die neue Baustelle in der Wüste, nahe der Stadt Falludscha umgesetzt.
Falludscha war zu jener Zeit eine Stadt mit etwa 60.000 Einwohnern, allerdings mit Vororten. Die Stadt selbst kam mir gar nicht so groß vor.
Bevor man in die Stadt hineinfahren konnte, musste man erst den Euphrat überqueren. Das geschah über eine Pontonbrücke und war eine recht wackelige Angelegenheit. Wenn man den Euphrat passiert hatte, fuhr man an unansehnlichen Häusern, Hütten und kleinen Läden vorüber, ehe die Hauptstraße so etwas wie einen Stadtcharakter offenbarte.
In der Ortsmitte befand sich der Basar, der allerdings nach dem ersten Besuch bereits nicht mehr attraktiv genug war, um ihn ein zweites Mal zu besuchen. Er war klein, unscheinbar und hatte ein sehr begrenztes Angebot. Da machte es vielmehr Spaß, am Straßenrand entlang zu schlendern und in den kleinen Läden zu stöbern oder an den Ständen davor. Ich habe dort so manche Rarität gefunden.
Falludscha, eine fast ausschließlich von Sunniten bewohnte Stadt, war eine der wichtigsten Unterstützer des Saddam-Regimes.
Sie wurde bis zum Ende des Jahres 2013 zu einer bedeutenden Industriestadt ausgebaut in der fast 400.000 Einwohner lebten, ehe sie am vierten Januar 2014 in die Hände der Terrororganisation Islamischer Staat fiel.
Saddam Hussein investierte Millionen in die Entwicklung der Infrastruktur dieser Stadt, die mit einer Ringautobahn umgeben ist und Anschlüsse zu den bedeutendsten Städten im Mittel-und Nordirak besitzt. Ihre nahe Lage zu Bagdad war attraktiv genug, dass sich in Falludscha zahlreiche Regierungsangehörige, führende Funktionäre der Baath-Partei und hohe Militärs ansiedelten.
Während des zweiten Golfkrieges wurden die Stadt und die Gegend um Falludscha als „Sunnitisches Dreieck“ bezeichnet.
Seit ihrer Einnahme im Jahr 2014 war Falludscha eine Hochburg der gefürchteten Dschihadisten und Salafisten der Terrororganisation „Islamischer Staat“. Auch das nahe Ramadi wurde von den Terroristen eingenommen, konnte jedoch Ende Dezember 2015 von der irakischen Armee nach schweren Kämpfen zurückerobert werden.
In der Nacht zum dreiundzwanzigsten Mai 2016 begann die Irakische Armee eine Großoffensive, um Falludschah von den Dschihadisten zurückzuerobern. Zuvor waren die Zivilisten aufgefordert worden, ihre Stadt zu verlassen.
50.000 Personen die dazu nicht mehr in der Lage waren, blieben in der Stadt zurück. Kampfverbände der irakischen Armee, die irakische Luftwaffe und die Luftwaffe der US Air Force griffen die Stadt an.
Am dreißigsten Mai 2016 teilte die Irakische Armee mit, dass sie nun auf das Stadtzentrum vorrückt.
Nach wochenlangen schweren Kämpfen gab die irakische Nachrichtenagentur INA am sechsundzwanzigsten Juni bekannt, dass Falludscha vollständig von der irakischen Armee eingenommen worden war und die Terrormiliz IS vertrieben wurde.
Unsere Unterkünfte im Camp nahe Falludscha bestanden aus sogenannten Kuwaithäusern. Dabei handelte es sich um klimatisierte Stahlbungalows mit drei Räumen für neun Leute. Zu diesen Kuwaithäusern gehörte ein moderner Sanitärtrakt, der ebenfalls aus drei Containern bestand.
Wir waren zu Beginn der Baumaßnahme etwa zwanzig Leute, aber im Zuge des Baufortschrittes stockten wir auf über dreißig Kollegen auf.
Dazu kamen dann noch einmal etwa vierzig ägyptische Arbeitskräfte.
Das war ein zusammengewürfelter Haufen, den unsere Firma in Bagdad bei einer Arbeitsvermittlung angemietet hatte.
Im Grunde waren es Glücksritter, die versuchten, für ihre Familien in der Fremde etwas Geld zu verdienen. Manche waren vorher bereits schon zwei Jahre meist als Tagelöhner ohne feste Arbeit in diesem Land unterwegs gewesen.
Oft standen diese Menschen schon am frühen Morgen an der Karrada oder an der Saadun Street und hofften, dass irgendjemand eine Arbeitskraft suchen würde, um den größten Hunger stillen zu können und sei es auch nur für einen Tag.
Der Arbeitsvertrag in unserer Firma war für die Ägypter wie ein Lottogewinn. Für Monate, eventuell sogar Jahre, hatten sie jetzt ein festes Einkommen zu guten Konditionen.
Die Männer entstammten allen sozialen Schichten, aber wenn man sie nach ihren Berufen fragte, gab es nur drei Antworten: Teacher, Driver, Ingeneer – also Lehrer, Kraftfahrer und Ingenieur.
Die Praxis sah allerdings ganz anders aus und war speziell zu Beginn der Baumaßnahme ziemlich anstrengend.
Ich wurde zur Vormontage eingeteilt. Schon nach relativ kurzer Zeit war ich Leitmonteur für einen deutschen Monteur und acht ägyptische Arbeitskräfte. Unsere Aufgabe war es, zeichnungsgerecht und mit möglichst geringer Toleranz die Wandsegmente und die Giebel im Rohbau vorzumontieren.
Meine ägyptischen Helfer bemerkten sehr schnell, dass ich umgänglicher war als manch einer meiner deutschen Kollegen. Sie versuchten ein freundschaftliches Verhältnis zu mir aufzubauen. Zuerst durchschaute ich ihre Freundlichkeit nicht, aber schon bald bemerkte ich, dass die mir angebotene Freundschaft eine bestimmte Absicht verfolgte.
Kurz nach dem Arbeitsbeginn bekam ich von einem der Ägypter eine Zigarette angeboten und wir machten eine Zigarettenpause.
Nach einer Weile bot mir ein anderer Ägypter eine weitere Zigarette an und wieder machten wir eine Zigarettenpause. Das wiederholte sich noch einige Male am Tag.
Aus Höflichkeit lehnte ich die mir angebotenen Zigaretten nicht ab. Das ging drei bis vier Tage so, bis mir die Lunge wehtat, weil ich bei der Hitze während einer Schicht täglich bis zu zwanzig Zigaretten geraucht hatte und dementsprechend Rauchpausen eingelegt wurden. Dann endlich hatte ich dieses System entschlüsselt.
Jeder der ägyptischen Arbeitskräfte war der Reihe nach dran, mir eine Zigarette anzubieten.
Als ich bemerkt hatte, dass ich ausgetrickst werden sollte, reagierte ich allerdings anders, als wohl erwartet wurde. Ich steckte mir die angebotene Zigarette in den Mund und arbeitete weiter und das Gleiche verlangte ich nun auch von den Ägyptern. Von diesem Zeitpunkt an rauchte ich kaum mehr als zehn Zigaretten am Tag und das waren meist meine eigenen.
Eines Morgens schrie ein ägyptischer Arbeiter voller Angst nach mir und zeigte mir eine riesengroße, haarige Vogelspinne, die in ein Ankerloch der Betonplatte unserer geplanten Halle gefallen war.
Im ersten Augenblick war ich ebenfalls ziemlich erschrocken und ich erinnerte mich an die Aussage der Kollegen, dass es auf dieser Baustelle viele Spinnen, Schlangen und Skorpione geben würde.
In jenem Moment allerdings verspürte ich merkwürdigerweise keinerlei Ekel oder Angstgefühl, ich war vielmehr von der haarigen Schönheit fasziniert, obwohl mir die Ägypter versicherten, dass diese Spinnenart sehr giftig sei. Mich beeindruckten ihre kräftigen Farben und ihre Wildheit, denn sie wollte sich mit ihrer Situation der Gefangenschaft nicht abfinden und sprang in diesem Ankerloch dreißig Zentimeter in die Höhe. Ich hielt der Spinne einen langen Holzspan entgegen und sie biss sich sofort daran fest. Vielleicht ahnte sie, dass ihre Rettung naht, vielleicht war es auch nur ein Reflex. Als ich das Tier mit dem Span aus dem Ankerloch holte, liefen die Ägypter entsetzt davon. Auch die Spinne nahm Reißaus und brachte sich in Sicherheit. Sicher war das Abenteuer für sie ebenso groß wie für mich.
Früh am Morgen, wenn wir die Baustelle betraten, sahen wir im Wüstenboden in den Sandverwehungen Spuren wie von ganz kleinen Spielzeugautoreifen, die unter unsere Materialcollies verliefen. Die ägyptischen Kollegen erklärten mir, dass diese Spuren von Skorpionen stammen würden. Merkwürdigerweise beunruhigte mich das weniger, als ich noch vor einiger Zeit gedacht hatte.
Um allerdings nicht von den Tieren gestochen zu werden, ordnete ich an, dass nur mit Arbeitsschutzhandschuhen gearbeitet werden dürfe und dass wir vor Beginn der Arbeit erst mit Knüppeln gegen die Collies schlagen müssten, um die Skorpione zu vertreiben, die unter dem Material Schutz vor der großen Tageshitze suchen wollten und gegen Lärm allergisch waren.
Das war dann ein Gewimmel. Manchmal kamen etwa zwanzig Skorpione unter den Collies hervorgekrabbelt, nachdem wir ordentlich Krach gemacht hatten.
Es gab auf unserer Baustelle drei verschiedene Arten von Skorpionen. Eine Art war gelb bis hellbraun, diese Tiere waren bis zu sechs Zentimeter groß. Eine andere Art war hellbraun bis dunkelbraun und bis zu acht Zentimeter groß und die größte Art waren schwarze Skorpione, die bis zu zwölf Zentimeter groß werden konnten. Diese Tiere sahen schon recht spektakulär aus und ich hätte es mir gern erspart, nähere Bekanntschaft mit so einem Tier zu schließen. Doch für den Ernstfall gab es eine Vorsichtsmaßnahme. Auf der Baustelle hatten wir in unseren Bauwagen Sanitätskästen, in denen Formulare lagen, auf denen in Deutsch, Englisch und Arabisch geschrieben stand, dass man entweder von einer Schlange oder einer Spinne gebissen oder von einem Skorpion gestochen wurde und um ein Antidot bat.
Sollte dieser Fall tatsächlich einmal eintreten, musste so ein Zettel in das nächste Krankenhaus mitgenommen werden, falls man nicht in der Lage wäre, sich zu verständigen.
Das nächste Krankenhaus befand sich in der Stadt Falludscha und war in etwa zwanzig Minuten zu erreichen.
Notfallmedikamente zur Selbstmedikation, gab es auf den Baustellen leider nicht. Warum dies nicht der Fall war, erfuhr ich von unserem Tropenarzt über zwei Jahre später.
Zum Glück trat der Ernstfall nicht oft ein, aber ich kann auch nicht behaupten, dass wir das Krankenhaus gar nicht in Anspruch genommen hätten. Denn, obwohl ich meinen ägyptischen Kollegen ständig einschärfte, nie ohne Arbeitsschutzhandschuhe zu arbeiten und auch sonst die täglichen Vorsichtsmaßnahmen nicht zu vernachlässigen, ließen die Ägypter ihre Handschuhe dauernd irgendwo liegen, entsprechend hoch, war der Verschleiß. Den Männern blieb im Fall eines Verlustes nichts weiter übrig, als ohne Handschuhe zu arbeiten, wenn ich nicht gerade in der Nähe war und neue Handschuhe ausgeben konnte.
Eines Tages erfolgte die Montage der Wandplatten auf die fertiggestellten Wandsegmente. Die Platten lagerten auf Stapeln und waren durch Spannbänder vor dem Verrutschen gesichert. Vor Ort wurden dann die Spannbänder von einem ägyptischen Kollegen entfernt und in Abfallbehälter gesteckt.
An jenem Tag hatte er wieder einmal seine Handschuhe verbummelt und löste die Spannbänder mit bloßen Händen. Ein Band hatte sich dabei unter dem Plattenstapel verklemmt, so dass der Arbeiter beherzt und ohne zu überlegen unter den Stapel griff, um das Band herauszureißen. Plötzlich hörte ich einen markerschütternden Schrei und gleich darauf aufgeregte Rufe der ägyptischen Arbeiter.
Sie kamen zu mir gelaufen und teilten mir mit, dass einen ihrer Kollegen ein Skorpion gestochen hat.
Obwohl der Stich erst wenige Sekunden zuvor erfolgte, war der Ägypter bereits fast leblos, als ich bei ihm ankam – jedenfalls machte er diesen Eindruck. Er lag schmerzverzerrt im Wüstensand und der Tod schien ihm bereits zuzuwinken.
Detlef holte seinen Toyota „Landcruiser“ und als wir den Verletzten in den Jeep legten, war plötzlich doch noch eine ganze Menge Leben in dem Mann. Der vorzeitige Feierabend und die Situation, im Mittelpunkt zu stehen, weckten seine Lebensgeister auf wundersame Weise.
In kluger Voraussicht nahmen wir einen ägyptischen Kollegen mit in das Krankenhaus, um die Verständigung zu erleichtern. Wir fuhren nach Falludscha in ein kleines, recht gut ausgebautes Hospital. Die Räume waren in Weiß und Grün gestrichen und sauber, das schaffte schon einmal Vertrauen. Wir gingen zur diensthabenden Ärztin und erklärten ihr, was passiert war. Eigentlich war es recht ungewöhnlich, dass eine Ärztin die Behandlung durchführte, aber auch im Irak hielt der Fortschritt Einzug.
Die Ärztin führte die beiden Ägypter wortlos in das Behandlungszimmer, in dem sich zwei Schwestern befanden.
Nach einem kurzen Behandlungsgespräch und einer noch kürzeren Untersuchung der Einstichstelle holte die Ärztin dann eine riesige Spritze hervor und plötzlich war sogar wieder ganz viel Leben in dem Ägypter.
Er sprang vom Behandlungstisch und wollte fliehen, aber da hatte er die Rechnung ohne die beiden Schwestern gemacht. Sie packten ihn und schleppten ihn unter allgemeinem Geschrei zurück. Die resolute Ärztin rammte ihm die riesige Spritze in den Oberschenkel, was zunächst einen unmenschlichen Schmerzensschrei des Patienten hervorrief und später in einen ohnmachtsähnlichen Zustand überging, als die Spritze wieder aus dem Oberschenkel herausgezogen wurde.
Sein Kollege bedauerte den Unglücksraben auf der Heimfahrt redlich und das linderte den größten Schmerz des Leidenden. Die Aussicht, ein paar Tage auszuruhen, tat ihm ebenfalls gut.
Der Ägypter war tatsächlich krankgeschrieben worden, doch nach zwei Tagen kam er wieder vergnügt zur Arbeit.
Allerdings war er nicht mehr dazu zu bewegen, seine alte Tätigkeit auszuüben. Ich musste mir für ihn also etwas anderes einfallen lassen und schickte ihn zu den Collies mit den Wandplatten.
Zum Schutz vor Korrosion und um ein Zerkratzen zu verhindern, wurden diese Wandplatten mit Ölpapier geschützt, doch das schützende Papier musste vor dem Verschrauben der Platten entfernt werden. Es wurde einfach zusammengerafft und in entsprechende Boxen gestopft. Dort blieb es so lange liegen, bis sich genug Papier angesammelt hatte. Zum Abtransport wurde dann ein Lkw mit flacher Ladefläche bestellt, der das Material in eine Abfallgrube brachte. War diese Grube voll, wurde das Material angebrannt.
An jenem Tag war es wieder einmal soweit, doch es war definitiv nicht der Tag des Ägypters.
Der ägyptische Kollege ging am Morgen vergnügt an seine neue Arbeit, raffte große Bündel Papier zusammen und verlud sie auf den Lkw.
Gemeinsam mit zwei ägyptischen Arbeitern verschraubten wir ein neues Wandsegment und waren in unsere Arbeit vertieft, als plötzlich wieder dieser mir inzwischen bekannte Wahnsinnsschrei erschallte.
Wie vom Blitz gefällt, stürzte der ägyptische Arbeiter um und im Nu waren die anderen Ägypter über ihm und rissen an seiner Kleidung herum.
Ich rannte zu dieser Gruppe und erfuhr, dass beim Verladen des Papiers eine Vogelspinne aus dem Papier direkt in dem Hemdkragen des Kollegen gefallen war, als er sich in die Höhe gereckt hatte.
Inzwischen war die Spinne zwar schon entfernt, doch sie hatte sich zuvor natürlich ihrer Natur gemäß verteidigt und den Ägypter gebissen.
Diesmal hatten wir riesige Mühe, den Mann in den Jeep zu bekommen.
Er hatte vor dem Tod weniger Angst, als vor der unvermeidlichen Spritze. Seine Angst war sogar so groß, dass wir an jenem Morgen zwei Ägypter zu Hilfe nehmen mussten und auch die nur unter größter Anstrengung Kontrolle über ihren Kollegen bekamen. Mit rasender Geschwindigkeit fuhr Detlef durch die Wüste nach Falludscha. Dieser Weg war wesentlich schlechter als der über die Landstraße, aber wir machten dabei noch ein paar Minuten gut.
Vor dem Krankenhaus angekommen, mussten wir jedoch feststellen, dass auch zwei Ägypter zu wenig waren, um den Mann aus dem Auto zu bekommen. Mit Händen und Füßen stemmte er sich gegen die Türholme und machte ein Mordsgeschrei.
Durch diesen Krawall wurden einige Beschäftigte des Krankenhauses auf uns aufmerksam und kamen aus der Eingangstür gelaufen, um uns zu helfen. Erst eine schallende Ohrfeige einer beherzten Schwester ließ den Widerstand des Ägypters für Augenblicke brechen. Diesen Moment nutzten wir, um ihn aus dem Auto zu zerren. Ein Pfleger, zwei Schwestern und die beiden Ägypter hatten Schwerstarbeit zu leisten, um den ägyptischen Kollegen in die Ambulanz zu bringen.
Detlef und ich beteiligten uns nicht an dem Kampf, denn das war eine interne arabische Angelegenheit, jedoch versäumten wir nicht, uns die nachfolgende Behandlung anzuschauen.
Als sie den Mann auf den Behandlungstisch geworfen hatten, hielt jeder Beteiligte einen Arm oder ein Bein fest. Eine Schwester stellte sich so, dass der Ägypter nicht sehen konnte, was für ein Mordsinstrument von Spritze die Ärztin aufzog – übrigens dieselbe Ärztin, die den Mann bereits wenige Tage zuvor behandelt hatte.
Die Spritze war beeindruckend und ich war von ihrer Größe überrascht. So eine Riesenspritze hatte ich zuvor noch nie gesehen, die Kanüle hatte die Stärke einer Stricknadel.
Wahrscheinlich waren der Klinik die Injektionsinstrumente für die Humanmedizin ausgegangen und man musste nun eine Spritze zur Hilfe nehmen, mit der man sonst Dromedare impfte.
Diese Riesenspritze wurde dem Ägypter in den Bauch gestoßen und ein wenig Schmerz verspürte ich dabei selbst.
Als Sekunden später der animalische Schmerzensschrei verhallt war, konnten wir den bedauernswerten Patienten zum Auto tragen, der nach dieser Prozedur zu einem wimmernden Häufchen Elend zusammengefallen war. Zum Laufen war er gar nicht mehr fähig und dieses Mal glaubte ich ihm seinen Schmerz unbesehen.
Er wurde erneut für ein paar Tage krankgeschrieben, kam dann aber nicht mehr auf unsere Baustelle zurück, sondern meldete sich bei der Arbeitsagentur in Bagdad.
Der nächste Arbeitstag begann wie immer damit, dass die Sonne glutrot aus der Wüste aufstieg. Die angenehme Kühle der Nacht wich schon bald nach Arbeitsbeginn einer rasch ansteigenden Hitze.
Jetzt war der Monat „Hizairan“ zu Ende und nun bekam ich auch den Rest meiner Frage vom Anreisetag beantwortet, wie heiß es überhaupt im Irak werden kann.
Die Mittagstemperaturen betrugen nun im Juli zweiundfünfzig Grad Celsius im Schatten.
Die Betonung liegt hierbei ausdrücklich auf Schatten, aber wo gibt es den in der Wüste?
Die unsägliche Hitze war fast unerträglich, die Sonne klebte wie Leim am Firmament.
Jeder Tag war ein neuer Kampf. Man schaute in den Himmel, und suchte eine Wolke, aber bis Ende Oktober, dem „Tashrin ith thani“ sollte es keine Wolken am Himmel mehr geben.
Jeder war erleichtert, wenn die Mittagszeit herangekommen war und uns die Busse in unser Camp zum Mittag essen fuhren.
Im Speiseraum war es angenehm kühl, aber unsere Körper waren so aufgeheizt, dass uns beim Essen und Trinken der Schweiß aus allen Poren brach, die Ellenbogen entlang lief und auf den Boden tropfte. Links und rechts neben jedem Sitzplatz entstanden kleine Pfützen. Nach dem Essen gingen wir in unsere Bungalows und nutzen jede Minute Pause, um uns etwas zu erholen.
Kaum auf das Bett gelegt, war man auch schon eingeschlafen.
Erst das Hupen der Busse schreckte uns wieder hoch. Ich hatte absolute Hochachtung vor den Busfahrern, die nie die Abfahrt verschliefen.
Zum Feierabend wurde dann geduscht und das war der einzige Moment am Tag, an dem man etwas fror. Das lag aber nicht etwa am kalten Wasser beim Duschen, denn kaltes Wasser gab es nicht. Vielmehr lag es daran, dass man nackt und nass ins Freie ging und der eigene Körper das Wasser herunterkühlte. Dieser Augenblick brachte einen wohlig kühlen Schauer, bis das Wasser auf der Haut verdunstet war.
Bei einem Ausflug an den Tharthar-See hatten wir endlich die Möglichkeit gefunden, baden zu können. Dieser See ist der größte im Irak und war genau einhundertzwei Kilometer von unserem Camp entfernt.
Nach einer Stunde Fahrzeit war der See erreicht.
Vorbei an Falludscha, über den Euphrat, dessen Brücken in der Stadt mit jeweils zwei Flak-Stellungen gesichert wurden, ging es eine Schnellstraße entlang direkt bis an den See.
Wir fuhren nun fast täglich zu diesem See, denn sein Wasser war herrlich klar und es gab mitunter auch schöne Wellen.
Nach dem Baden hielten wir in Falludscha an, um noch ein erfrischendes Eis zu essen. Weil es so schön bequem war, hatte ich die Badehose gleich anbehalten und nur ein T-Shirt übergestreift.
Ich stellte mich, wie all die anderen Kollegen, beim Eisverkäufer an, als mich eine irakische Frau, die in einen schwarzen Tschador gehüllt war, in den Hintern kniff.
Wollte die Frau einfach nur einmal in einen knackigen Männerpopo kneifen oder war das nun Protest wegen meiner knappen Bekleidung?
Ich konnte diese Frage in jenem Moment nicht beantworten.
Da jedoch von anderen Frauen, die ebenfalls auf dem Gehsteig standen, unverhohlen Protest kam, denke ich, dass wohl eher die zweite Möglichkeit in Betracht zu ziehen war.
Schließlich machte uns der Eisverkäufer klar, dass diese Art Kleidung nicht gern gesehen war. Am Strand wurde es gerade noch akzeptiert, aber bestimmt nicht bei den Menschen auf der Straße.
Selbst wenn es mir bei dieser Hitze schwer fiel, es war das letzte Mal, dass ich ohne lange Hosen bekleidet im Irak unterwegs war.
Es war Donnerstag, der Feierabend rückte näher und mir fiel ein, dass wir noch eine große Sache vorhatten. Wir wollten uns der Überzahl an Hunden entledigen, die uns allnächtlich unseren Schlaf raubten.
In unserem Camp gab es nämlich unendlich viele ausgewilderte Hunde und es wurden täglich mehr, als ob im Camp, unter den Hunden Familienzusammenführungen stattfanden.
Die Hunde waren zwar zumeist harmlos und relativ scheu und lagen am Tage träge im Schatten der Gebäude herum, aber nachts waren sie umso aktiver.
Da wurde um jeden Bissen gekämpft und gestritten und dabei ging es dementsprechend laut zu. An Schlafen war kaum zu denken und so beschlossen wir, endlich Abhilfe zu schaffen.
Unsere ägyptischen Arbeitskräfte spielten fast täglich nach der Arbeit Fußball. Dazu gab es zwei Tore, die mit Tornetzen bespannt waren. Und diese beiden Tornetze wurden jetzt einer anderen Bestimmung zugeführt.
Wir spannten die Netze zwischen ein paar Stangen, die wir an der schmalsten Stelle der Straße in unserem Camp befestigten.
Damit die Hunde nicht zwischen den Wohncontainern der Ägypter und unserem Camp entweichen konnten, wurden an diesen Stellen Leute postiert. Dann begann die Jagd. Mehrere Jeeps fuhren von der entferntesten Stelle unseres Camps auf die verstreuten Hunderudel zu und trieben sie in die Richtung unserer Fußballnetze.
Sowie einige Hunde in den Netzen gefangen waren, wurden sie auf einen Lkw geladen. Wenn dann die Ladefläche voll war, wurden die Hunde etwa sechzig Kilometer tief in die Wüste gefahren und dort freigelassen.
Für eine Weile hatten wir nun nachts Ruhe, doch so ein Wüstenhund dürfte nicht Hund sein, wenn er nicht über seine ureigendsten Instinkte verfügen würde und sich gemerkt hätte, wo man relativ einfach an Futter gelangen konnte.
Jedenfalls war ein Großteil der Horde nach einiger Zeit wieder da und es musste erneut zur Jagd geblasen werden.
Man konnte bei so einer Aktion natürlich nicht alle Hunde einfangen, das war unmöglich und auch gar nicht gewollt, denn die verbliebenen Hunde waren für die Beseitigung des Abfalls, den unsere Ägypter nicht etwa in der Wüste vergruben, sondern in der Nähe des Camps beseitigten, nicht unwichtig.
Nach einer endlich ruhigen Nacht war wieder einmal ein freier Tag und wir hatten eine Fahrt an den Habbanya See geplant. Dieser See liegt etwa achtzig Kilometer westlich von Bagdad, in der Nähe von Habbanya und Ramadi.
Um ihn zu erreichen, mussten wir von unserem Camp nach Falludscha fahren. Dort überquerten wir den Euphrat, der an jener Stelle nur etwa zweihundert Meter breit war.
Entlang der Straße nach Falludscha verlief die Eisenbahnlinie nach Syrien. Diese Eisenbahnstrecke wurde in ihrem Verlauf, wie auch die Brücke in Falludscha, ebenfalls von unzähligen Flak-Stellungen abgesichert und es war schon beklemmend, diese Ballung von Kriegstechnik auf einer relativ kurzen Strecke der Straße zu sehen.
Kurz hinter Falludscha bogen wir endlich nach Südwesten in Richtung Tourist Village Habbanya ab und fuhren dem See entgegen.
Das Besondere an diesem Sees war, dass dort ein regelrechtes Touristenzentrum entstand, in dem auch Tagesgäste allerlei Arten von Wassersport treiben oder einfach nur im See schwimmen oder sich am Strand erholen konnten. Es gab zwei Poolbars mit dazu gehörenden Swimmingpools, ein modernes Touristenhotel und Bungalows. Zahlreiche Palmen spendeten den Gästen angenehmen Schatten.
Zuerst tranken wir gekühlte Getränke auf der Terrasse eines Strandlokals, anschließend gingen wir an den Bungalows vorbei zum Wasser.
Gleich in der Nähe der Bungalows befand sich ein Strand aus schneeweißem Sand, etwas weiter abseits jedoch war das Ufer sehr steinig. Mit etwas Geschick balancierten wir über die Steine hinweg. Es war ratsam die Schuhe dabei anzubehalten, da die Steine sehr scharfe Kanten hatten. Wir fanden eine Stelle, an der einige etwa acht Meter hohe Felsen im Wasser aufragten, so dass man von ihnen bequem in den See springen konnte. Nach ein paar Sprüngen in das kühle Nass und einigen geschwommenen Runden, setzte ich mich an das Ufer und hing die Beine in das angenehm temperierte Wasser.
Vor ein paar Tagen hatte ich mir in meinen neuen Arbeitsschuhen beide Hacken aufgerieben und hatte nun Grind an den Füßen. Da tat es gut, wenn man die Füße im Wasser ein wenig kühlen konnte. Plötzlich verspürte ich einen wahnsinnigen, stechenden Schmerz in der linken Hacke und als ich den Fuß aus dem Wasser zog, blutete er, der Grind war verschwunden. Ich kontrollierte gleich das Wasser, konnte allerdings nichts Beunruhigendes feststellen, also setzte ich mich wieder auf den Stein.
Man sollte es nicht glauben, wie leichtsinnig man sein konnte, aber ich tauchte meine Füße erneut in das Wasser. An den darauf folgenden Schmerz kann ich mich noch allzu gut erinnern.
Mit einem Schreckensschrei zog ich den schmerzenden Fuß aus dem Wasser und stellte fest, dass auch von der anderen Hacke der Grind fehlte und sie ebenfalls blutete.
Nach einer Weile, in der ich meine Dummheit bestaunte und den Schmerz abklingen ließ, wollte ich der Sache auf den Grund gehen. Einige meiner Kollegen wollten meinen Verdacht, dass ich von einem Fisch gebissen worden sei, allerdings nicht teilen und schütteten sich fast vor Lachen aus.
Gemeinsam mit einem Kollegen, der mir glaubte, legte ich mich nun auf die Steine und beobachtete das Wasser.
Die Steine waren durch das Wasser rund geschliffen und beim genauen Hinsehen stellten wir fest, dass sich in den Steinen kleine Löcher befanden. Nach einer Weile Geduld sahen wir plötzlich einen etwa fünfzehn bis zwanzig Zentimeter langen, dünnen, aalförmigen Fisch aus einem dieser Löcher hervorschnellen und blitzschnell wieder verschwinden. Auch aus den anderen Löchern kamen diese Fische hervor, doch als wir uns bewegten, verschwanden sie augenblicklich wieder in den Löchern.
Wir riefen unsere Kollegen herbei, um ihnen den Beweis zu erbringen. Doch wie es so oft in ähnlichen Situationen ist, ließ sich kein Fisch mehr sehen. Wahrscheinlich waren die Kollegen einfach nur zu laut.
Nach dem Bad packten wir unsere Sachen zusammen und brachen auf, um noch eine Tour um den See zu machen.
Wir fuhren nach Muhammadi, einer kleinen Stadt am Euphrat, mit einem Flussdelta und einem reichhaltigen Pflanzenwachstum. Dort machten wir Rast und aßen an einem Stand eine Kleinigkeit.
Auf dem Weg nach Hause kamen wir dann an mehreren Orten vorüber, die ihrer günstigen Lage am Euphrat fruchtbare Böden verdankten und deshalb sowohl Obstplantagen als auch Gemüseäcker besaßen, die den Bauern einen bescheidenen Wohlstand sicherten.
Außerhalb dieser Dörfer gab es große Melonenfelder, deren Ertrag gleich an der Straße auf große Pyramiden geschichtet wurde.
Die Melonen wurden mit Eisblöcken gekühlt und an Ort und Stelle portionsweise zum Verzehr angeboten.
Dieser unbeschreibliche Genuss wurde von uns immer wieder gern genutzt, obwohl er aufgrund der Bakterien in den Eisblöcken sehr amöbenfördernd war.
Bei dem Städtchen Bin Isa floss der Euphrat nur einige Meter unterhalb der Straße und an den Hängen wuchsen Büsche und Sträucher. Wir fuhren nicht sehr schnell, und plötzlich entdeckte unser Bauleiter hinter einem Gebüsch einige Hundewelpen.
Er ließ unseren Bus anhalten und ging zu diesen kleinen Hunden. Einige flohen und purzelten den Abhang hinunter. Wir riefen Herbert zu, dass er die Hunde doch in Ruhe lassen solle, da die Hündin sicher nur auf Futtersuche war, aber er ließ sich nicht beirren. Zwei oder drei der kleinen Kerle, blieben eingeschüchtert hinter dem Gebüsch hocken und wimmerten leise.
Einen dieser Hunde nahm der Bauleiter auf den Arm und brachte ihn in den Bus. Es gab zwar offenen Protest von den Kollegen, doch dieser Protest half nichts, Herbert wollte den Hund unbedingt als Haustier mit in das Camp nehmen.
Im Camp angekommen, stieg er sofort in seinen Landcruiser und beschaffte sich von der Baustelle eine größere Kiste mit Deckel. Diese Kiste sollte als Hundehütte dienen und zumindest bis zum Feierabend des folgenden Tages das Domizil des kleinen Hundes sein.
Am nächsten Tag konnte ich den Feierabend kaum erwarten, denn ich machte mir bereits den ganzen Tag über Gedanken, wie der kleine Hund die mörderische Hitze in der Holzkiste überstanden haben würde, und erwartete eigentlich das Schlimmste.
Als wir dann in das Camp kamen, ging ich zuerst zur Kiste und war tatsächlich zu Tode erschrocken. Der kleine Hund lag auf der Seite und war kaum noch am Leben. Das war kein Wunder, denn der Deckel lag auf der Kiste und die Stauwärme ließ dem Tier kaum Luft zum Atmen.
Ich lief sofort los, um einen Eimer mit Wasser zu holen, denn kampflos wollte ich den Hund nicht aufgeben. Ich nahm ihn aus der Kiste und bettete ihn im Schatten. Vorsichtig legte ich sein Köpfchen auf meine linke Hand und träufelte ihm mit der rechten Hand Wasser auf seine kleine Schnauze.
Nach einer gefühlten Ewigkeit begann er, das Wasser abzulecken und mit der Zunge zu hecheln, da schöpfte ich Hoffnung.
Dieser Welpe war ein Kämpfer und hatte sich nach etwa einer Stunde so weit erholt, dass er schon wieder sitzen konnte und ich freute mich riesig, dass sich meine Mühe gelohnt hatte.
Aus Kaffeesahne, Wasser und Weißbrotteig bereitete ich ihm seine erste Mahlzeit.
Am Abend nahm ich ihn zu mir und meinem Zimmerkameraden Rodschi und legte ihm ein Handtuch unter das Bett. Er schlief sanft darauf ein. Ich verbrachte eine längere Zeit damit, den schlafenden Welpen zu beobachten. Mit seinem flauschigen hellbraunen Fell, das gelb und weiß gefleckt war, glich er einem Spielzeughund und genau so groß war er auch nur.
Zufrieden legte auch ich mich in mein Bett, doch als ich am Morgen aufstand, bemerkte ich, dass ich kein Hundekenner war. Ich hätte nämlich daran denken müssen, dass ein kleiner Hund, der am Abend eine ganze Menge Milch getrunken hatte, irgendwann auch mal sein Beinchen heben musste und das war nun unverkennbar in unserem Zimmer geschehen.
Jetzt durfte ich erst einmal das Zimmer wischen und mir wurde schlagartig klar, dass mich am Abend die gleiche Situation erwarten würde.
Ich wollte mir also auf der Baustelle schnellstens eine Behausung für den kleinen Racker suchen, in der er den Tag verbringen konnte.
Schließlich fand ich eine schöne Kiste, in die ich einen Eingang schnitt, gerade so groß, dass der Welpe hineinschlüpfen konnte, in den aber die großen Hunde aus unserem Camp nicht hineinpassten. Dann nagelte ich einen Rest Maschendrahtzaun über die Kiste und stellte sie so, dass der Maschendraht zur Seite zeigte und der kleine Kerl hinausschauen konnte.
Als wir zum Feierabend nach Hause kamen, war es so, wie ich es mir gedacht hatte. Ich musste das Zimmer erneut wischen. Nun hatte ich jedoch für Abhilfe gesorgt und es galt, für die Hundehütte eine geeignete Stelle zu finden. Sie sollte die meiste Zeit des Tages im Schatten stehen und so eine Stelle fand ich zwischen unserem Bungalow und dem Küchentrakt.
Der Platz war ideal.
In den folgenden Tagen ließ ich den Welpen allerdings noch in unserem Zimmer schlafen, selbst auf die Gefahr hin, wieder ein paar Pfützen aufwischen zu müssen.
Ich überlegte mir, dass der Hund einen Namen brauchte, er sollte ja irgendwann auf mich hören.
Die Namenssuche war gar nicht so einfach, aber schließlich kam mir dann eine gute Idee, nachdem mir meine Kollegen vorher nur Unsinn vorgeschlagen hatten.
Ich dachte daran, wo wir ihn gefunden hatten – das war in der Wüste. Sein Gesicht und seine Färbung sahen einem Fuchs recht ähnlich, also Wüste und Fuchs, das ergab „Wüstenfuchs“.
Spontan kam mir die Idee, in Anlehnung an einen großen deutschen Heerführer und General aus dem II. Weltkrieg, der von den Landsern den Namen „Wüstenfuchs“ erhalten hatte, den Hund „Rommel“ zu nennen.
Der Name fand unter meinen Kollegen Anklang und so blieb es dabei.
Rommel entwickelte sich prächtig. Er war ein kluges Kerlchen und ich war jeden Tag froh, ihn zu haben.
Den Tag verbrachte er inzwischen in seiner Hundehütte, in die ich einen Pantoffel von mir legen musste, da er abends ständig mit meinem Hausschuh im Maul herum rannte. Kaum von der Arbeit gekommen, nahm ich ihn aus der Hütte und ab diesem Zeitpunkt, war er nicht mehr abzuschütteln. Er lief mir ständig hinterher und schnappte dabei immer vorsichtig in meine Hacken.
Wir waren unzertrennlich, aber da gab es eine Menge Neider.
Nein, ich meine nicht meine Kollegen, sondern es handelte sich dabei um die wilden Hunde im Camp, denen es offensichtlich nicht gefiel, dass es einen Artgenossen gab, der sich sein Futter nicht selbst suchen musste.
Nachts, wenn er einmal raus musste, ging ich mit ihm und achtete genau darauf, seine großen Artgenossen auf Distanz zu halten. Die Hunde aus dem Camp kamen jetzt tatsächlich bis an unseren Bungalow und mussten von mir oft mit einem Knüppel vertrieben werden.
Der größte Hund dieser Horde war dabei besonders dreist, wahrscheinlich war das der Leithund. Er hatte ein struppiges, dunkles Fell und war wegen seiner Größe und der Farbe des Fells gut von den anderen Hunden zu unterscheiden. Ein paar Mal kam er mir bedenklich nahe, aber er wagte es nicht, mich anzugreifen.
Es gelang mir manchmal sogar, ihm mit dem Knüppel einen Hieb zu versetzen. Oder ich warf ihm einen Stein hinterher, auch das brachte für ein paar Tage Erfolg.
Inzwischen hatte ich Rommel beigebracht, dass er mich wecken sollte, wenn er mal raus musste. Dazu stellte er sich auf die Hinterbeine und zog mit seiner Schnauze meine Bettdecke weg.
Die Tagesabläufe glichen sich stetig. Nach der Arbeit wurde geduscht und dann gegessen. Dabei hatten wir es bisher so gehalten, dass jeder Kollege aus unserem Zimmer und zwei Kollegen aus dem Nachbarzimmer im Wechsel an der Reihe waren, für das Abendessen zu sorgen.
Im Gegenzug erledigten die anderen Kollegen den Abwasch.
Da wir sehr schnell herausfanden, dass nicht jeder von uns ein begnadeter Koch war, wurde der Modus geändert.
Man sagte mir als Hobbykoch die größten Talente nach und so kam es, dass jeder Kollege im Wechsel den Vorrat bereitstellen musste, ich allerdings nun allabendlich kochte. Ich machte das gerne und es befreite mich vom leidigen Abwasch.
Beim Kochen war ich sehr erfindungsreich und es gab nie Klagen, dass mein Essen nicht schmackhaft wäre, aber vielleicht auch deshalb nicht, weil sich die Kollegen vor dem Kochen drücken wollten, so wie ich mich vor dem Abwasch.
Am nächsten freien Tag führte uns ein Ausflug mit unseren Bussen zu einem der berühmtesten Bauwerke des Irak, dem Sassaniden- Palast von Ktesiphon, dreißig Kilometer südlich von Bagdad.
Dieser Palast wurde im dritten Jahrhundert von König Sapur errichtet, der von 241 bis 272 regierte und sich als König der Könige bezeichnete.
Der Palast, von dem nur noch Teile vorhanden waren, ist ein Wunderwerk architektonischer Baukunst. Seine Audienzhalle besteht aus dem größten, frei tragenden Backsteinbogen der Welt.
Es ist ein so genanntes Tonnengewölbe und wird „Der Bogen des Khosrow“ genannt. Seitlich des Bogens schlossen sich die Nebengebäude an, von denen nur der linke Flügel erhalten geblieben war. Ursprünglich befand sich spiegelverkehrt neben diesem Palast noch ein zweiter, doch der wurde bei den Kämpfen zwischen britischen Truppen und Soldaten des osmanischen Reiches zerstört.
Die monumentale Größe war, gemessen an den technologischen Möglichkeiten zur Zeit seiner Entstehung, sehr erstaunlich.
Die Mauerstärke des Bogens beträgt an der dicksten Stelle sieben Meter und wurde zunächst in dreiundachtzig Schichten leicht nach innen versetzt gemauert, um einen Bogen zu erhalten. An der Spitze des Bogens, in der Höhe von dreiunddreißig Metern, beträgt die Mauerstärke noch einen Meter.
Der Palast wurde von den Sassaniden Königen noch bis in das Jahr 633 genutzt. In der Schlacht von Quadissiya um Ktesiphon und Seleukia im Jahr 637 wurde die Doppelstadt von den Muslimen erobert. Mit der Gründung Bagdads im Jahr 732 verfiel die einstmals prächtige Metropole der Sassaniden.
In einem Korral vor dem Palast standen zwei Kamele, die von einem alten Mann betreut wurden, der so aussah, als wäre er aktives Mitglied bei der Schlacht von Quadissiya im Jahr 637 gewesen.
Ebenso alt schienen die Kamele zu sein. Die Kleidung des alten Mannes unterschied sich ebenfalls nicht von der Kleidung vor hunderten Jahren.
Er trug einen gewaltigen weißen Schnauzbart und war unrasiert, hatte aber lustige Augen und einen gutmütigen Gesichtsausdruck. Er bot den Touristen seine Kamele zum Reiten und zum Fotografieren an und hatte auf Wunsch, auch arabische Kleidung zur Verfügung, um die Fotos noch authentischer aussehen zu lassen.
Mit einfachsten Polaroid Kameras machten die irakischen Fotografen die ausgefallensten Fotos, indem sie das Objektiv mit Tape teilweise zuklebten, den Bildtransport blockierten und so auf einem Bild mehrere Aufnahmen machen konnten.
Ich wollte gern ein paar professionelle Fotos mit arabischer Kleidung als Souvenir mit nach Hause nehmen und suchte mir die entsprechende Kleidung aus. Schließlich entschied ich mich für ein Gewand mit üppiger Goldborte und goldener Stickerei und dem dazugehörenden Kopfschmuck.
Ein kostbar aussehender Gürtel und ein verzierter Säbel rundeten das Bild ab.
Meine dunklen Haare und mein gezwirbelter Schnauzbart passten perfekt zu der Kostümierung.
Vor dem Bogen des Khosrow
Als ich die Kleider angelegt hatte, ging ich zu dem Kamel, um aufzusitzen. Das war übrigens bei einem Kamel gar nicht so einfach, vor allem, wenn das Kamel schon oft zum Auf- und Absteigen beansprucht wurde.
Da das bei meinem Kamel glücklicherweise noch nicht der Fall war, ließ es sich mit einem Tritt gegen das linke Vorderbein von dem Kamelführer, den man „Kabashi“ nennt, überreden, sich hinzuknien, damit ich aufsteigen konnte. Als sich das Kamel dann erhob und ein paar Meter lief, erklärte sich für mich der Begriff „Wüstenschiff“. Beim Aufstehen des Tieres wäre ich schon beinahe nach hinten heruntergefallen. Durch den wankenden Gang wurde ich hin und her geschüttelt, wie auf einem Dampfer bei Seegang.
Ich ritt ein paar Meter und ließ dabei einige Fotos machen. Als ich dann absitzen wollte, knickte das Kamel urplötzlich so in den Vorderbeinen ein, dass ich mich nur mit aller mir in wenigen Minuten angeeigneter Reitkunst an den Zügeln und am Fell festklammern konnte, um nun nicht nach vorn herunterzufallen.
Ich hatte den Ritt aber gut überstanden und ging mit der Zustimmung des Kamelführers hinüber zum Palast, um mich auch dort noch einmal in den Kleidern fotografieren zu lassen. Als ich für meine Kollegen zum Gaudi theatralisch zum Bogen des Khoshrow schritt, um davor abgelichtet zu werden, bemerkte ich zunächst gar nicht die staunenden Blicke der Touristen, als ich es jedoch registrierte, dass ich wegen meiner prächtigen Kleidung so angestaunt wurde, machte ich mir den Spaß, ein wenig wie ein Emir herumzustolzieren und ich muss sagen, dass mein Auftritt seine Wirkung nicht verfehlte und mein Konterfei wohl in manchem japanischen Fotoalbum gelandet sein dürfte.
Die Wirkung war grandios und als ich meine Kleider wieder ablegte und darunter Jeans und T-Shirt zum Vorschein kamen, gab es ein Riesengelächter. Auch die anwesenden japanischen Touristen hatten mir meine Mogelei nicht übel genommen.
Vom Park aus gelangte man innerhalb weniger Minuten zu einem kleinen Dorf direkt am Tigrisufer. Dort gab es durch die Nähe des Wassers langgezogene Palmenhaine, in deren Schatten kleine Häuser, mit meist flachen Dächern, Schutz suchten.
Es waren die typischen weiß gekalkten Lehmziegelhütten, die nicht sehr groß waren, aber trotzdem für eine große Familie Platz bieten mussten.
Um die Häuser herum bot sich uns ein Pflanzenreichtum dar, den man schon von weitem riechen konnte.
Vor den Häusern saßen alte Männer auf wackeligen Schemeln im Schatten riesiger Dattelpalmen. Sie rauchten und schauten den Frauen bei der Arbeit zu, Kinder spielten mit dem Ball und durch das Dorf tollten Hunde.
Die Nähe des Palastes und des Parks erschloss den Dorfbewohnern eine kleine Einnahmequelle, in dem sie kalte Getränke oder kleine Souvenirs verkauften oder Grillspieße aus Hammelfleisch anboten. Mit einem zweirädrigen Karren fuhren die Straßenköche zu den Plätzen, von denen sie sich den meisten Umsatz versprachen. Und wenn man einen robusten Magen hatte und die mangelnde Hygiene nicht unbedingt Anlass zum Verzicht gebot, dann konnte man für relativ wenig Geld die schmackhaften Lammspießchen oder andere Speisen genießen.
Auch Zigaretten wurden an den Mann gebracht, allerdings zu unverschämten Überpreisen.
Der Handel florierte selbst an den entlegensten Orten und war den Arabern angeboren.
Nach diesem Ausflug ging es zurück ins Camp und ich ahnte nicht im Geringsten, dass dieser erlebnisreiche Tag zugleich für mich der bisher schwärzeste Tag im Irak werden würde.
Im Camp erwartete mich in seinem Hundestall mein kleiner Freund Rommel und ich musste mich ihm nun ausgiebig widmen, sonst wäre er beleidigt gewesen. Ich ging mit ihm im Camp spazieren und bemerkte, wie die ausgewachsenen Hunde uns beobachteten. Ich achtete darauf, dass Rommel sich nicht zu weit von mir entfernte. Ein paar Mal kamen uns die Hunde gefährlich nahe und ich vertrieb sie mit gezielten Steinwürfen. Ich spürte jedoch ihre Aggressivität und zog es deshalb vor, mit Rommel lieber nach Hause zu gehen.
Am Abend fütterte ich ihn und nahm ihn vorsichtshalber für die Nacht in meinen Bungalow. Wenn er raus musste, weckte er mich ja, indem er auf mein Bett sprang, in die Decke biss und sich mit der Decke im Maul einfach fallen ließ. Ich stand dann auf, öffnete die Tür und wartete, bis er sein Geschäft erledigt hatte. Anschließend kam er wieder herein und wir schliefen weiter.
So geschah das auch in jener Nacht. Er weckte mich und ich ließ ihn hinaus, aber anstatt nach seinem Geschäft wieder herein zu kommen, wollte er mit mir spielen und tollte vor der Tür hin und her.
Ich schimpfte leise mit ihm und sagte, dass ich keine Lust hätte, jetzt in der Nacht zu toben aber er hörte nicht auf mich. Da ließ ich die Tür offen und dachte mir, dass er von selbst hereinkommen würde, wenn er sich ausgetobt hatte. Ich legte mich wieder hin und war fast eingeschlafen, als mich markerschütternde Schreie blitzartig hochfahren ließen.
Ich lief schnell hinaus, da ich das Schlimmste befürchtete, und sah gerade noch, den großen zotteligen Hund um die Ecke laufen.
Ich ging ein paar Meter und suchte Rommel. Da hörte ich ihn leise wimmern und sah ihn seltsam verkrümmt auf dem Boden liegen.
Am Hals war er blutig und als ich ihn aufheben wollte, bemerkte ich, dass wahrscheinlich durch einen Biss ins Genick seine Wirbelsäule gebrochen war. Aus seinen kleinen dunklen Kulleraugen schaute er mich an, als ob er mich bitten wollte „Hilf mir doch!“, aber ich konnte ihm nicht mehr helfen. Ich legte dem kleinen Racker meine Hand unter sein Köpfchen und sprach beruhigend auf ihn ein. Mir schossen Tränen in die Augen, weil ich wusste, dass ich das liebe Kerlchen in wenigen Minuten verlieren würde.
Ich hatte mich so sehr an ihn gewöhnt und konnte mir gar nicht vorstellen, dass sein kurzes Leben so schnell zu Ende gehen sollte. Er schaute mich traurig mit seinen braunen Knopfaugen an und unter Schütteln seines kleinen Körpers starb er in meinen Händen.
Ich hob den Hund sanft auf meine Arme und trug ihn in seinen Hundezwinger.
Am Morgen nahm ich ihn dann mit zur Baustelle und begrub ihn dort an einer schattigen Stelle hinter einem Container. Die Ägypter, die sonst den ganzen Tag auf mich einredeten, bemerkten meine Trauer und ließen mich an jenem Tag in Ruhe.
Mich hatte eine unbändige Wut gepackt und ich war fest entschlossen, auch dem Leben des schwarzen Hundes ein Ende zu bereiten. Ich lag die folgenden Abende mit einem Eisenrohr auf der Lauer, doch als ob er es geahnt hätte, ließ sich der Schwarze nicht mehr blicken.