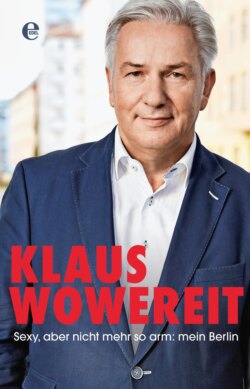Читать книгу Sexy, aber nicht mehr so arm: mein Berlin - Klaus Wowereit - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
BERLINER ENTSCHEIDUNGS(UM)WEGE
ОглавлениеOft entscheidet sich erst im Schlussspurt, was man in der Politik konkret bewegen kann. Hier sind, nach allem Zuhören und Abwägen, dann tatsächlich die klaren Ansagen gefragt. Ja, Politik sollte immer das Ziel haben, Betroffene zu Beteiligten zu machen. Aber es ist unmöglich, jeden konkret Betroffenen ständig an allem zu beteiligen. Ja, man kann – und muss – über alles diskutieren. Aber nach spätestens 90 Minuten hört auch in Sitzungen oder Versammlungen niemand mehr zu. Dann muss man halt abstimmen. Oder irgendjemand muss entscheiden.
In der Demokratie brauchen Entscheidungen Zeit, sie erfordern bei allen Beteiligten Geduld, Rücksicht und vor allem die Fähigkeit zum Kompromiss. Und so gut wie nie machen sie am Ende alle glücklich. Trotzdem muss regelmäßig alles Mögliche entschieden werden. Große Richtungsentscheidungen nennt man in der Demokratie „Wahlen“. Man kann darüber diskutieren, ob auch Entscheidungen in großen und wichtigen Sachfragen direkt vom Souverän getroffen werden sollten. Wer für Volksabstimmungen plädiert, muss sich freilich gefallen lassen, dass die Wähler zuvor auch darüber entscheiden, wann über was in welcher Form abgestimmt wird. Es macht nämlich bereits einen sehr erheblichen Unterschied, ob eine mehr oder weniger große Gruppe von Bürgern bloß „Wir sind das Volk!“ ruft. Oder ob eine solche Gruppe tatsächlich einen relevanten Teil der Bürgerschaft repräsentiert. Noch mehr macht es einen Unterschied, ob Bürgergruppen bereit sind zu akzeptieren, dass in einer Demokratie letztlich niemand für „das Volk“ sprechen kann, sondern jede noch so große Gruppe partikulare Interessen vertritt, die mit den Interessen anderer in vernünftiger Weise abgewogen werden müssen.
In der Verfassung des Landes Berlin gibt es da zunächst die Volksinitiative: Wenn mindestens 20.000 in Berlin gemeldete, mindestens 16 Jahre alte Bürger – unabhängig von ihrer Staatsbürgerschaft – solch eine Massenpetition unterschreiben, dann ist das Abgeordnetenhaus verpflichtet, die Initiative in öffentlicher Sitzung zu beraten. Einzige Voraussetzung: Es muss für die fragliche politische Entscheidung tatsächlich zuständig sein, und es muss sich um eine Angelegenheit handeln, die Berlin betrifft. Die Vertrauenspersonen der Volksinitiative haben zudem das Recht, in den zuständigen parlamentarischen Ausschüssen angehört zu werden. Ob und gegebenenfalls wie das Landesparlament am Ende entscheidet, darin sind die Abgeordneten dann aber frei. Also: Weniger als 1 Prozent aller Wahlberechtigten – eine Anzahl, die selbst kleine Interessengruppen zusammenbringen sollten – können eine parlamentarische Beratung ihres Anliegens erzwingen und damit einem Thema eine gewisse öffentliche Aufmerksamkeit verschaffen. Mehr aber auch nicht. Und das finde ich richtig.
Bei Volksbegehren und Volksentscheid sind die Hürden aus guten Gründen höher und das Verfahren komplizierter. Zum einen braucht man zum Start des ganzen Unternehmens wieder 20.000, in einigen Fällen (z. B. für Verfassungsänderungen) 50.000 Unterschriften. Vor allem aber müssen sich die Initiatoren eines Volksbegehrens von Anfang an einer sehr unangenehmen Nebenwirkung politischer Projekte stellen: Sie kosten meistens Geld. Steuergeld. Ergo unser aller Geld. Weshalb schon vor Einleitung eines Volksbegehrens beim Innensenator ein Antrag auf Kostenschätzung gestellt werden muss. Erst wenn diese vorliegt, kann mit der Unterschriftensammlung begonnen werden. Danach wird geprüft, ob wirklich genügend Wahlberechtigte (ein Mal!) unterschrieben haben und ob die Initiative mit geltendem „höherrangigen“ Recht vereinbar ist. Dann hat das Abgeordnetenhaus vier Monate Zeit, sich nach Stellungnahme des Senats zu überlegen, ob es sich die Initiative zu eigen macht oder ob es sie ablehnt. Erst in letzterem Fall startet das eigentliche Volksbegehren. Bei dem nunmehr 7 Prozent der Wahlberechtigten (derzeit gut 170.000 Menschen) unterschreiben müssen. Ich persönlich finde diese Hürde eher niedrig. Aber schließlich entscheiden Bürger bei einem Volksbegehren nur, ob sie alle zusammen etwas entscheiden wollen oder nicht. Wenn die Einwohnerzahl einer Großstadt wie Hamm oder Saarbrücken etwas wichtig findet, dann ist das wohl Grund genug, alle Berliner mit dem Thema zu beschäftigen.
Das geschieht dann im Volksentscheid. Dort benötigt eine Initiative erstens die Zustimmung der Mehrheit all jener, die am Entscheid teilgenommen haben. Und zugleich die Stimmen von mindestens einem Viertel aller Stimmberechtigten, derzeit also von rund 613.000 Berlinerinnen und Berlinern. Nun kann man lange diskutieren, ob es angemessen ist, dass ein Viertel aller Bürger Gesetze durchpauken oder verändern kann, die am Ende ja meist mehr oder weniger alle betreffen. Aber das ist, wie es ist.
Darum dies auch nicht nur der Vollständigkeit halber: In bestimmten Fällen sieht die Landesverfassung auch noch Volksabstimmungen vor. Eine solche gab es etwa 1996 über die Fusion Berlins mit Brandenburg. Oder 2006, als die das Thema Volksbegehren und Volksentscheid betreffenden Artikel 62 und 63 der Landesverfassung geändert wurden. Und da hatte eine (in diesem Fall erforderliche) deutliche Mehrheit aller Wahlberechtigten für genau dieses Quorum gestimmt.
Grundsätzlich sehe ich bei Volksbegehren und Volksentscheiden immer die Gefahr, dass sie zu reinen Plebisziten lautstarker Minderheiten werden. Oder Menschen Sachen fordern, die alle toll finden – bis die Rechnung kommt. Wer zum Beispiel würde nicht für kleinere Schulklassen stimmen? Oder für die sofortige Totalsanierung aller Straßen? Auch wenn viele das gern so sehen: Die Aufgabe „der Politik“ ist nicht das Verteilen von „Geschenken“. Es ist nicht einmal Aufgabe von Parlamenten und Regierungen, den – wie schon gesagt: inexistenten – Willen „des Volkes“ oder auch nur parteipolitischer Mehrheiten zu vollstrecken. Die eigentliche Aufgabe von Politik ist erstens die Abwägung unterschiedlicher, nicht selten widerstreitender Interessen bei einem Thema. Und zweitens der stets kritische Blick auf die Gesamtverantwortung.
Simpel gesagt geht es uns Politikern da nicht sehr viel anders als Ihnen. Klar wäre es am schönsten, wenn Sie im selben Jahr Ihre Wohnung komplett renovieren, ein neues Auto anschaffen und dreimal in Urlaub fahren könnten. Leider sind die wenigsten so liquide. Wer die Verantwortung für die Bewirtschaftung öffentlicher Mittel trägt, muss beim Geldausgeben erst recht Prioritäten setzen. In Berlin, das heute zwar keine dramatische, aber immer noch eine eher angespannte Haushaltslage hat, können das bisweilen auch harte Prioritäten sein.
Und dann gibt es beim fröhlichen Abstimmen auch noch ein paar formale Bedingungen. So müssen Gesetze etwa bestimmten Formen genügen. Es müssen eindeutige, präzise formulierte, rechtlich korrekt umsetzbare und mit einem Preisschild versehene Alternativen zur Abstimmung vorgelegt werden. Weshalb da eben auch Juristen und Verwaltungsfachleute mitentscheiden müssen. Und über bestimmte Dinge – Grundrechte, Grundprinzipien des Rechtsstaates – kann niemals abgestimmt werden. Kurz und gut: Volksbegehren und Volksabstimmungen ja – aber nicht über alles. Und wenn, dann mit genügend hohen Hürden.
Am Ende des Tages bleiben immer noch genug Entscheidungen übrig, die gewählte Politiker – Parlamentarier und Amtsträger – alleine treffen müssen. Das Tolle an der Demokratie: Auch das funktioniert. Selbst hartnäckigste Lobbyisten, aufmüpfige Fraktionen, schrullige Hinterbänkler, mächtige Senatoren oder selbstbewusste Spitzenbeamte erwarten irgendwann eine klare Ansage vom Oberhäuptling. Wer bereit ist, nach einer langen Nacht am Lagerfeuer zu entscheiden, dem werden die Indianer meist folgen. Sprich, der kann in der Politik Entscheidendes bewegen.
In unserer heutigen Mediengesellschaft läuft sehr viel über Personalisierung. Wer gute und überzeugende Ideen formuliert, der kann mit ihnen auch durchdringen. Umso mehr, je eingängiger er oder sie diese Ideen verpackt. Ab und an gibt ein Schuss Provokation oder eine Prise Nonchalance den Argumenten die richtige Würze. Vorausgesetzt, Worte und Gesten sind nicht bloß Show, sondern passen zur Sache. Und vor allem vorausgesetzt, die Menschen erkennen nicht nur mein Talent für die Produktion eingängiger „Forderungen“, sondern eine klare Haltung, aus der heraus ich mich für bestimmte Dinge einsetze. Da ist es in der Politik nicht anders als im wirklichen Leben: Menschen mit Ecken und Kanten sind häufig beliebt. Aber nur so lange, wie diese Ecken und Kanten deren Authentizität, Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit unterstreichen. Wenn man sich an den Kanten bloß noch blaue Flecken holt, ist es mit der Popularität schnell vorbei.
So wie demokratische Kontrolle übrigens entgegen allen Unkenrufen eine sehr effektive Form von Erfolgskontrolle ist. So lange ich als Politiker nicht nur innerhalb der Politik mit meinen Ideen und Initiativen durchdringe, sondern diese Initiativen auch in den Augen der Bürger spürbare Erfolge zeitigen, wird politische Führung akzeptiert. Bleiben die Erfolge aus, ist man ziemlich schnell raus aus dem Geschäft. Klar, irgendwer hat immer was zu meckern. Aber echte Reklamationswellen führen in der Demokratie fast immer stracks in die Wahlniederlage. Wenn nicht, dann ist die Lautstärke der Beschwerden vermutlich größer als ihre Anzahl. Im umgekehrten Fall ist die Niederlage aber schon im Verlauf der zweiten Halbzeit absehbar. Weshalb man in der Politik wie im Fußball ganz schnell von den eigenen Leuten vom Platz genommen wird.
Auch ein Regierender Bürgermeister kann übrigens nichts allein par ordre de Mufti auf den Weg bringen. Hier ein kurzes Telefonat, da eine kleine schriftliche Dienstanweisung und alles läuft nach Plan? So funktioniert Politik nicht. Zu jeder klaren Ansage gehört daher das – meist mehrfache – Nachhaken.
Beispiel: Auch ich bin ja ein Bürger, der sich hin und wieder über Sachen in seinem unmittelbaren Umfeld aufregt. So hatten vor einigen Jahren Besitzer einer Immobilie bei uns im Kiez ein Baugerüst mit einem dieser Monster-Werbeplakate dekoriert. Dahinter passierte – nichts. Stichwort „Refinanzierung von Sanierungskosten“. Nun hatten wir 2005 mit unserer rot-roten Koalition ein „Bauvereinfachungsgesetz“ beschlossen, das derlei einträgliche Verschönerungen von Gerüsten ohne Genehmigung erlaubte. Um dann zu beobachten, wie private und öffentliche Bauträger in kürzester Zeit die halbe Stadt mit Werbung zupflasterten. 2009 hatten wir darum die Regelung wieder verschärft. So erzählte ich meinem Bezirksbürgermeister am Rande einer Konferenz von besagtem Ding. Kleiner Dienstweg? Fehlanzeige. Ein Vierteljahr später fragte ich höflich nach – und merkte, wie langsam die Mühlen der Verwaltung mahlen können. Wie schnell selbst eindeutige Entscheidungen verwässern, wenn Einzelinteressen einflussreiche Fürsprecher haben. Und wie beliebt das Spiel „Das haben wir doch immer schon so gemacht“ in Bürokratien oft ist. Saniert hat der Bauträger das Gebäude übrigens nie. Er hat nur irgendwann mit dem Gerüst auch die Werbung wieder abgebaut. Eines dieser kleinen Ärgernisse der Stadtpolitik, die sich nur durch den Lauf der Zeit in Luft auflösen.
Gerade in Berlin gibt es sehr viele zuständige Behörden und Verwaltungsebenen. Jeder weiß, dass Berlin mit seinen derzeit rund 3,7 Millionen Einwohnern die mit Abstand größte Metropole Deutschlands ist. Und die meisten wissen wohl auch, dass sich der Stadtstaat Berlin in mehrere Bezirke unterteilt. Was sich weniger Menschen klarmachen: Sechs der zwölf Bezirke Berlins haben über 300.000 Einwohner. Als eigenständige Kommunen würden sie allesamt unter den Top 25 der deutschen Großstädte rangieren. Pankow mit seinen über 400.000 Einwohnern ist größer als Bochum (die Nummer 16), Mitte größer als Wuppertal, Charlottenburg-Wilmersdorf hat ebenso viele Einwohner wie Bielefeld. Und selbst das „kleine“ Spandau würde mit seinen 238.000 Einwohnern derzeit Magdeburg (235.000) von Platz 32 der Stadtliga verdrängen.
Die elf Großstädte des Ruhrgebiets kommen zusammen auf gut 3,2 Millionen Einwohner. Jedem ist klar, dass sich Bochum, Bottrop, Dortmund, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen, Hagen, Hamm, Herne, Mülheim an der Ruhr und Oberhausen wohl kaum aus einem einzigen Rathaus regieren ließen. Tja, und deshalb haben wir in Berlin eben nicht nur das Rote Rathaus, den Amtssitz des Regierenden Bürgermeisters, sondern zwölf Rathäuser mit Bezirksregierungen – darunter das dank Kennedy weltberühmte Schöneberger Rathaus, bis zur Wende Sitz des West-Berliner Senats. Dazu zwei Dutzend weitere Rathäuser in den historisch gewachsenen Stadtteilen Berlins. Und zu jedem der zwölf Bezirksämter gehören, wie in jeder gescheit organisierten Stadt, all jene Behörden, auf deren Leistungen die Bürger Anspruch haben. Von den Bürgerämtern über die Kultur-, Schul-, Jugend-, Sozial- und Gesundheitsämter bis hin zur Verwaltung von Straßen und Grünflächen oder Veterinär- und Lebensmittelaufsicht – alles schön mal zwölf.
Daher werden die Tische in Berlin nicht nur schnell ziemlich groß, wenn man alle Zuständigen an einem von ihnen versammelt. An diesen Tischen sitzen, der Größe ihrer Kommunen angemessen, auch sehr selbstbewusste Bezirksbürgermeister und -meisterinnen, Bezirksstadträte und andere Vertreter der Bezirksverwaltungen. Weshalb ein Regierender Bürgermeister, Senatorinnen und Senatoren oder Beamte der Senatsverwaltung sehr oft eine Extraportion Überzeugungskraft brauchen. Weshalb gut Ding in Berlin oft etwas mehr Weile haben will. Und weshalb ein eher ungeduldiger Mensch wie ich gelegentlich auch mal auf den Tisch hauen musste, wenn es gar zu bunt wurde. Oder sagen wir so: Normalerweise habe ich eine recht durchlässige Schmerzgrenze. Wenn ich dann ab und zu laut werde, kriegen alle einen Schreck, weil sie das nicht gewohnt sind. Die Wirkung solcher Ansagen entsteht quasi aus dem Kontrast.
Nicht gerade kleine politische Blockadepotenziale hat Berlin kurz nach der Jahrtausendwende leider selbst produziert. Mit der Bezirksgebietsreform, die am 1. Januar 2001 in Kraft trat, sank die Zahl der Berliner Bezirke nicht nur von 23 auf zwölf. Zugleich wurde das bis dahin geltende Durchgriffsrecht des Senats gegenüber Entscheidungen der Bezirksämter und ihrer Fachbehörden abgeschafft. Nach mehr als eineinhalb Dekaden ist erkennbar, dass das keine kluge Entscheidung war. Weshalb ich für eine abermalige Reform unserer Landesverfassung plädiere – die eben auch eine Stadtverfassung ist.
Dabei sollte erstens das besagte Durchgriffsrecht des Senats wiederhergestellt werden. Allein schon beim Thema Straßenbau würde sich dann sehr schnell zeigen, dass in einer weitgehend geschlossenen Großstadt wie Berlin manches besser liefe, wenn es eben doch zentral gesteuert würde.
Teil zwei der Novelle sollte eine Reform der Bezirksämter sein. Stichwort „politisches Bezirksamt“. Bislang ist es so: Bezirksbürgermeister und -bürgermeisterinnen werden von den Bezirksverordneten mit politisch gebildeten Mehrheiten gewählt. Wenn die stärkste politische Kraft keine absolute Mehrheit erreicht hat, ist sie in einem Bezirk dabei entweder auf „Koalitionspartner“ angewiesen, oder anderen Parteien gelingt es, eine Mehrheit zu bilden. Man spricht dann bloß nicht von einer „Koalition“, sondern von einer „Zählgemeinschaft“. Die vier Bezirksstadträte werden proportional zum Wahlergebnis besetzt. Mit dem Resultat, dass es in den Bezirksämtern fast immer eine Art Allparteien-Regierung nach Schweizer Muster gibt – einschließlich aller möglichen Blockaden. Und in den Bezirksverordnetenversammlungen keine Opposition. 2009 hat sich die Berliner SPD mit knapper – und für viele Beobachter überraschender – Mehrheit gegen das „politische Bezirksamt“ ausgesprochen. So wie es auch in den meisten anderen Parteien Befürworter wie Gegner einer solchen Änderung gibt. Ich selbst war früher eher Befürworter einer politischen Richtlinienkompetenz für die Bezirksbürgermeister. Mittlerweile plädiere auch ich eindeutig für das politische Bezirksamt. 2017 ist die FDP bei diesem ewig köchelnden Thema vorgeprescht. Stört mich nicht. Machen!
Manchmal machen Metropolen wie Berlin aber ohnehin einfach, was sie wollen. Besser gesagt, die Menschen folgen ihren eigenen, oft kühnen Plänen. Genau darum sind sie nach Berlin gekommen. Weil hier keiner als Erstes sagt: „Vergiss es, das geht nicht.“ So hat der Senat nicht einen Fünf-Jahres-Plan zur Ansiedlung von Start-Ups im Bereich Internet und Social Media aufgelegt, dank dem dann Jahr für Jahr tolle Firmen gegründet wurden. Viele dieser Senkrechtstarter wollten anfangs ganz bewusst keine Hilfe seitens der Politik. Und zwar aufgrund einer nicht völlig grundlosen Befürchtung: dass die Bedenkenträger dem Beistand auf dem Fuße folgen. Stattdessen folgte hier einfach eins aus dem anderen. Bis am Ende die Betreiber junger Unternehmen alles vor Ort vorfanden, was sie zur Entfaltung ihrer Kreativität brauchen: querdenkende Freiberufler, Szenecafés und -clubs, hippe Klamottenläden und Barbiere, Coworking Spaces. Wer da Hase und wer Igel war? Egal!