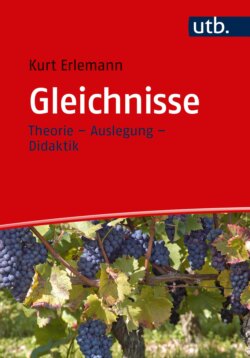Читать книгу Gleichnisse - Kurt Erlemann - Страница 12
1.4.2 Fabel / Mythos / Deklamation
ОглавлениеMit dem Gleichnis teilt die Fabel Kürze, Fiktionalität, Anschaulichkeit, analogischen Charakter, erzählerische Geschlossenheit und das Lernziel der Plausibilisierung umstrittener Inhalte.1 Der grundlegende Unterschied ist die fehlende Realistik insbesondere der Tierfabel, was sie in die Nähe anderer surrealer Textsorten, wie Traum und Allegorie, rückt (→ 2.5.7c). Jülicher definiert die Fabel als
die Redefigur, in welcher die Wirkung eines Satzes (Gedankens) gesichert werden soll durch Nebenstellung einer auf anderm Gebiet ablaufenden, ihrer Wirkung gewissen erdichteten Geschichte, deren Gedankengerippe dem jenes Satzes ähnlich ist. [Das heißt für ihn:] Die Mehrzahl der parabolaí Jesu, die erzählende Form tragen, sind Fabeln wie die des Stesichoros und des Aesop.2
Während Gleichnisse eine religiöse Dimension haben, fehlt diese bei den Fabeln.
Definition: Eine Fabel ist eine fiktionale, bildhaft-vergleichende, bisweilen surreale Kurzgeschichte, die eine allgemeine, oft moralische Lebensweisheit vermittelt.
Ebenfalls im Bereich des Surrealen bewegt sich der Mythos.3 Der Duden definiert den Mythos als
Sage und Dichtung von Göttern, Helden und Geistern [der Urzeit] eines Volkes [bzw. eine] legendär gewordene Gestalt od. Begebenheit, der man große Verehrung entgegenbringt.4
Surreal wirken Mythen, da sie etwa Naturmächte personifizieren und Götter in Menschengestalt wunderbare Dinge tun lassen. Seit der Neuzeit werden auch biblische Wundergeschichten als Mythen gedeutet. – Mythen teilen mit Gleichnissen Fiktionalität, erzählerische Geschlossenheit und das Lernziel, eine bestimmte Wirklichkeitssicht plausibel zu machen. In dieser Wirklichkeitssicht spielen Götter eine gewichtige Rolle. Gleichwohl fallen Mythen, wie auch die Fabeln, wegen ihrer Surrealistik und anderer Merkmale aus der weiteren Betrachtung heraus.
Definition: Ein Mythos zeigt mittels einer vorgeschichtlichen, legendenhaften Erzählung über Götter und Menschen den Ursprung der geltenden Weltordnung auf.
Die Deklamation ist die formkritisch und textpragmatisch nächste Analogie narrativ ausgestalteter (Alltags-)Gleichnisse.5 Declamationes (lat.) sind antike, fiktionale Fallbeispiele für angehende Anwälte und sollen deren Argumentations- und Urteilsfähigkeit verbessern. Die Deklamation ist Teil eines Plädoyers vor Gericht und läuft auf einen im Sinne des Autors gelenkten, paradigmatischen Rechtsentscheid hinaus.6 Damit die Strategie gelingt, werden rhetorische Stilmittel zur Hörerlenkung eingesetzt, die denen narrativ ausgestalteter Gleichnisse ähneln. Hierzu gehören die Plausibilität des Geschilderten, perspektivische Darstellung zur Schaffung von Sympathie, suggestive Fragen, Emotionalität usw.7 Für die Nähe zu Deklamationen sprechen auch die juristischen Bildfelder in vielen Gleichnissen. – Paradigmatische Rechtsentscheide sind schon im Alten Testament eine beliebte Form, ein göttliches Rechtsurteil plausibel zu machen (vgl. 2 Sam 12; Jes 5,1-7). Deklamationen sind demnach nicht zwingend Prätexte für die neutestamentlichen Gleichnisse, sie unterstreichen aber deren rhetorischen Kontext.
Definition: Eine Deklamation ist ein fiktional-vergleichendes Fallbeispiel, das Rhetoren und Anwälten hilft, ihre Argumentationsfähigkeit, etwa für Plädoyers, zu steigern. Der textpragmatische Zuschnitt ist dem von Gleichnissen ähnlich.