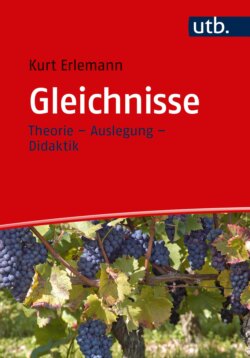Читать книгу Gleichnisse - Kurt Erlemann - Страница 13
1.4.3 Allegorie
ОглавлениеLaut den römischen Rhetoren Cicero (106-43 v. Chr.) und Quintilian (35-100 n. Chr.) ist die Allegorie eine fortgeführte Metapher, die auf der Ähnlichkeit zwischen dem, was gesagt wird, und dem, was gemeint ist, aufbaut.1 Dieses Verständnis wurde von Jülicher aufgegriffen.2 Die Definition von Allegorie wurde im Verlauf der Gleichnisforschung revidiert. Der Jülichersche Gegensatz von Gleichnis und Allegorie als ‚eigentlicher‘ bzw. ‚uneigentlicher‘ Rede wird heutzutage, unter Hinweis auf viele Mischformen sowie aufgrund der Neubestimmung der Metapher und einer präzisierten Begrifflichkeit, weithin abgelehnt (→ 2.2.1; 2.2.5).
Im vorliegenden Entwurf bezeichnet Allegorie erstens ein literarisches und nicht-literarisches Stilmittel. Allegorische Stilelemente begegnen in allen möglichen Textsorten, z.B in Romanliteratur und Lyrik, selbst in der Malerei oder in der Musik, sofern das eigentlich Gemeinte jenseits des wörtlichen Sinns bzw. des optischen oder akustischen Ersteindrucks zu suchen ist. – Zweitens gilt Allegorie nach wie vor als literarischer Gattungsbegriff. Charakteristisch sind die Dominanz verschleiernder Transfersignale (→ 1.5.9), erzählerische Surrealistik und Inkonzinnität. Allegorien sind nicht werbend-missionarisch, sondern subversiv-hermetisch ausgerichtet;3 das ist der einzige Gegensatz zu den Gleichnissen (→ 2.5.2a).
Definition: Die Allegorie ist ein literarisches oder nicht-literarisches Artefakt, das etwas anderes sagt, als es meint. Charakteristisch ist die systematische Verhüllung des Gemeinten durch Codierung und Chiffrierung. Allegorien sind tendenziell subversiv-hermetisch angelegt und richten sich exklusiv an eingeweihte Insider-Kreise.