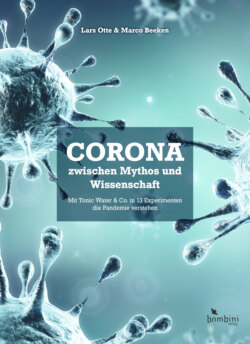Читать книгу Corona zwischen Mythos und Wissenschaft - Lars Otte - Страница 21
Erklärung:
ОглавлениеAls erstes wird der Vergleichsballon ohne die Münzen betrachtet, um zu klären, warum sich die Ballons überhaupt aufblähen. Wie Du vielleicht schon vermutet hast, ist ein Gas bei der Reaktion in der Flasche entstanden. Hier handelt es sich um Kohlenstoffdioxid (CO2), das von den Hefepilzen abgegeben wird, wenn die Zellatmung oder Gärung erfolgt. Mithilfe dieses Prozesses können die Hefepilze die für ihr Wachstum benötigte Energie aus dem Zucker gewinnen. Als Ausscheidungsprodukte entstehen dann Kohlenstoffdioxid durch die Atmung und Ethanol (Alkohol) durch die Gärung. Der Prozess der Atmung ist mit der menschlichen Atmung vergleichbar. Auch wir erzeugen mithilfe von Zucker (Kohlenhydraten) und Sauerstoff Energie und stoßen dabei unter anderem Kohlenstoffdioxid durch die Atmung aus.
Damit kann direkt erklärt werden, was bei dem zweiten Ballon mit den Münzen geschehen sein muss. Er ist weniger stark aufgeblasen, also befindet sich weniger Kohlenstoffdioxid in dem Ballon und die Hefe hat eine geringere Menge Zucker verstoffwechselt. Aber woran liegt das? Es genügt dazu ein Blick auf den Anfang des Versuchs, bei dem Cent-Münzen über Nacht mit einer Lösung behandelt wurden. Die Münzen bestehen zum Großteil aus Stahl, besitzen aber einen Mantel aus Kupfer. Durch die Zugabe von Zitronensaft hast Du dafür gesorgt, dass sich Kupfer-Ionen von der Münze lösen, da auf der Oberfläche der Münze Korrosionsprozesse ablaufen. Dies ist mit dem Rosten eines Eisennagels vergleichbar. Genau diese Kupfer-Ionen haben eine antimikrobielle Wirkung, sodass die Hefepilze angegriffen werden. Dadurch können sie den Zucker nur noch teilweise verstoffwechseln und es entsteht weniger Kohlenstoffdioxid. Letztendlich muss bei der Auswertung des Versuchs auch bedacht werden, dass nicht steril gearbeitet werden konnte, sodass auch eine Kontamination von außen möglich wäre, die die Versuchsergebnisse beeinflussen und verfälschen könnte.
—
Der Versuch konnte zeigen, dass die Kupfer-Oberfläche von Cent-Münzen eine antimikrobielle Wirkung hat. Es werden Kupfer-Ionen frei, die Erreger angreifen und so die Menge an Keimen auf einer Münze reduzieren können. Im Vergleich mit Geldscheinen ist deshalb die Kontamination mit Erregern bei Münzen deutlich geringer. Im Versuch wurde zur Erzeugung der Kupfer-Ionen Zitronensäure beziehungsweise Essig eingesetzt. Beide Stoffe gehören zu den Säuren und wirken korrosiv. Doch können die Münzen im normalen Gebrauch auch eine antimikrobielle Wirkung zeigen? Auch wir Menschen besitzen einen natürlichen Säurefilm auf unserer Haut. Dieser Säurefilm dient als Schutz vor potenziellen Erregern. Kommen wir mit Kupfermünzen in Kontakt, so legt sich eine dünne Schicht des Säurefilms unserer Haut auf die Münze, wodurch Kupfer-Ionen gebildet werden. Auch im alltäglichen Gebrauch sind Kupfer-Münzen also antimikrobiell. Zudem wird aus diesem Grund Kupfer in Krankenhäusern für Beschichtungen von Türgriffen verwendet. Eine Untersuchung der Stabilität von Coronaviren auf Kupferoberflächen ergab, dass die Viren im Labor auf Kupferoberflächen bis zu drei Stunden stabil bleiben können. Im Vergleich mit den anderen untersuchten Oberflächen (vergleiche Tabelle 4.1), war dies die geringste Stabilitätsdauer der Coronaviren. Die Münzen können somit als potenzieller Risikofaktor für die Übertragung des Coronavirus als minimal eingestuft werden.
Bisher wurde nur das Bargeld als möglicher Risikofaktor betrachtet, der jedoch als relativ niedrig eingestuft werden kann. Aber wie sieht es eigentlich mit der Alternative aus? Seit Beginn der Corona-Pandemie ist die Zahl der Kartenzahlungen gestiegen, weil viele diese für sicherer halten, jedoch ist das zum Teil ein Trugschluss. Forscher konnten feststellen, dass das Virus auf nicht porösen Materialien wie Kunststoff oder Edelstahl im Labor gut bestehen kann, sodass Debit- oder Kreditkarten-Terminals und PIN-Pads direkt betroffen sind. Hier liegt die Stabilitätsdauer der Viren bei zwei bis drei Tagen, sodass auch bei der Kartenzahlung und PIN-Eingabe eine Kontaktinfektion denkbar ist und diese somit ein ähnliches Risiko wie die Bargeldzahlung darstellt. Wenn also der Kontakt mit potenziell kontaminierten Gegenständen vollständig umgangen werden soll, sind kontaktlose Kartenzahlungen, die keine PIN-Eingabe erfordern, oder Smartphone-basierte Zahlungsmöglichkeiten eine Lösung. Hier kommt es zu keinerlei Kontakt mit Objekten, die von mehreren Personen berührt werden.
Es gibt keine Beweise für Erkrankungen, die durch das Berühren von Geldscheinen herbeigeführt wurde – selbst bei Bakterien nicht, die im Vergleich mit Viren in viel höheren Mengen auf Bargeld nachgewiesen werden können. Speziell zu dem Faktor Bargeld in der Pandemie hat sich die World Health Organisation (WHO) geäußert und betont, dass die Übertragung durch Münzen oder Scheine weder bewiesen noch widerlegt werden konnte. Sie empfiehlt deshalb, auf eine gute Hygiene zu achten und regelmäßig die Hände zu waschen, wie es nach der Berührung jedes häufig berührten Gegenstands der Fall sein sollte. Die Deutsche Bundesbank schließt sich dem an und erklärt, dass das Infektionsrisiko durch Geldscheine minimal ist. So wird von einigen Zentralbanken versucht, das Vertrauen in Bargeld zu stärken und dessen weitere Annahme zu fördern. Gleichzeitig tragen die wahrgenommenen Übertragungsrisiken des Bargelds, ob gültig oder nicht, zur schnelleren Entwicklung der digitalen Zahlungen bei.
Letztendlich kann auf die Desinfektion von Geldscheinen also verzichtet werden. Ein Mann aus Südkorea hat es hier etwas zu gut gemeint und 1,8 Mio. Won (ca. 1.300 Euro) in der Mikrowelle erhitzt, um die Scheine zu desinfizieren. Nach seinem Versuch blieben ihm nur 950.000 Won (ca. 700 Euro) – viele Banknoten waren versengt und unbrauchbar.