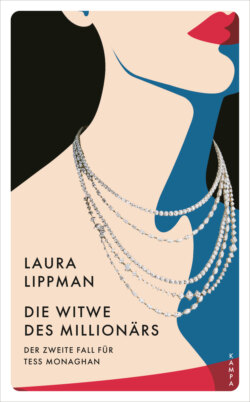Читать книгу Die Witwe des Millionärs - Laura Lippman - Страница 6
3
ОглавлениеTyner Grays Anwaltsbüro befand sich in einem alten Stadthaus am Mount Vernon Square, in einer netten Gegend am Fuße von George Washington, der alles von seinem Sockel aus beobachtete. »Aber er ist älter als der in D.C.«, erzählte irgendein Einheimischer jedes Mal. Tess war das Denkmal egal, aber ihr gefiel der hübsche Park vor dem Bürofenster, sie mochte die klassische Musik, die vom Peabody Conservatory herüberhallte, und die ausgezeichneten Restaurants in der Gegend. Im letzten Herbst hatte das Schicksal sie hierher verschlagen, eigentlich hatte es nur ein Job auf Zeit sein sollen. Aber Tess war geblieben, obwohl Tyner sie jeden Tag daran erinnerte, dass es ihr Ziel sein sollte, eine Lizenz als Privatdetektivin zu erhalten und ihr eigenes Büro zu eröffnen.
Als sie um Viertel nach neun durch die schwere Eingangstür trat, konnte sie das Quietschen des altmodischen Fahrstuhls hören, den nur Tyner benutzte. Tess hetzte die breite Marmortreppe in den ersten Stock hinauf, dann nahm sie die schmalere Treppe in den zweiten Stock; sie war sicher, den Fahrstuhl überholen zu können. Sie hatten einmal mit Tyners Stoppuhr nachgemessen, derselben, mit der er auch Nachwuchsruderer quälte. Der Fahrstuhl brauchte genau eine Minute und 32 Sekunden, um in den zweiten Stock zu gelangen. Als Tyner kam, saß sie schon an ihrem Schreibtisch im Empfangsraum, den sie sich mit der Rezeptionistin Alison teilte, und machte Notizen über ein Gespräch, das sie letzte Woche mit einer Frau geführt hatte, die hoffte, ihren Nachbarn wegen falscher Grundstücksgrenzziehung verklagen zu können.
»Damit legst du mich nicht rein«, sagte Tyner und fuhr in seinem Rollstuhl an ihr vorbei.
»Wirklich, Mr. Gray, sie war die ganze Zeit schon hier«, sagte Alison ungefragt. Sie war eine echte Schönheit, überzüchtet wie ein Golden Retriever, aber Alison hatte ein gutes Herz. Und konnte überhaupt nicht lügen.
»Ich hab dich auf der Treppe gehört«, rief er über die Schulter Tess zu. »Du hast schwere Schritte. Ich vergesse es immer wieder – hast du Platt- oder Spreizfüße?«
»Platt«, sagte sie und folgte ihm in sein Büro, einen spartanisch eingerichteten Raum. Seit fast vierzig Jahren saß Tyner im Rollstuhl, und er hatte nicht darauf gewartet, dass jemand ihm die Welt zu Füßen legte. Obwohl sich sein Büro in einem Stadthaus aus dem 19. Jahrhundert befand, das geradezu nach Antiquitäten schrie, hatte er sich für schlanke, moderne Möbel entschieden, die weniger Platz einnahmen. Sein Tisch war groß und niedrig, eine Spezialanfertigung, sodass er direkt heranrollen konnte. Die ihm gegenüber stehenden Stühle waren groß und schmal, teure Walnussholzstücke mit schmalen Lederstreifen als Sitzen. Sie waren ungeheuer unbequem, und nicht ganz zufällig erinnerten sie an die beweglichen Sitze in Ruderbooten. Rudern war Tyners wahre Leidenschaft, selbst wenn seine Rudererjahre nur einen Bruchteil seines Lebens ausgemacht hatten.
»Mein Onkel wurde letzte Nacht überfallen«, erzählte Tess und kauerte sich auf einen der Stühle. »Irgendjemand hat ihn böse zusammengeschlagen.«
»O Gott. Welcher? Welche Seite?« Unvermeidbare Fragen und schwierige dazu, denn Tess hatte neun weitere Onkel – die fünf jüngeren Brüder ihres Vaters, die vier älteren ihrer Mutter. Spike war in Wahrheit ihr Cousin, und um die Sache noch komplizierter zu machen, hatte man sich nie darauf einigen können, zu welcher Seite der Familie er gehörte. Sein Nachname war Orrick. Früher bestimmt mal O’Rourke, hatte Tess’ Mutter stets gesagt. Das könnte einer dieser osteuropäischen Judennamen sein, hatte ihr Vater stets gekontert, den die Immigrationsbeamten versaut haben.
»Der, dem das Point gehört, die Bar an der Franklintown Road. Es war ein Raubüberfall, und sie waren sauer, weil er kein Geld hatte.«
»In dieser Stadt kann man wirklich nicht mehr leben.«
»Das sagst du jeden zweiten Tag. Du suchst nur nach einem Grund, das Haus in Ruxton zu kaufen.« Dieser grüne behütete Vorort keine fünf Meilen außerhalb der Stadtgrenze war eine Art Codewort zwischen ihnen: Er symbolisierte die endgültige Aufgabe.
Tyner lächelte reuig. »Die Stadt macht es Steuerzahlern nicht leicht, hierzubleiben, Tess. Vor allem nicht nach diesem Winter. Meine Straße wurde nicht ein einziges Mal geräumt oder gestreut. Jedes Mal wenn es geschneit hat, war ich gestrandet.«
»Das musst du mir nicht erzählen. Vergiss nicht, ich bin fünfmal zu dir da rausgefahren, ich bin mit Skiern deine Straße entlanggeschliddert. Und du hast immer so getan, als wäre es ganz schrecklich, dass ich Gemüse vorbeibringe.«
»Ich wollte Brandy, kein Essen. Du wirst nie als Bernhardiner durchgehen, Tess.«
Bernhardiner. Tess dachte jetzt nicht mehr an die Vergangenheit, sondern an die Gegenwart. Hund. Sie sollte eine Windhund-Rettungsgruppe anrufen, wie Steve es ihr geraten hatte.
Sie überließ Tyner seiner wie üblich mäßigen Laune, ging zurück an ihren Schreibtisch und blätterte im Telefonbuch, bis sie tatsächlich einen Eintrag für Windhunde in Maryland fand.
»Windhunde Maryland.« Das atemlose Wesen am anderen Ende der Leitung war eine Frau mit einer netten, kehligen Stimme. Im Hintergrund bellten wie wild Hunde. Tess sah sie sofort in Blue Jeans vor sich, ganz voller Hundehaare. Igitt.
»Hi, ich habe anscheinend von meinem Onkel einen Windhund geerbt und würde mich gern schlau machen. Welches Futter brauche ich? Wie sieht’s aus mit Auslauf, besonderem Verhalten? Sowas.«
»Wie lang hat ihr Onkel den Hund gehabt? Ich meine, hat er ihn erst vor Kurzem adoptiert, oder ist er schon eine Weile bei ihm? Wie geht es ihm?«
Tess war verwirrt, sie dachte, »er« müsste ihr Onkel sein. Dann wurde ihr klar, dass die Frau den Hund meinte. »Äh, erst seit Kurzem, schätze ich. Sie wusste nicht, wie man Treppen geht.«
»Ist er von hier?«
»Der Hund? Weiß nicht.«
»Ihr Onkel. Wie heißt er?«
»Spike Orrick.«
»Bei dem Namen klingelt nichts, und wir kümmern uns eigentlich um die meisten Adoptionen in und um Baltimore.« Die Stimme der Frau klang plötzlich viel weniger freundlich. »Sind Sie sicher, dass er den Hund korrekt adoptiert hat? War er mit ihm beim Tierarzt? Man muss die Hunde nämlich sterilisieren lassen, wissen Sie. Das ist Teil der Vereinbarung. Ist der Hund jetzt bei Ihnen? Wir haben ein Identifikationssystem, und wenn Sie bloß …« Tess legte auf. Wem wollte sie etwas vormachen? Spike hatte noch nie etwas korrekt gemacht. Wenn Esskay nur reden könnte. Wenn Spike nur reden könnte.
Aber dann rief sie im Saint Agnes an und erfuhr: Spike lag jetzt im Koma, niemand wusste, wie es weitergehen würde.
»Was ist so selten wie ein Frühjahrstag? Was ist so selten wie ein Märztag in Baltimore, an dem tatsächlich die Sonne scheint?«, murmelte Tess vor sich hin, als sie am Abend die Treppe zum Brass Elephant hochstieg. Sie sorgte sich um Spike, freute sich aber auch auf die Zeit in ihrer Lieblingsbar mit einem ihrer Lieblingstrinkbrüder.
Die Brass Elephant Bar war ein gut gehütetes Geheimnis, und die Stammkunden waren froh darum. Sie war ein billiges Versteck über einem teuren Restaurant. Während Tess’ Arbeitslosigkeit war sie für sie unverzichtbar geworden, ein Fluchtort, an dem sie sich zivilisiert und umsorgt fühlen konnte und an dem sie für fünfzehn Dollar gut essen konnte. Das Licht war gedämpft, genau wie die Musik; Chet Baker, Johnny Hartman und Antonio Carlos Jobim murmelten ihre Liebeslieder so leise, dass man nur manchmal einen geflüsterten Reim wie love/above, art/heart oder sky/high hören konnte. Vor ein paar Jahren hatte es einen schrecklichen Augenblick gegeben, als eine neue Barkeeperin eine Jazzversion des Schmusehits aus dem neuesten Disney-Trickfilm gespielt hatte, aber das hatte man ihr schnell wieder abgewöhnt. Der Brass Elephant überlebte gute und schlechte Zeiten, von Marylands schwindsüchtiger Ökonomie bis zu diesen Best-of-Baltimore-Listen, die über die Martinis gestolpert waren, sodass plötzlich ein paar Leute auftauchten, die nicht unbedingt Martinis mochten, aber gerne betonten, dass sie die besten probiert hatten.
Gut, ihr Lieblingsbarkeeper war da. Und Feeney auch, er saß auf einer Bank in einer dunklen Ecke, seine Finger umklammerten den Stiel eines Martiniglases, und auf dem weißen Tischtuch vor ihm lag ein vielsagender Berg zahnstochergespickter Oliven. Tess deutete auf Feeneys Glas und zeigte damit an, dass sie dasselbe wollte, dann setzte sie sich auf den Stuhl Feeney gegenüber. Er war in sich zusammengesackt und schien sie auch nicht zu bemerken, es sei denn, man betrachtete ein paar genuschelte Zeilen von Auden als angemessene Begrüßung.
»Ich sitze in einer Spelunke / In der 52nd Street / Unsicher und voller Angst, / Während die klugen Hoffnungen / Eines niederträchtigen Jahrhunderts schwinden.«
Tess seufzte. Richard Burton hätte es nicht besser – oder besoffener – sagen können. Auden war ein besonders schlechtes Zeichen, er war reserviert für die ganz tiefen Tiefs. Nur Yeats oder Housman waren schlimmer.
»Du bist in der Charles Street, und der Brass Elephant ist keine Spelunke, obwohl ich mit dir nicht über die Nachteile dieses verdammten Jahrzehnts diskutieren würde.«
»Ich habe bloß meine Stimme / Um die fältigen Lügen ungesagt zu machen / Die romantische Lüge im Gehirn / Vom sinnlichen Mann auf der Straße …«
»Das wollten sie also von dir? Du solltest der Mann auf der Straße sein?« Das wäre ja gar kein so großes Problem, davon könnte sie Feeney ablenken. Tess kannte den unerschütterlichen Glauben der Medien, dass normale Menschen etwas von aktuellen Ereignissen verstünden. Wenn irgendetwas Wichtiges in weiter Ferne passierte, schickten die Redakteure gnadenlos Reporter auf die Straße, um gemeine Zitate von gemeinen Menschen einzuholen.
Der Barkeeper tauchte mit ihrem Drink am Tisch auf. Das Ritual war Teil ihres Vergnügens – die Drehung des Shakers aus dem Handgelenk, wie er den Martini künstlerisch einschenkte. Tess nippte daran und fühlte sich gleich besser, stärker, klüger, bereit für Feeney in extremis.
»Und was war heute die Frage? Irgendwas mit der NATO? Die NATO ist doch immer gut für einen Mann auf der Straße. Ich weiß noch, als ich beim Star war, hat jemand in Pigtown gedacht, die NATO sei ein überdachtes Schwimmbad, das der Bürgermeister im Patterson Park bauen wollte.«
»Du enttäuschst mich, Tess«, sagte Feeney bitter und begann, an einem der Zahnstocher von dem Hügel vor ihm zu kauen. »Du nimmst das alles genauso wörtlich wie meine bescheuerten Chefredakteure.«
Tess nahm einen zweiten größeren Schluck aus ihrem Glas, sie genoss die Kühle und dann den kleinen hitzigen Nachgeschmack. Wirklich ein wunderbarer Drink.
»Es ist auch schön, dich zu sehen, Feeney.«
»Schön, mich zu sehen? Du kannst es kaum ertragen, mich anzuschauen.«
Verloren in seinem eigenen Elend, hatte Feeney unwissentlich die Wahrheit ausgesprochen. Tess mied seinen Blick, der dunkel war von Bitternis, und sein nach unten gekehrtes Grinsen. Feeney war immer grau gewesen – grau-blaue Augen, grau-blondes Haar, selbst seine Haut wirkte grau-rosa, sie war nur ein wenig heller als die halbrohen Hotdogs, die er bei den Ständen vor dem Gerichtsgebäude kaufte. Aber heute sah alles noch etwas fahler aus als sonst, als bekäme er nicht genug Sauerstoff. Auf seinem blassen Gesicht wirkten die aufgeplatzten Äderchen in seinen Wangen wie Straßenkarten ins Nirgendwo. Gin-Blüten, die eine Blume, die man das ganze Jahr über im gottverdammten Baltimore finden konnte.
»Was ist los, Feeney?«
»Meine Karriere ist vorbei.«
»Das sagst du einmal im Monat.«
»Ja, aber normalerweise ist das bloß ungerechtfertigte Paranoia. Heute habe ich es ganz offiziell erfahren. Ich gehöre nicht dazu. Ich bin kein Mannschaftsspieler.« Er nuschelte schrecklich.
»Sie können dich doch nicht feuern.« Der Beacon war ein Gewerkschaftsblatt, was es schwierig, wenn auch nicht unmöglich machte, Angestellten zu kündigen. Aber Feeney war gut. Ein Profi. Es wäre schwer, ihn loszuwerden. Es sei denn, er hatte es ihnen leicht gemacht, indem er Anweisungen der Redakteure ignoriert hatte. Ungehorsam war Grund genug für eine fristlose Kündigung.
»Nehmen wir mal an, du hättest die Story deines Lebens geschrieben, Tess«, sagte er und beugte sich zu ihr herüber. Sein Gesicht war ihrem so nahe, dass sie den Gin riechen konnte, den er zu sich genommen hatte, und auch ein wenig Tabak. Merkwürdig – Feeney hatte vor Jahren aufgehört zu rauchen. »Die beste Story, die du dir vorstellen kannst. Stell dir vor, darin wäre alles, was du von einer Geschichte erwarten kannst, und für alles gibt es mindestens zwei Quellen. Und stell dir vor, diese gottverdammten feigen Ratten wollen es nicht drucken.«
»Das hat irgendwas mit dieser Basketballgeschichte zu tun, oder? Die Story, von der du mir gestern noch nichts sagen wolltest.«
Feeney nahm seine Gabel und begann, in den Happy-Hour-Ravioli herumzustochern, bis kleine Tomatensoßenspritzer das Tischtuch zierten. »Na, jetzt kann ich sie dir ja erzählen. Überhaupt wird sie nur dann jemand hören, wenn ich sie erzähle. Vielleicht sollte ich mich mit einem Schild an die Straßenecke stellen und anbieten, sie für einen Dollar vorzulesen.«
»Wie gut ist sie? Wie groß?«
Wieder antwortete er mit seiner Singsang-Dichterstimme: »Wink Wynkowski, Baltimores größte Hoffnung, eine Basketballmannschaft nach Baltimore zu locken, hat in seiner Vergangenheit vieles getan, über das er lieber nicht spricht, vor allem nicht mit der NBA. Seine Geschäfte sind ein Kartenhaus, er steht kurz vor der Pleite, wird von Anwälten verfolg wegen Sachen von ›Ambulanter Notdienst‹ bis ›Zippys Druckerei‹. Vielleicht kann er genug für eine Mannschaft zusammenkratzen, aber er ist nicht flüssig genug, sie anschließend zu finanzieren.«
»Warum will er dann eine kaufen, wenn es ihn in den Bankrott treibt?«
»Gute Frage. Zwei mögliche Antworten. Er ist dumm – das darf man bezweifeln. Oder er will die Mannschaft ziemlich schnell wieder verkaufen, sobald die Stadt ihm die neue Sporthalle gebaut hat, die den Wert der Mannschaft über Nacht verdoppelt.«
»Das kommt mir ein bisschen weit hergeholt vor.«
»Hey, erinnerst du dich an Eli Jacobs? Der hat 1980 die Orioles für 70 Millionen gekauft. Als in der Rezession seine Geschäfte zusammenbrachen, hat er sie für fast 175 Millionen verkauft, und es war Camden Yards, bezahlt vom Staat, das die Mannschaft so teuer machte. Wenn Wink es schafft, seine fliegenden Bauten noch ein paar Jahre intakt zu halten und die Mannschaft zu verkaufen, bevor seine Kreditgeber ihm die Luft abwürgen, streicht er einen Riesengewinn ein.«
»Gibt es noch mehr?« Feeney runzelte die Stirn. »Nicht, dass da mehr sein müsste«, setzte sie eilig hinzu. »Du hast die Punkte miteinander verbunden, ich kann das Bild sehen.«
»Aber es gibt mehr. Viel mehr. Dunkle Geheimnisse. Eine üble erste Ehe. Miese Angewohnheiten, die gar nicht zum Profisport passen. Wie viel würdest du für diese Story bezahlen? 39,95 Dollar? 49,95? 59,95? Warte, sag nichts – wie wäre es, wenn wir noch ein paar Ginsu-Messer dazugeben?« Er begann, leicht hysterisch zu lachen, dann riss er sich zusammen. »Glaub mir, Tess. Die Story steht. Ich wünschte, mein Haus stünde auf einem ähnlich soliden Fundament.«
»Wieso bringt die Zeitung sie dann nicht?«
»Alle möglichen Gründe. Sie behaupten, sie wäre nicht hieb- und stichfest. Dass es rassistisch wäre, so aggressiv mit einer NBA-Story an den Start zu gehen, wo wir doch den Football, der vor allem die Weißen interessiert, ohne Gegenwehr in die Stadt gelassen haben. Sie sagen, wir hätten zu viele anonyme Quellen, aber ein paar der Leute, die mit mir geredet haben, arbeiten nun mal noch für Wink, Tess. Die haben gute Gründe, anonym bleiben zu wollen. Einer vor allem. Die Chefredakteure haben uns heute Nachmittag gesagt, wir müssten ihnen alle Namen der Quellen nennen, bevor sie die Geschichte bringen. Sie wussten, dass ich das nicht tun würde, eher würde ich die Geschichte aufgeben. Und genau darum ging es. Sie brauchten eine Entschuldigung, um der Story den Garaus zu machen, weil sie uns nicht trauen.«
»Uns?«
»Rosie und mir. Du hast sie kennengelernt. Sie ist gut für eine Anfängerin. Du solltest mal die Sachen sehen, die sie über Winks erste Ehe rausgefunden hat.«
»Dann trauen sie doch wahrscheinlich ihr nicht. Weil sie neu ist und jung.«
Feeney schüttelte den Kopf. »Beim Beacon heutzutage ist es besser, neu und jung zu sein als alt und alt. Sie. Ich. Wir beide. Ich weiß es nicht, und es ist mir auch egal. Ich bin müde, Tess. Ich bin so müde, und es ist so eine verdammt gute Story, und am liebsten würde ich mich einfach jetzt hier auf dem Tisch schlafen legen, aufwachen und dann feststellen, dass sie sie doch noch gedruckt haben.«
»Feeney, ich bin sicher, sie werden sich bei dir entschuldigen, und du wirst deine große Story bekommen«, sagte sie und schob sein Wasserglas näher zu ihm hin in der Hoffnung, ihn abzulenken. Er scheint sich zu beruhigen, dachte sie. Vielleicht ist der Abend noch zu retten.
Feeney sprang auf. Er umklammerte das Martiniglas immer noch fest. »Es geht doch nicht um mich oder meine große Story!«, rief er. Die anderen Barbesucher schauten sich nach ihm um, sie betrachteten ihn überrascht und verärgert.
»Okay, es geht um mich«, zischte er, wobei er sich herunterbeugte, sodass nur Tess ihn hören konnte. Er hatte so viel getrunken, dass ihm Gin aus den Poren zu kommen schien. »Es geht um meine Karriere oder was davon noch übrig ist. Aber es geht auch um diese wichtigen Sachen, um die es in Zeitungen doch eigentlich gehen sollte. Du weißt schon – Wahrheit, Gerechtigkeit, der erste Zusatzartikel, die vierte Macht. Wir sollten keine Cheerleader sein, die ›Lah-lah-lah, gib uns den Ball‹ rufen. Wir sind gottverdammte Wachhunde, die einzigen, die es interessiert, ob die Stadt gut bei etwas abschneidet oder von irgendeinem Drecksack über den Tisch gezogen wird.«
Er schwankte beim Sprechen ein wenig, und seine Worte verschwammen. Er brachte kaum noch Konsonanten hervor, aber er war nicht so betrunken, wie fünf Martinis vermuten ließen. Seine Trauer hatte ihn stärker im Griff als der Alkohol.
»Feeney, was soll ich denn dagegen tun?« Tess war nicht die beste Zuhörerin, wenn es um die Ehre des Journalismus ging.
»Was schon, trink auf das Ende meiner Karriere!«, dröhnte er und prostete allen Anwesenden mit seinem inzwischen leeren Glas zu. Die üblichen Verdächtigen hoben erleichtert ihre Gläser. Das war der Feeney, den sie kannten, der für das Publikum spielte.
»Weshalb bist du so glücklich?«, rief ein weißhaariger Mann von der Bar aus.
»Bin ich glücklich? Bin ich frei? Die Frage ist absurd! Es ist etwas weit, weit Besseres, was ich tue, als was ich je getan habe!« Feeney knallte sich seine zerknitterte Kappe auf die Rübe und eilte hinaus, die Fransen seines Schals flogen hinter ihm her, das Martiniglas behielt er in der Hand. Tess blieb mit einem halb ausgetrunkenen Martini, Feeneys Rechnung und ohne Gesellschaft für die Tortellini, auf die sie sich gefreut hatte, zurück. Feeney wusste, wie man abging, das musste man ihm lassen. Nur die Anspielung auf Charles Dickens’ Eine Geschichte aus zwei Städten war ein bisschen ungewöhnlich – zu leicht erkennbar für Feeneys Geschmack. Er bevorzugte unbekanntere Zeilen, wie die davor: Bin ich glücklich? Bin ich frei? Das kam ihr verdammt bekannt vor, aber ihr fiel nicht ein, woher.
Es war noch nicht acht Uhr, und jetzt war sie allein, und außerdem verdammt hungrig. Tess hasste es, allein im Restaurant zu essen. Eine Charakterschwäche, das war ihr klar, und eine Beleidigung für Feministinnen in aller Welt. Aber so war es nun einmal. Sie trank aus, beglich Feeneys stattliche Rechnung und ging. Sie könnte bei Eddie’s Eager reinschauen, sich was Tiefgekühltes und vielleicht noch eine der blöden Zeitschriften holen, die man in der Badewanne las. Der verdammte Feeney. Sie hatte ausgehen wollen, und jetzt war sie allein, hatte einen Drink heruntergestürzt und konnte sich auf eine tiefgekühlte fettarme Lasagne freuen.
Aber als sie dreißig Minuten später ihre Wohnung erreichte, kam der Duft im Flur aus ihrer Küche, nicht aus Kittys. Sie erschnupperte Lamm, Brot, Backäpfel. Sie nahm zwei Stufen auf einmal, wie die hungrige Esskay am Morgen.
Crow empfing sie in der Tür, er umschlang sie mit seinen langen Gliedern, bevor sie auch nur den Mantel ausziehen oder die Einkäufe abstellen konnte.
»Ich hab dich nicht erwartet«, murmelte sie in seinen kratzigen Wollpullover, und sie hoffte, er würde nicht bemerken, wie sehr sie sich freute. »Ich hab dir eine Nachricht hinterlassen, dass ich mit Feeney ausgehe.«
»Ich hab heute für Kitty abgeschlossen, also dachte ich mir, ich geh hoch und mach was zu essen. Schlimmstenfalls wärst du ganz kicherig von deinem Saufgelage heimgekommen, ich hätte dich ins Bett gesteckt und morgen Mittag Lammeintopf und Apfelkuchen gegessen.«
»Glaub mir, Feeney war heute Abend ganz bestimmt nicht kicherig.«
Crow hörte nicht wirklich zu. Er küsste ihre Augenbrauen und ihre Ohren, er fasste sie überall an, er schien wie immer erstaunt zu sein, sie wieder zu sehen, selbst in ihrer eigenen Wohnung.
»Dein Gesicht ist ganz kalt, Tesser«, sagte er und benutzte den Kindheitsnamen, den sie sich selbst gegeben hatte, eine Mischung aus ihren beiden Vornamen, Theresa Esther. Ein Name, der nur Familienmitgliedern und ganz alten Freunden zustand. Crow war keiner davon, nicht nach fünf Monaten. Er war 23, sie 29. Fröhliche, sorglose 23. Er hatte glänzend schwarzes Haar, das fast so lang war wie ihres, obwohl er normalerweise grüne oder rote Streifen einfärbte, und er hatte einen federnden Gang. Es überraschte sie immer noch, dass sie den Kopf heben musste, um in sein schmales eckiges Gesicht zu schauen, als bedeutete der Altersunterschied, dass er auch kleiner sein müsste.
»Was hältst du von dem Neuzugang?«, fragte sie und deutete mit dem Kinn auf Esskay, die Tess anstarrte, als versuchte sie sich zu überlegen, woher sie sie kannte.
»Sie ist süß. Kitty und ich haben sie vorhin rausgelassen, dann habe ich ihr Reis und gedämpftes Gemüse gemacht. Sie hat eine sehr alte Seele, unsere neue Hündin.«
Tess runzelte die Stirn. »Unser« war ein Wort, das man um jeden Preis meiden sollte. Ihre Beziehungsregeln – genauer gesagt ihre Nichtbeziehungsregeln – verbaten gemeinsame Bücher oder CD’s, erforderten das Aufteilen der Rechnungen, wenn man essen ging, und erlaubten keinerlei gemeinsame Anschaffungen.
Aber sie sagte bloß: »Wieso um Himmels willen hast du ihr Reis und Gemüse gemacht? Ich hab doch zehn Kilo Hundefutter.«
»Ich koche gern für meine Frauen«, sagte er und rückte ihr einen Stuhl an dem großen Tisch zurecht, der zugleich als Esstisch und Tess’ Schreibtisch fungierte. »Hey, hab ich dir erzählt, dass Poe White Trash am Samstag spielt?«
»Wo?«
»In der Floating Opera.«
»Das heißt ja wohl, dass ich mir nichts von Rodgers und Hart wünschen kann«, sagte sie und versuchte, keine Grimasse zu schneiden. Die Floating Opera war ein regelmäßiger Rave ohne festen Standort, der durch die ganze Stadt zog – oder zumindest durch die angesagteren, heruntergekommenen Gegenden – gemäß eines Musters, das nur die Jünger begriffen. Deshalb hatte die F.O. keine der Annehmlichkeiten eines echten Clubs, wie Alkohol, Essen oder Toiletten, aber alle Nachteile: Zigarettenrauch, zu laute Musik, zu junges Publikum.
»Rodgers und Hart«, stöhnte Crow. »Wir haben nichts übrig für diesen Retro-Dreck.«
»Elvis Costello hat ›My Funny Valentine‹ gesungen.«
»Tesser, Elvis Costello ist alt genug, um mein Vater zu sein.«
»Aber nicht alt genug, um meiner zu sein, stimmt’s?«
Er lächelte, was sie entwaffnete. »War Feeneys Laune ansteckend? Oder bist du bloß wild auf einen Streit?«
»Ein bisschen von beidem«, gestand sie und aß zerknirscht und peinlich berührt von ihrer Laune stumm ihren Eintopf.
Nach dem Essen stellte sie die Schalen in die Spüle, nur damit Crow sie für Esskay wieder rausholte, die den Resten schnell den Garaus machte. Crow streichelte die Hündin und klopfte ihr auf die Seiten. Für so einen dünnen Hund hatte sie jede Menge Muskeln: Crows liebevolle Schläge dröhnten wie auf einer Trommel.
»Ist Eintopf gut für sie, nach dem Reis und dem Gemüse?«, fragte Tess, die sich an Steves trübe Vorhersagen vom Vormittag erinnerte.
»Kitty hat unter ›Frauen und Hobbys‹ ein Buch über Windhunde stehen«, sagte Crow und rieb Esskays Bauch. Die Hündin guckte glasig, als würde sie vor lauter Wohlgefühl gleich ohnmächtig werden. »Da drin steht, dass sie normalerweise zunehmen müssen, wenn sie nicht mehr laufen, also denke ich, ein bisschen Eintopf wird ihr nicht schaden, obwohl die Frau, die das Buch geschrieben hat, empfiehlt, dass man Hundefutter aus Reis und Gemüse selbst macht. Sie schreibt auch, dass man Salbe auf diese wunden Stellen schmieren soll, wie Wundsalbe für Babys.«
Die Hündin schob ihre Nase in Crows Achsel und bohrte dort herum, als könnten sich Trüffel in den Falten seines uralten Sweaters verstecken. Crow lachte und verpasste der Hündin noch ein paar Seitenhiebe, dann stieß er mit hoher Stimme aus: »Rou-rou-rou.«
Esskay antwortete ihm noch höher, und der Vokal wirkte ein bisschen kompakter: »Ru-ru-ru.«
»Ich bin nicht wirklich ein Jeanette MacDonald- oder Nelson Eddy-Fan«, sagte Tess und schaltete die Anlage ein. Sarah Vaughn’s Stimme erfüllte das Zimmer und übertönte das Crow-Hund-Duett. »Und ich komme mir ein bisschen überflüssig vor. Möchtet ihr zwei alleine sein?«
Crow kam zu ihr herüber und verpasste Tess’ Rücken einen genauso liebevollen Schlag wie dem Windhund. Auch Tess war muskulös, aber voluminöser, deswegen war der folgende Ton tiefer und sanfter.
»Ich würde auch dich mit Salbe einreiben, wenn du wunde Stellen hättest«, flüsterte er. »Brennt es irgendwo, Tesser?«
Durch ihre Sachen hindurch suchten seine Hände Stellen, wo man Knochen fühlen konnte – die Rippen unter den schweren Brüsten, die Beckenknochen, die scharf aus ihren runden Hüften hervorstachen, die knubbeligen Ellenbogen. Er zog ihre Bluse aus ihrem langen, geraden Rock und schob eine Hand unter den Bund, er rieb ihren Bauch, wie er es bei Esskay getan hatte. Mit der anderen Hand zog er die Form ihres Kiefers und ihres Mundes nach, dann berührte er ihren Hals und ihren Nacken, wo er ihr Haar aus dem langen Zopf befreite.
»Gefällt dir das, Tess?« Sie konnte bloß nicken.
Sarah Vaughn ging eine Liste der Dinge durch, die sie der Romantik wegen nicht brauchte: spanische Schlösser, langsame Tänze, Vollmond, blaue Lagunen. Der Windhund stöhnte vor sich hin, leise und fast im Takt der Musik. »Ru-ru-ru.« Tess keuchte und streckte sich nach Crows Gesicht. Sex erschien ihr weniger intim als das hier und daher sicherer.
»Tesser?« Crow hielt ihre Handgelenke und zwang sie, ihm ins Gesicht zu sehen.
Sie wartete, sie fragte sich, was er als Nächstes sagen würde. Sie fürchtete, er würde wieder vorschlagen, bei ihr einzuziehen. Sie fürchtete, er könnte sagen, dass er sie liebte. Sie fürchtete, er könnte sagen, dass er es nicht tat.
Sarah sang davon, dass ihr Herz stillstand. Tess’ Herz schlug schneller und schneller.
»Lass uns ins Bett gehen«, sagte Crow.