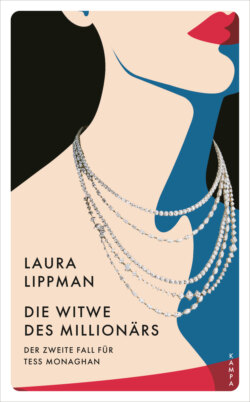Читать книгу Die Witwe des Millionärs - Laura Lippman - Страница 7
4
ОглавлениеDie Maryland Motor Vehicle Administration war, wie die meisten Behörden, ungeheuer ineffizient. Außer wenn man endlich mal eine Verschnaufpause brauchte. Dann war der verdammte Laden plötzlich ein Vorbild in Sachen Geschwindigkeit und Produktivität. Am Mittwochmorgen sehnte sich Tess verzweifelt nach fünf Minuten für sich selbst, aber sie hatte nicht mal die Gelegenheit, ihren Beacon aus der gelben Plastikhülle zu holen, bevor ein fröhlicher Bediensteter ihr auch schon einen Haufen Unterlagen brachte, die Tyner beantragt hatte. Na egal, es gab kein Gesetz dagegen, sich hier auf diese leuchtend blaue Bank zu setzen, hundsmiserablen Kaffee zu trinken und sich die frustrierten Fahrer und Möchtegernfahrer anzuschauen. Die hatten es im Gegensatz zu ihr eilig und mussten deshalb warten. So war die Politik des MVA.
»Ich geb dir zehn Mäuse, wenn du eine Nummer hast, die niedriger ist als meine«, flüsterte ein gehetzter Geschäftsmann Tess zu. Sie kannte den Typen, jemand, der viel zu wichtig war, der alles erledigte, als wäre er der Innenminister, und deswegen drängelte er sich in der Reinigung vor oder schnitt einen an der Ampel, denn natürlich musste er gleich in die Air Force One steigen und an einem Gipfel im Mittleren Osten teilnehmen.
»Ich habe überhaupt keine Nummer«, sagte sie zufrieden und musste darüber lachen, wie er von ihr wegschoss. Ja, nur eine echte Irre würde im MVA abhängen wie im Freiheitspark, wie Tommy sagen würde. Aber Tess war den ganzen Morgen unterwegs gewesen, seit der Wecker nicht geläutet hatte, was sie dreißig Minuten gekostet hatte. Weitere dreißig Minuten hatte sie verloren, weil Esskay auf den Wohnzimmerteppich gekotzt hatte. Tyner hatte sie für ihre Schlamperei bestrafen wollen, also hatte er Tess gleich wieder mit einer Liste an Unterlagen losgeschickt, für die sie fünf Behörden in zwei Gerichtsbarkeitsbezirken besuchen musste. Jetzt war es beinahe elf, und zum ersten Mal hatte sie die Gelegenheit, von ihrem Kaffee zu trinken, statt ihn sich im Auto in den Schoß zu schütten. Außerdem war es die erste Gelegenheit, im Krankenhaus anzurufen und zu fragen, wie es Spike ging.
»Immer noch stabil«, sagte eine fröhliche Krankenschwester, deren Onkel wahrscheinlich nicht im Koma lag.
»Immer noch stabil. Ist das nicht redundant?«, schnauzte Tess und knallte den Hörer wieder auf. Sie schüttete sich Kaffee in den Rachen, der heiß und kräftig genug war, ein ordentliches Brennen hinter dem Brustbein auszulösen, dann überflog sie die Titelseite. Nichts Interessantes über dem Bruch. Sie arbeitete sich zur unteren Hälfte der Seite, dem Teil, der normalerweise für Features und langweilige, aber aus irgendeinem Grunde notwendige Geschichten reserviert war. Feuchtgebiete, Abstimmungen, Sozialhilfereformen. »Pflichtficks«, wie einer ihrer ehemaligen Redakteure so schön gesagt hatte.
Aber Feeneys Autorenzeile zierte dieses spezielle Stück Text auf der Titelseite. Und außer der Headline war nichts Langweiliges daran.
QUELLEN DEUTEN AUF WYNKOWSKI-PROBLEME HIN
Von Rosita Ruiz und Kevin V. Feeney,
Beacon-Redakteure
Gerard S. »Wink« Wynkowski, jener Millionär aus eigener Kraft, der versprochen hat, seiner Heimatstadt eine professionelle Basketballmannschaft zu kaufen, kann seinen Traum vielleicht nie verwirklichen, wenn man bedenkt, wie es um seine Firmen steht und was es mit seiner bunt gescheckten Vergangenheit auf sich hat, in der unter anderem eheliche Gewalt und eine verheerende Spielsucht zu Problemen führten, erfuhr der »Beacon«.
»Bunt gescheckte Vergangenheit?«, fragte Tess laut, sodass der eilige Geschäftsmann sich lieber noch ein paar Sitze weiter von ihr wegsetzte. »Oh, Feeney, bitte sag mir, dass du das nicht geschrieben hast.«
Davon abgesehen war es Feeneys Story, genau wie er sie ihr geschildert hatte. Wie hatte er nicht wissen können, dass sie heute kam? War er so besoffen gewesen? Nein, selbst im Suff hätte er gewusst, dass seine Geschichte in der Zeitung stünde. Irgendjemand hatte gestern Abend die Chefredaktion umgestimmt. Vielleicht hatte einer der TV-Sender die Story auch in Planung, so unwahrscheinlich das auch sein mochte.
Wynkowskis Firmengruppe »Montrose Enterprises« ist nur noch ein Kartenhaus, in dem das Geld von einer Tochterfirma zur anderen wandert, um Engpässe zu vertuschen und für Cashflow zu sorgen. Seine Gläubiger reichen wortwörtlich von A bis Z – von »Ambulanter Notdienst« bis zu »Zippys Druckerei«, welche die Flyer für die Veranstaltung am Inner Harbor druckten.
Wynkowski hat es stets geschafft, seine größten Lieferanten zu bezahlen, aber kleinere Firmen sind oft gezwungen, ihn zu verklagen, um alte Schulden einzutreiben, was daran zweifeln lässt, ob Wynkowski über genügend Geld verfügt – benötigt werden geschätzt 95 Millionen Dollar –, um eine Mannschaft in die Stadt zu holen.
Selbst wenn Wynkowski den Deal finanziell stemmen sollte und sogar noch das Geld aufbringt, die monatlichen Kosten einer Mannschaft zu decken, würde eine Überprüfung seiner Person sicher zu einem Abbruch seiner Verhandlungen mit der NBA führen, wenn die Liga feststellt:
– Glaubt man Freunden und Bekannten, ist Wynkowski ein unverbesserlicher Spieler, der große Summen auf Sportereignisse setzt.
– Er führte eine dramatische erste Ehe, in der die Polizei des Öfteren wegen ehelicher Gewalt einschreiten musste, berichten Quellen, die dem Paar damals nahestanden. Er zahlt seiner ersten Frau großzügigen Unterhalt, denn der Schaden, den er ihr über die Jahre zugefügt hat, macht es ihr unmöglich, einer Arbeit nachzugehen.
– Winks Aufenthalt im Jugendgefängnis, den er gern harmlosen Streichen zuschreibt, war die Folge einiger bewaffneter Überfälle, die er beging, als er die Junior High School besuchte.
Damals landete Wynkowski in der Montrose School, einer bekannten und mittlerweile geschlossenen Jugendstrafanstalt, deren Namen er für seine Firmengruppe übernahm. Eine Quelle bestätigt, dass er drei Jahre dort blieb, was ungewöhnlich lang ist.
Aber in der Montrose entdeckte Wynkowski auch sein Talent für Basketball. Es gelang ihm aufgrund seiner Erfolge an der Southwestern High School, die Erinnerungen an seine unschöne Vergangenheit auszulöschen. Mittlerweile ist er ausgesprochen wohlhabend und spendet großzügig an lokale Wohltätigkeitsorganisationen. (Siehe Basketball, SA)
»Du hast es ja doch noch geschafft, Feeney.« Tess sagte das wieder laut. »Gute Arbeit.« Mit einem zufriedenen Seufzer las sie den Rest einer Story, die sich zweifelsohne als Grabrede für Baltimores Traum von einer Basketballmannschaft erweisen würde. Feeney hatte recht, da war alles drin – Verbrechen und Geld. Und als Bonus noch eine geschlagene Ehefrau! Feeney und Rosita hatten einen Dreiertreffer gelandet.
Baltimore teilte Tess’ Stolz über Feeneys Arbeit nicht unbedingt. Während sie den Rest ihrer bürokratischen Laufarbeiten absolvierte, war die Wink-Winkowsky-Geschichte in der Stadt in aller Munde. Der allgemeine Tenor war: Wegen der schlechten Nachrichten im Beacon würde die Stadt jetzt vielleicht keine Basketballmannschaft bekommen.
»Ich weiß nicht, warum die immer an allem meckern müssen«, hörte sie einen Mann im Sandwich-Laden Never on Sunday grummeln, während sie auf ihr extrascharfes Putensandwich mit Tomate und Salat wartete. »Aber es würde natürlich auch zur NBA passen, dem armen Kerl das erste bisschen schlechte Publicity vorzuwerfen.«
»Ja, die Schweine suchen ja bloß nach einem Grund, nicht zu unterschreiben«, stimmte der Mann am Tresen zu. »Sie hassen Baltimore.«
Darin waren sich alle in der Schlange einig, selbst die, die den Anfang des Gesprächs gar nicht mitbekommen hatten. Sie hassten Baltimore. Die NBA, Washington, D.C., die Vorstadtbewohner, die vor Jahren zusammen mit ihren Steuergeldern abgehauen waren. Die Ostküste, die Städte im Westen, die Gesetzgeber in Annapolis. New York, Hollywood, Großfirmen, kleinere Firmen, Gott, das Universum. Sie alle hatten sich einvernehmlich gegen das arme kleine Baltimore verbündet.
Eine schmerzhaft klare Frauenstimme durchschnitt das allgemeine Elend.
»Herrgott, Leute, erspart mir das Gejaule. Darauf habe ich nun gar keine Lust. Gleich sind wir wieder bei der weltumspannenden jüdischen Bankenverschwörung. Könnt ihr nicht mal einen Moment die Klappe halten, während ich auf mein Grilled Cheese Sandwich mit Bacon warte – ohne Tomaten, die schmecken um diese Jahreszeit wie tote Tennisbälle.«
Die Stimme war Tess bekannt, die Attitüde erst recht.
»Whitney Talbot«, sagte Tess und drehte sich um, sodass sie ihre alte Freundin betrachten konnte. »Was machst du denn in dieser Gegend?«
»Tess! Ich wollte dich schon ewig anrufen. Seit du dich mit diesem kleinen Jungen eingelassen hast, bleibt dir keine Zeit mehr für deine jungfräuliche alte Freundin.« Dieses Informationsbruchstück erweckte für einen Augenblick das Interesse der anderen Anwesenden an Tess, aber schnell wanderten die Blicke wieder hinüber zu Whitney. Tess war rot angelaufen und vom Winde zerzaust – und der hinreißenden Person, die aussah wie die Göttin des Rasenhockeys, keineswegs gewachsen.
Whitney Talbot war genauso groß wie Tess, 1,75 cm, aber dünner. Ihre dichten blonden Haare trug sie in einem sorglosen mädchenhaften Bob, und sie gab alle sechs Wochen sechzig Dollar aus, damit die Haare genau nur bis zum Kinn reichten, dem spitzesten Knochen in einem Körper voll langer spitzer Knochen. Das war ihr einziger Makel, falls Talbot überhaupt irgendwelche Makel hatte. Sie war reich und gut erzogen, da hatte man nun mal seine Macken. Tess kannte Whitneys Macken gut: Sie hatten sich im College ein Zimmer geteilt, hatten in einer Mannschaft gespielt, waren gegeneinander angetreten, sie wetteiferten insgeheim, wie es so viele Freundinnen tun.
Tess ging an der Schlange entlang zurück und umarmte ihre Freundin. Verwandelte sie sich wirklich in eine der Frauen, die ihre Freundinnen fallen ließen, sobald ein fester Freund auftauchte? Aber es war auch ein verdammt harter Winter gewesen, man wollte sich einkuscheln, nicht ausgehen.
»Crow ist okay, aber er ist bloß ein Typ«, sagte sie. »Dich kann keiner ersetzen, Whitney. Nimm doch dein Sandwich mit in Tyners Büro, dann können wir zusammen zu Mittag essen. Reden.«
Whitney schüttelte den Kopf. »Ich muss zurück zum Beacon. Da ist heute die Hölle los.«
»Wegen Feeneys Story? Ich habe gehört«, erstaunlich, wie gut sich diese Phrase nach zwei Jahren außerhalb des Jobs anhörte, »dass sie gar nicht erscheinen sollte.«
Whitney war nicht sonderlich beeindruckt. Sie wusste, dass Tess genau zwei Quellen beim Beacon hatte, und sie war eine davon. »Hast du gehört, dass sie heute nicht kommt oder dass sie gar nicht erscheinen soll?«
»Da weißt du mehr als ich.«
»Echt, Tess, du weißt doch, dass der redaktionelle Teil mit den Nachrichten wenig zu tun hat. Ich habe keine Ahnung von der Wynkowski-Story, außer dass, wie man in meinem Bereich gerne sagt, man die Sache im Auge behalten soll.« Whitney war eine der jüngsten Mitarbeiterinnen der Zeitung, aber sie war für den Job gut geeignet – sie war die geborene Besserwisserin.
»Komm schon, Talbot. Spuck’s aus. Ich hab belastende Fotos von dir aus dem College mit einer Zigarre, einem Typen und einem Fläschchen Scotch.«
»Die alte Regel, sich niemals mit einem toten Mädchen oder einem lebenden kleinen Jungen erwischen zu lassen, gilt doch nicht für unser Geschlecht, Schätzchen.« Whitney runzelte die Stirn. »Obwohl, wenn man die Doppelmoral beim Beacon mit einbezieht, könnte die Zigarre allein alle meine Chancen zunichtemachen. Frauen dürfen einfach keinen Spaß haben.«
»Knallt da jemand mit dem Kopf an die Glasdecke?«
Whitney lächelte nicht einmal. »Weißt du, wo ich heute Morgen war? In einer Suppenküche an der 25th Street. Da gibt es ab 7:30 Uhr Frühstück, und vor elf sind sie nicht fertig. Und heute war wenig los, bloß zweihundert Leute. Am Monatsende sind es dreihundert. Manche Frauen kommen jeden Morgen mit ihren Kindern vorbei, damit ihre Essensmarken länger reichen.«
»Es freut mich, dass der Beacon auch solche Themen behandelt. Normalerweise steht da nur was über die Hungernden in Afrika.«
»Tess, vergib mir, aber ich hasse diese Sozialscheiße. Ich habe über Stadtpolitik geschrieben, ich spreche fließend Japanisch, ich hatte in College Park ein Stipendium in Wirtschaftswissenschaften. Aber darüber darf ich nicht schreiben. Und weißt du, warum? Weil ich nicht stehe, wenn ich pisse!«
Whitneys Ausbruch war zwar nicht besonders laut gewesen, fiel aber genau in einen dieser merkwürdigen Schweigemomente, die in der Öffentlichkeit urplötzlich auftreten können. Die Männer in der Schlange traten verunsichert von einem Fuß auf den anderen. Vielleicht konnten sie sich Whitney im Schlafzimmer vorstellen, sitzend wie stehend, aber nicht auf dem WC. Tess musste zugeben, dass die Vorstellung auch ihren Appetit nicht erhöhte.
»Putensandwich extra scharf«, rief der Mann am Tresen. Tess schnappte sich die fettige braune Papiertüte, griff eine Tüte Utz Cheese Curls vom Regal und wandte sich wieder an Whitney, die mit der Konzentration eines Wachhundes den Fortschritt ihres Grilled Cheese Sandwiches beobachtete.
»Ruf mich an, Süße.« Zuerst hatte sie das lokale Kosewort mit einer gewissen Ironie verwendet, sich aber mit der Zeit daran gewöhnt, denn Baltimore war eine ironiefreie Zone. Selbst der künstliche Spitzname »Charm City« hatte angefangen, ein Eigenleben zu entwickeln. »Crow beschäftigt mich nicht die ganze Zeit. Eigentlich ist er sogar so wild darauf, ein Rockstar zu werden, dass ich an den Wochenenden und Abenden ziemlich oft allein bin.«
Whitney nickte abwesend. Aber als Tess sich dann aus dem Laden herausschlängeln wollte, packte Whitney plötzlich ihren Mantelärmel.
»Tesser?«
»Was?«
»Wie läuft’s im Job? Als Ermittlerin? Hat Tyner viel für dich zu tun?«
»Stellenweise.«
»Stellenweise.« Whitney lachte. Selbst ihr Lachen erschien einem besser als das der meisten anderen Leute – kostbarer, inniger, tiefer. »Ich dachte, für die Stellen wäre nur Crow zuständig. Hast du schon deine Lizenz? Hast du dir eine Waffe gekauft? Du weißt ja, wenn du mit mir mal auf den Schießstand willst …«
»Ich hab noch keine Waffe. Du weißt doch, was ich davon halte.« Whitney hatte ihr Leben lang mit ihrem Vater Enten und Tauben gejagt. Sie hatte immer ein Gewehr in Reichweite, und sie hatte versucht, Tess am Washington College für diesen Sport zu interessieren. Vergebens.
»Ich weiß, ich weiß. Aber du solltest dir eine Lizenz besorgen, sie steht dir gesetzlich zu. Wenn du letzten Herbst deine Waffe dabeigehabt hättest …«
»Dann hätte ich mir wahrscheinlich versehentlich in den Fuß geschossen.« Und alle, die tot waren, wären immer noch tot, erinnerte sie sich, wie immer, wenn jemand von jenem schrecklichen September sprach – was hätte sein können, wer noch am Leben wäre. Der kleine Film, der auf ewig in ihren Träumen zu laufen schien, spielte erneut in ihrem Kopf, ein Vorspann für die Albträume der kommenden Nacht.
»Wenn du meinst.« Whitney küsste sie auf die Wange, und es war keiner dieser unechten Luftküsse, wie sie Menschen ihrer Klasse vergaben, sondern ein echter Knutscher, der ein wenig rosa Lippenstift auf Tess’ Wange hinterließ. Das gefiel den Leuten. Die unstete Whitney aber konzentrierte sich schon wieder auf ihr Sandwich.
»Es wird zu braun. Umdrehen, umdrehen, umdrehen!«, befahl sie dem kleinen verschwitzten Mann am Grill, der blöde grinste, als wäre ihr barscher Befehl ein Beweis für ihre unsterbliche Liebe. »Und könnten Sie bitte die Kruste abschneiden?«