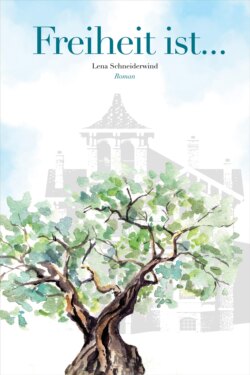Читать книгу Freiheit ist... - Lena Schneiderwind - Страница 5
Kapitel 2
Оглавление22.01.2049
Ich sitze auf der Fensterbank meines 10qm Wohnzimmers in meiner 40qm Wohnung. Standardgröße für einen Level-3-Bürger.
Level 3 bedeutet, dass ich mich im Großen und Ganzen an die Regeln halte und keine größeren Probleme mache. Ab und zu leiste ich mir den ein oder anderen Ausrutscher, aber ich verschwinde damit noch in der Masse der Durchschnittsbevölkerung.
Level 3 bedeutet, ich stehe nicht unter ständiger Beobachtung, aber es kann unangekündigte Kontrollen geben.
Level 3 bedeutet, dass ich bei unerwünschtem Verhalten nicht sofort einkassiert, sondern erst einmal nur ermahnt werde. Selbstverständlich darf ich dabei gewisse Grenzen nicht überschreiten. Einige Verhaltensweisen würde man selbst einem Level 1 nicht durchgehen lassen.
Level 3 bedeutet auch, dass ich mir das Buch, das um Aufmerksamkeit heischend auf meinen Knien ruht, nicht selbst aussuchen durfte. Diese mitreißende Abhandlung über Wurmlöcher und Zeitreisen wurde mir mit meinem monatlichen Lektüre-Paket und den freundlichen Worten „Bitteschön! Extra für Sie ausgewählt! Ihre Bücherlieferung des Monats!“ überlassen. Irgendwie schaffen es die Boten immer, dabei tatsächlich den Eindruck zu erwecken, etwas ganz, ganz Tolles vor der Türe abzustellen. Ich habe noch nie einen von ihnen zu Gesicht bekommen, aber ich frage mich, ob sie zumindest den Anstand hätten, betreten zu Boden zu schauen, wenn sie einem dabei direkt gegenüber stünden.
Ich hatte mir fest vorgenommen, heute die magische 10-Seiten-Hürde zu knacken, aber ein heutzutage äußerst seltenes Naturspektakel bietet mir nun Gott sei Dank eine passable Ausrede, das auf später zu verschieben. Wie gebannt sitze ich vor dem Fenster, beide Hände um eine schöne Tasse Tee verschränkt, und starre die kleinen weißen Flocken an, die elegant zu Boden sinken. Schnee!
Gibt es einen besseren Grund, um alles stehen und liegen zu lassen? Ich kann mir keinen vorstellen. Ich nehme einen Schluck von meinem köstlichen Heißgetränk und kuschele mich noch tiefer in meine übergroße Strickjacke.
Den Tee darf man sich als Level 3 zumindest selbst aussuchen. Natürlich nicht die genaue Sorte, aber zumindest die Geschmacksrichtung darf man angeben und meistens wird dies dann auch berücksichtigt.
Vor 2 Jahren hatte mich ein „bedauerlicher Vorfall“, den ich am liebsten aus meinem Gedächtnis löschen würde, kurzzeitig auf Level 4 zurückgeworfen. In dieser Zeit durfte ich die Bekanntschaft einiger äußerst spannender Tee-Kreationen machen. Vanille-Pudding-Plunder war hier nur eine unter vielen fragwürdigen Innovationen. Aber diese Erfahrung war definitiv eine große Motivation, sich an die Regeln zu halten. Auf jeden Fall deutlich motivierender als die Ermahnungen diverser Beamter, die ganz tief in ihren Farbkasten der 100 verschiedenen Schwarztöne gegriffen hatten, um mir eine möglichst triste Version meiner Zukunft auszumalen. Bei dem Gedanken an diese wundervollen Sitzungen kann ich ein sarkastisches Lächeln nicht unterdrücken.
Aber das ist lange her und jetzt habe ich zumindest die Möglichkeit, es mir an kalten Winternachmittagen in meiner Wohnung gemütlich zu machen und einen Tee zu trinken, der mir nicht entgegen schreit: „Trink mich! Ich bin ein verwunschenes Stück Kuchen!“.
Mein Blick streift über das Klavier. Ein seltener Luxus, den ich mir hart erkämpft habe. Natürlich unter der Voraussetzung, dass ich mich strengstens an die geltenden Vorschriften zum Besitz eines Musikinstrumentes halte. Aber vielleicht könnte ich ja nur ganz kurz und ganz leise... Meine Nachbarn würden mich sicher nicht verraten und eine Kontrolle um diese Zeit ist äußerst unwahrscheinlich.
Ich fasse mir also ein Herz, stelle meinen Tee ab und setze mich auf den alten Klavierhocker, bei dessen Anblick mich jedes Mal ein schlechtes Gewissen überkommt, weil ich den abgewetzten roten Samtbezug immer noch nicht habe erneuern lassen. Meine Finger finden die Tasten wie von selbst und ich lasse mich von ihnen mitreißen und fliehe in meine eigene kleine Welt aus Melodie. „...I say love, it is a flower...“
Ich breche abrupt ab, als jemand wütend gegen meine Wohnungstür hämmert. Starr vor Schreck sitze ich da und sehe zur Tür, die unter den Schlägen erzittert. „Öffnen Sie die Tür! Auf der Stelle!“, meldet sich nun auch eine befehlsgewohnte Stimme dazu.
Mit schlotternden Knien stehe ich auf und schaffe es irgendwie aufrecht zur Tür zu gelangen und meine zitternden Hände dazu zu bewegen, diese zu öffnen.
Vor mir türmt sich ein uniformierter Berg von einem Mann auf und schaut von oben auf mich herab, als wollte er mich unter seinen Armeestiefeln zerquetschen. „Habe ich hier gerade Musik gehört?“, fragt er. Wohl eher eine rhetorische Frage, die ich sicherheitshalber ignoriere. Ich weiß, hierauf gibt es keine Antwort, die mir irgendwie helfen würde, heil aus dieser Situation herauszukommen.
Er mustert mich kurz und nimmt mein Schweigen als ausreichende Bestätigung zur Kenntnis. „Würden Sie bitte mit uns kommen?“, fordert er mich auf. Die weiteren Beamten, verschwinden beinahe vollständig hinter seinen breiten Schultern und waren mir bis dahin gar nicht aufgefallen. Warum tauchen hier vier von denen auf einmal auf?, schießt es mir durch den Kopf. Das kann keine normale Kontrolle sein.
Mein Blick fällt auf den Brief, den ich am Morgen wieder unbeantwortet und mit einem verächtlichen Schnauben auf dem Küchentisch zurückgelassen habe und das Blut in meinen Adern ist kurzzeitig unentschlossen, ob es lieber vor Schreck gefrieren oder vor Wut kochen sollte.
„Hören Sie mir überhaupt zu? Sie sollen mitkommen! Jetzt!“, bricht es aus meinem cholerischen Gegenüber heraus und er packt mich grob am Arm.
In dem Moment springt ein wütendes Fellknäuel vom Kühlschrank direkt in sein rot angelaufenes Boxer-Gesicht und beschert ihm ein paar hübsche Furchen unter dem rechten Auge, das ohnehin schon von einer unansehnlichen Narbe geziert wird. Er zuckt nicht mal mit der Wimper, packt meine arme Katze Audrey noch im Flug am Nacken und reicht sie einem seiner Kollegen. „Wegbringen“, sagt er nur.
Meine Schockstarre löst sich in Luft auf und ich schreie verzweifelt: „Nein! Ich bin im Programm! Ich darf eine Katze haben!“.
Das T-I-E-R-Programm ist, wie ich mit widerwilliger Anerkennung zugeben muss, einer der clevereren Schachzüge der Regierung. Offiziell gilt es als ein Instrument zur Unterstützung und Belohnung der braven Bürger, die sich aus den unteren Leveln herauf gearbeitet haben. Es soll sie belohnen und in ihrem tatkräftigen Interesse und Engagement zur Re-Integration unterstützen.
Es gibt sicher einige Leute - vor allem in den oberen Leveln -, die sich von dieser geschickten Marketingstrategie überzeugen lassen und das Ganze als die vorbildlich altruistische Institution betrachten, als die es ihnen verkauft wird. Es wurde aber auch ganz klar kommuniziert, dass ein Tier dem jeweiligen Versorger jederzeit, ohne Angabe von Gründen wieder abgenommen oder ausgetauscht werden kann. Angeblich dient dies zur Reduzierung des Abhängigkeits-Potenzials.
Jeder mit einem Fünkchen Verstand und minimaler Geschichtskenntnis hat aber wohl sofort begriffen, dass es sich dabei eher um ein äußerst praktisches und eigennütziges Mittel handelt, die benannte Zielgruppe besser unter Kontrolle halten zu können und gleichzeitig ein paar störende Streuner von den Straßen zu holen. Zwei Fliegen mit einer Klappe sozusagen.
Im vollen Bewusstsein dessen habe ich trotzdem mehrere Male erfolglos versucht, in das Programm aufgenommen zu werden. Ich fand den Gedanken toll, jemanden zu haben, der mir jeden Tag Gesellschaft leistet. Und ich mag Katzen wirklich sehr. Deshalb war es mir das Risiko wert, dass man meine Bindung zu dem Tier gegebenenfalls gegen mich einsetzen könnte. Was sollte die Regierung denn auch schon groß von mir wollen, was so ein Druckmittel rechtfertigen würde?
Außerdem war ich mir ziemlich sicher, zu einer engeren emotionalen Beziehung gar nicht fähig zu sein. Dennoch war ich über die wiederholten Absagen überraschend traurig. Umso größer dann meine Freude als ich vor drei Monaten ganz ohne weitere Bewerbung endlich in das Programm aufgenommen wurde.
Man teilte mir eine langbeinige, schwarze Schönheit mit verspielten weißen Highlights auf Nase, Hals und Pfoten zu. Uns verband sofort eine Art blindes Verständnis. Die meiste Zeit lassen wir uns einfach in Ruhe, aber wir spüren auch immer instinktiv, wenn der andere gerade ein paar Streicheleinheiten braucht.
Dass sie sich nun derart selbstlos für mich einsetzt, obwohl wir uns sozusagen noch in der Kennenlernphase befinden, rechne ich ihr hoch an.
Den Beamten scheint das deutlich weniger zu beeindrucken und er wendet sich völlig ungerührt wieder an mich: „Es kann also doch sprechen.“
Der Mundwinkel unter dem langen roten Kratzer verzieht sich zu einem gehässigen Lächeln. „Mitkommen jetzt!“, fordert er noch einmal und zerrt mich dabei schon aus der Wohnung.
Ich ziehe alle Register: ich bitte, ich flehe, ich schreie. Wie eine Furie zerre ich an der Hand, die meinen Arm eisern umklammert und trete wie wild um mich, bis schließlich ein zweiter Beamter hinzukommt und sie mich an Armen und Beinen aus dem Gebäude schleppen.
Ansonsten herrscht auf den Gängen totenstille. Keiner meiner Nachbarn - alle Level 3 natürlich - würde seinen Status auf’s Spiel setzen, um irgendeiner Wildfremden zu helfen, die ab und zu mal für ein bisschen musikalische Unterhaltung sorgt. Ich kann es ihnen nicht mal verübeln.
Draußen werden ich und meine mittlerweile nicht mehr ganz so mutige Katze in den hinteren Teil eines Kleinbusses verladen, der mit quietschenden Reifen davon brettert. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wohin ich gebracht werde oder was mich erwartet.
Nur eins weiß ich sicher: das Ganze hat bestimmt nichts mit meinem Klavierspiel oder meiner Katze zu tun. Das hier ist ernst, richtig ernst und ich glaube nicht, dass ich es dieses Mal schaffe, heil hier raus zu kommen.
Nach einer gefühlten Ewigkeit wird die holprige Fahrt durch eine leicht übermütige Misshandlung des Bremspedals gestoppt.
Die Schiebetür des Vans wird geräuschvoll aufgerissen und ich rechne wieder damit in das grimmige Gesicht des mir bereits gut bekannten Teilzeit-Ogers zu blicken. Stattdessen steht da nun ein schlaksiges Milchgesicht und versucht sichtlich angestrengt all seine Gliedmaßen unter Kontrolle zu halten und eine möglichst genaue Kopie seinen Oger-Vorbilds abzugeben.
Spätestens seine brüchige Stimme macht seinen beherzten Versuch jedoch zu Nichte: „Aus-s-s-s-steigen.“ Was wohl ein Befehl werden sollte, geht in seinem unsicheren Genuschel beinah völlig unter. Ich folge mehr aus Mitleid als aus Respekt und schwinge meine steifen Beine samt der sich daran festklammernden Katze aus dem Wagen.
Draußen dämmert es bereits, aber der Platz vor mir ist taghell und ich kneife instinktiv die Augen zu. „Mitkommen“, nuschelt das zarte Stimmchen neben mir. Ich öffne die Augen und, da sein deutlich autoritärerer Kollege weit und breit nicht in Sicht ist, nehme ich mir noch einen kurzen Moment, um mir genauer anzuschauen, wohin man mich so unsanft verfrachtet hat.
Wir stehen auf dem imposanten Vorplatz eines hochmodernen in strahlendem Weiß gehaltenen Gebäudekomplexes. Die ganze Szenerie wird von eben so strahlend weißen scheinwerferähnlichen Lampen erhellt, die rund um das Gebäude angebracht sind. Hier kommt sicher niemand unbemerkt herein...oder heraus, denke ich und wie zur Bestätigung fallen mir nun auch die diversen Kameras auf, die wie kleine Deko-Elemente ringsherum angebracht sind.
Ich merke, wie mein unbeholfener Begleiter langsam nervös wird, da ich mich immer noch nicht vom Fleck bewegt habe. Mit besänftigender Unschuldsmiene setze ich mich in Bewegung, meine vor Panik nahezu katatonische Katze fest an die Brust gedrückt. Das Gefühl, sie beschützen zu müssen gepaart mit dem offensichtlich mangelhaften Durchsetzungsvermögen meines Aufpassers nimmt mir einen großen Teil der Angst, die mich seit der rüden Unterbrechung meines Klavierspiels begleitet hat.
Erhobenen Hauptes trete ich neben Milchgesicht durch die lautlos aufgleitenden Schiebetüren in das eindrucksvolle Foyer.
Mein erster Blick fällt auf einen großen Brunnen am anderen Ende der hellerleuchteten Halle. Alles ist in Grau- und Weißtönen gehalten und wirkt sehr modern, aber auch sehr steril. Der Empfang zu unserer Rechten sieht aus wie ein riesiger Betonklotz, der beim Bau einfach hier vergessen wurde. Die auf Hochglanz polierte Glasplatte darauf wertet ihn zwar auf, kann diesen Eindruck aber nicht ganz nehmen.
Genauso wenig wie die adrett gekleidete junge Dame mit ordentlichem, kastanienbraunem Bubikopf, die dahinter Stellung bezogen hat und uns nun mit einem strahlenden Lächeln und den gut einstudierten Worten: "Guten Tag, willkommen im Repro-Zentrum. Wie kann ich Ihnen helfen?" begrüßt.
Es ist ihr sicher nicht bewusst, aber mit diesem herzlichen Willkommensgruß hat sie meine schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Mein Magen zieht sich zusammen und schon ist sie wieder zurück: die Angst. Meinem Begleiter scheint meine Reaktion komplett zu entgehen und er schreitet entschlossenen Schrittes weiter auf den Tresen zu und antwortet nervös: "I-i-i-ich habe hier eine Besucherin für Frau Doktor. Sie e-e-e-erwartet sie sicher bereits."
"In Ordnung, ich gebe ihr Bescheid. Sie können die Dame schon einmal in den Besucherraum bringen. Sie kennen ja den Weg.", antwortet die Empfangsdame ungerührt.
Vielleicht bilde ich es mir nur ein, aber für einen kurzen Moment glaube ich so etwas wie Mitleid in dem Blick zu erkennen, den sie mir dabei zuwirft. Meine Hoffnungen auf ein gutes Ende sinken ins Bodenlose. Ich blicke schicksalsergeben zu Boden und folge den zur Uniform passenden, polierten Halbschuhen vor mir vorbei an der Rezeption in einen langen, ebenso sterilen Gang, der auf der rechten Seite von Türen gesäumt ist. An der linken Wand befinden sich ordentlich aufgereiht und im gleichen Abstand zueinander diverse wertvolle Gemälde und andere teure Kunstobjekte.
Ach hier verstecken sie die alle, meldet sich eine sarkastische Stimme in meinem Kopf und trotz meiner Angst merke ich, wie die Wut in Anbetracht dieses legitimierten Museumsraubes in mir hochkocht.
An der fünften Türe bleiben die schlaksigen Beine vor mir stehen. Mein Begleiter zückt eine Karte, die mit einer Art Gummiband an seiner Uniformhose befestigt ist und hält diese vor ein kleines, graues Viereck neben der Tür, welches ich bis dahin für einen Lichtschalter gehalten hatte. Die Tür springt auf und er bedeutet mir mit einer kurzen Handbewegung einzutreten.
Ich zögere widerwillig und seine Hand zuckt in Richtung des Tasers, der direkt neben dem Gummiband in einem schwarzen Lederholster hängt. Eine interessante Kombination aus Hightech und Wildwest-Charme, der ich aufgrund der angedeuteten Bedrohung aber leider keine weitere Aufmerksamkeit schenken kann. Eingeschüchtert stolpere ich in den Raum und höre noch wie Milchgesicht erleichtert ausatmet, bevor er die Tür ohne ein weiteres Wort mit einem leisen Klicken hinter mir schließt.
Die triste, graue Kammer wird von einem Edelstahltisch mit passenden Stühlen beherrscht. Ansonsten herrscht gähnende Leere. Keine Fenster. Nur eine gleißend helle Deckenlampe, die dem Ganzen ein freundliches OP-Flair gibt.
Mit dem Mut der Verzweiflung drehe mich auf dem Absatz um und hebe die Hand dorthin, wo ich einen Türgriff vermutet hätte, aber auch auf diesen hat man wohl im Sinne des puristischen Stils verzichtet.
In Ermangelung weiterer Möglichkeiten lasse ich mich mutlos auf den Stuhl auf der anderen Seite des Tisches fallen. Von hier aus habe ich die Tür im Blick, was mir zumindest ein gewisses Gefühl der Kontrolle zurückgibt.
Während ich angespannt darauf warte, dass sich diese wieder öffnet, streichele ich unbewusst über das glatte, schwarze Fell meiner zitternden Katze. Ich weiß nicht genau, wen ich damit beruhigen will, sie oder mich selbst.
Nachdem ich die grifflose Tür vor mir gute 10 Minuten lang feindselig angestarrt habe, höre ich eilige Schritte auf dem Gang, die auf Höhe des mir zugewiesenen „Besucherraums“ - ein recht gewagter Euphemismus angesichts der kleinen Folterkammer, in die ich gesteckt wurde - verklingen.
Mit dem ihr eigenen dezenten Klicken springt die Türe auf und gibt den Blick auf die wohl bekannteste und zugleich umstrittenste Persönlichkeit unserer Zeit frei.
Frau Dr. Elsa Dorsch ist sozusagen der Inbegriff der neuen Weltordnung. Psychologin, Verhaltensforscherin, Suchtexpertin und alles, was die Regierung sonst noch zu Rate ziehen könnte, um die geltenden Vorschriften durchzusetzen und stetig um immer innovativere „Maßnahmen zum Schutze der Bevölkerung“ zu erweitern. Wenn man die Kausalkette so weit führen möchte, ist sie auch der Grund dafür, dass ich seit einer geschlagenen Woche versuche, ein gewisses Interesse für Zeitreisen aufzubringen, um dem letzten Buch aus meiner monatlichen Lektüre-Lieferung zumindest einen gewissen Unterhaltungsaspekt abzugewinnen. Trotz meines familiären Hintergrundes bin ich zugegebenermaßen nämlich leider nur mit einem rudimentären Verständnis jeglicher Art von Wissenschaft gesegnet.
Bisher kenne ich Frau Doktor Dorsch nur aus den Nachrichten und einigen Auftritten in hitzigen Diskussionsrunden. Hier war sie immer im Hosenanzug oder Kostüm zu sehen. Wie sie jetzt so in der Tür steht mit ihren perfekt frisierten, grauen Haaren, der kleinen silbernen Brille auf der Nase, ganz leger in Jeans und schwarzem Kaschmirpullover könnte sie als völlig normale, wohlbetuchte Dame mittleren Alters durchgehen. „Entschuldigen Sie bitte, dass Sie warten mussten. Das ist sonst eigentlich nicht meine Art, aber hier ist heute einfach die Hölle los!“, begrüßt sie mich mit einem theatralischen Seufzer.
„Hat man Ihnen denn gar nichts zu Trinken angeboten? Hier ist auch wirklich auf niemanden Verlass!“
Ich bin so verdutzt über die unerwartete Höflichkeit, dass ich sie nur verständnislos anstarre.
„Ach, wo habe ich nur meine Manieren?“, fährt sie daraufhin beinahe übergangslos fort. „Dr. Elsa Dorsch, sehr erfreut!“
Sie macht zwei Schritte auf mich zu und streckt mir ihre Hand entgegen. Intuitiv reiche ich ihr meine, denn ich bin ja gut erzogen, und lasse sie energisch von ihr schütteln.
„Schön, dass Sie es einrichten konnten. Wollen wir nicht nach oben in mein Büro gehen? Hier unten ist es so ungemütlich.“
Offensichtlich eine rhetorische Frage. Ohne meine Antwort abzuwarten geht sie entschlossenen Schrittes zurück zur Tür. Da mir gerade jeder Ort verlockender erscheint als der kleine graue Kasten, in dem ich mich bisher aufhalten durfte, stehe ich auf und versuche mit ihr Schritt zu halten während sie über den Gang hastet.
Ich bin schon ein wenig aus der Puste als sie ganz am hinteren Ende vor einem kleinen Aufzug anhält, der sich in einer Nische hinter einer riesigen, kunstvoll bemalten Vase verbirgt. Sie hält ihre Karte vor den kleinen grauen Kasten links an der Wand daneben und die Türen gleiten auf.
„Nach Ihnen“, sagt sie mit einer einladenden Handbewegung.
Die kurze Fahrt in den 4. Stock verbringen wir schweigend, eingehüllt in die berieselnden Klänge dezenter Fahrstuhlmusik. Oben angekommen öffnen sich die Fahrstuhltüren derart lautlos, dass ich es zunächst gar nicht bewusst wahrnehme. Frau Doktor Dorsch steigt aus und schaut mit einem erwartungsvollen Blick über die Schulter, als ich nicht umgehend folge.
Kurz denke ich über einen Fluchtversuch nach, aber dieser Gedankengang wird bei dem Blick auf die in ordentlichen Abständen postierten, uniformierten Herren, die den Gang säumen, im Keim erstickt. Ich ergebe mich also wieder in mein Schicksal, ignoriere das beklemmende Gefühl, nicht atmen zu können und folge den eifrig klackernden Pumps meiner Gastgeberin.
Während wir den hotelähnlichen Flur entlang rennen, grüßt sie jeden der Wächter mit einem freundlichen „Hallo“ und einem kurzen Nicken und erhält dafür einen ebenso freundlichen Gruß zurück.
Diese selbstverständliche Freundlichkeit kann die Beklemmung, die mich in Anbetracht meiner ausweglosen Situation übermannt leider keinesfalls mindern. Vielmehr empfinde ich es als umso erschreckender, dass diese für alle anderen Beteiligten zum ganz normalen Arbeitsalltag dazu zu gehören scheint.
Am Ende des Flures bleibt „Frau Doktor“ vor einer großen Flügeltür stehen und öffnet auch diese mit ihrer Schlüsselkarte.
Beim Eintreten überkommt mich sofort ein befremdliches, unpassendes Gefühl der Entspannung. Der Eingangsbereich und das dahinter liegende großzügig geschnittene Zimmer erinnern eher an ein Spa als an ein Büro. Überall liegen dicke, weiße Teppiche, ein steinerner Zimmerbrunnen plätschert gemütlich vor sich hin und alles ist in angenehm warmes Licht getaucht. Der Ausblick aus den bodentiefen Fenstern ist atemberaubend und es duftet ganz leicht nach einer Mischung aus Sandelholz und Vanille.
„Setzen Sie sich doch!“, sie deutet auf eine einladende Sitzgruppe aus weißen Polstermöbeln, die sich um einen kleinen, antiken Holztisch scharen.
Geschafft von den Ereignissen des Tages lasse ich mich in einen der Sessel fallen. Die Situation ist so surreal, dass ich ein hysterisches Kichern unterdrücken muss als meine Gastgeberin mir gegenüber auf der Kante des Sofas Platz nimmt.
Sie legt eine Art Mini-Pager neben eine kleine, silberne Glocke, die auf dem Tischchen in der Mitte steht, nimmt diese zur Hand und lässt sie sanft klingen. Sofort öffnet sich geräuschlos eine schmale Tür, am anderen Ende des Zimmers, die so geschickt in die Wand eingelassen ist, dass sie mir in geschlossenem Zustand nie aufgefallen wäre.
Eine kleine, junge Frau asiatischer Herkunft kommt ganz leise wie auf Zehenspitzen an den Tisch getrippelt. Sie trägt ein zum Tischchen passendes kleines Tablett mit zwei Tassen, einer dampfenden Kanne Tee und einem kleinen Schälchen mit Keksen. Wortlos stellt sie das Tablett auf dem Tisch ab, macht einen kleinen Knicks und entfernt sich genauso leise wieder wie sie gekommen ist.
„Tee?“, fragt meine Gastgeberin, schenkt mir eine Tasse ein und stellt sie vor mich hin. Offensichtlich wurde auch hier keine Antwort von mir erwartet. Sie nimmt sich ebenfalls eine Tasse, umschließt sie mit ihren langen Fingern und setzt sich wieder zurück auf die Sofakante.
„Nun dann.“, sie richtet sich kerzengerade auf und schaut mir geradewegs in die Augen.
„Sie können sich sicher vorstellen, wie enttäuscht wir waren, Ihre Absage auf unsere Einladung zu unserem neuen Repro-Programm zu erhalten.
Ich persönlich hatte mich sehr darauf gefreut, Sie in selbigem willkommen heißen zu dürfen.
Ich verstehe vollkommen, dass unser Vorhaben zunächst etwas abschreckend und befremdlich wirken muss. Aber gerade bei Ihnen war ich ganz sicher, dass Sie die Notwendigkeit dieser Maßnahme, dieser Studie, verstehen und bereitwillig zu ihrem Erfolg beitragen würden.
Vielleicht möchten Sie es sich ja in Anbetracht ihrer aktuellen, misslichen Lage noch einmal überlegen?“. Auch dies scheint keine wirkliche Frage zu sein, denn sie fährt ohne Unterbrechung fort:
„So wie ich das sehe, führen Sie momentan ja ein recht beschauliches und angenehmes Leben. Sie dürfen eine Katze versorgen - übrigens ein wirklich schönes Tier, wenn ich das sagen darf. Sie halten sich seit längerer Zeit auf Level 3, wodurch Ihnen einige Möglichkeiten zur freien Entscheidung eingeräumt werden. Sie haben sogar ein Klavier! Na gut, das ist Ihnen nun wohl zum Verhängnis geworden, aber abgesehen von dem bedauerlichen Vorfall vor zwei Jahren machen Sie sich, so weit ich das mitverfolgen konnte, wirklich sehr gut.“
Und da ist er wieder, der geflügelte Begriff des „bedauerlichen Vorfalls“, der scheinbar ein fester Bestandteil der Regierungssprache im Zusammenhang mit unerwünschtem Verhalten geworden ist. Hätte sie eine andere Umschreibung gewählt oder diesen Teil einfach ganz ausgespart, hätte ich mich sicher weiter von ihrer ruhigen Stimme, dem warmen Tee und dem leichten Vanille- Duft einlullen lassen.
Aber beim Klang dieser zwei Worte schrillen sofort sämtliche Alarmglocken in meinem Kopf und mein Körper nimmt intuitiv eine Abwehrhaltung ein. Kritisch mustere ich mein Gegenüber und erkenne, dass ihre wohleinstudierte Körperhaltung und das freundliche Lächeln durch ihre kalten, berechnenden Augen, die mich ununterbrochen taxieren, Lügen gestraft werden.
So ist es auch kein Wunder, dass ihr meine körperliche Reaktion auf ihren kleinen Vortrag nicht entgeht. „Meine Liebe,“, setzt sie mit samtweicher Stimme wieder an und legt ihre Hand beruhigend auf meine Finger, die ich flach auf die Tischplatte drücke, um meiner Wut ein Ventil zu bieten.
„Ich möchte Sie wirklich nicht vor die Wahl stellen müssen. Es wäre doch zu schade, wenn wir Sie aufgrund dieser kleinen Verfehlung aus dem T-I-E-R-Programm nehmen müssten.
Wer weiß, wo Ihre arme Katze dann hinkäme. Es gibt ja wirklich schlechte Menschen da draußen.“
Trotz der warmen Worte ist die Drohung darin wohl das Ehrlichste, was ich bisher von der guten Frau Doktor gehört habe.
„Sie werden doch sicher vernünftig sein und uns bei dieser wichtigen Sache unterstützen, oder?“
Meine Gedanken schweifen wieder zu dem Brief, der seit drei Tagen anklagend auf meinem Küchentisch liegt:
„Sehr geehrte Bürgerin, sehr geehrter Bürger,
mit Bedauern haben wir Ihre Absage zur Kenntnis genommen, mit welcher Sie die einmalige Chance auf eine Teilnahme an unserer Repro-Studie ausgeschlagen haben. Wir sind uns beinahe sicher, dass Ihnen der massive Nutzen unserer Forschung nicht vollumfänglich bewusst ist. Daher möchten wir Sie bitten, innerhalb der nächsten 48 Stunden bei uns vorstellig zu werden, sodass wir Ihnen die Wichtigkeit unseres Unternehmens persönlich näher bringen können.
Mit den besten Grüßen,
Doktor Elsa Dorsch und Team“
Ich hatte - höflich ausgedrückt - davon abgesehen, vorstellig zu werden oder in anderer Form auf diese Farce zu reagieren.
Wie gesagt, bin ich generell eher nicht der Typ Mensch, der sich besonders stark für Wissenschaft, Forschung oder irgendwelche Studien begeistern kann. Aber selbst, wenn dem so wäre, käme eine Teilnahme am neuesten Regierungsprojekt, dem sogenannten Reproduktions- oder kurz Repro-Programm, für mich niemals in Frage.
Ziel des Programmes ist es, die Anzahl der emotionalen Bindungen, die ein Bürger Zeit seines Lebens eingehen könnte, noch weiter zu minimieren und diese im Bestfall komplett auszumerzen. Einen kleinen, aber bedeutenden Teil der zwischenmenschlichen Interaktion kontrolliert der Staat aktuell nämlich noch nicht: die Fortpflanzung verläuft noch auf dem natürlichen Wege. Auch das Großziehen der Früchte dieser ursprünglichsten aller Interaktionen liegt aktuell wie gehabt in den Händen der Eltern. Das birgt natürlich ein hohes Potenzial für emotionale Bindungen mit einer Vielzahl möglicher Bezugspersonen: dem jeweiligen Partner, den Eltern, den Kindern und gegebenenfalls sogar noch Geschwistern. Und das Ganze geht dann auch noch wild den Stammbaum hoch und runter.
Ich fand die Vorstellung, feste Wurzeln zu haben, immer sehr beruhigend und irgendwie erdend. Der Regierung ist diese ganze Verästelung aber schon lange ein Dorn im Auge und mit dem Repro-Programm erhofft sie sich, diesen nun endlich zu ziehen.
Zunächst soll es sich hierbei nur um eine Art Studie handeln, die bei Erfolg dann nach und nach auf das Leben aller Bürgerinnen und Bürger übertragen werden soll, bis der aktuelle Prozess nicht mehr vonnöten ist.
Als ersten Schritt bittet die Regierung daher nun einige in Frage kommende „Probanden“ im Alter von 20 bis 30 Jahren sich je nach Geschlecht entweder zu einer Samenspende oder zu einer 10-monatigen Vermietung des eigenen Uterus bereit zu erklären.
Um die Kinder, die im Rahmen des Programms „gezüchtet“ werden, muss man sich hinterher selbstverständlich nicht kümmern.
Außerdem erhält man eine kleine Vergütung für seine Mühen und den teilnehmenden Frauen wird eine umfassende medizinische Versorgung durch absolutes Top-Personal versprochen.
Argumente, die mich, gelinde gesagt, nicht vollends überzeugen konnten.
Die unpersönliche Anrede zu Beginn des Schreibens, ließ darauf schließen, dass ich nicht die einzige glückliche Empfängerin eines solchen war und ich fühlte mich daher zumindest in guter Gesellschaft als ich dem stummen Stück Papier meinen Mittelfinger entgegen schleuderte.
Mir war schon irgendwie klar, dass die Sache damit wohl nicht vom Tisch war, ich hatte die Entschlossenheit des werten Forschungsteams aber ganz offensichtlich bei Weitem unterschätzt.
Ein dummer, naiver Fehler, der mir sicher nie wieder unterlaufen wird. Diese späte Erkenntnis konnte mich nur leider nicht aus meiner aktuellen Lage retten.
Hier war diplomatisches Geschick gefragt. Nicht gerade meine Stärke, aber ich musste es zumindest versuchen:
„Sehen Sie, Frau Doktor Dorsch,“, ich hatte mal irgendwo gelesen, dass es half, die Wortwahl des Gesprächspartners zu kopieren, um den Eindruck eines gewissen Grundkonsens zu erwecken.
„Tatsächlich habe ich einige Fragen zu Ihrem Forschungsprojekt, die ich gerne mit Ihnen erörtern würde, wenn es Ihnen recht ist.“
Die Wissenschaftlerehre war immer der größte Schwachpunkt meiner Mutter gewesen. Damit konnte ich sie auch im schlimmsten Streit immer ködern.
Zu meinem Glück ist mein Gegenüber zumindest in dieser Hinsicht ähnlich gestrickt.
Der starr auf mich gerichtete Blick hellt sich auf und das sonst so kontrollierte Sprachrohr der Regierung gleicht plötzlich eher einer aufgeregten Einser-Studentin, die ihren Lieblingsprofessor von der bahnbrechenden Tragweite ihrer letzten Erkenntnisse überzeugen möchte.
„Sehr gerne. Dann schießen Sie mal los.“
Der kleine, schwarze Pager auf dem Tisch zwischen uns gibt ein beharrliches Brummen von sich und stoppt meine verzweifelte Suche nach einer passenden, nicht beleidigenden Frage zum neuesten Hirngespinst der Regierung.
Mit einem genervten Kopfschütteln greift Dr. Dorsch danach, wirft einen Blick auf das Display und springt urplötzlich auf. Dann scheint ihr wieder einzufallen, dass sie nicht alleine ist und wie um ihren plötzlichen Gefühlsausbruch zu relativieren streicht sie gelassen ein paar unsichtbare Krümel von ihrem teuren Pullover. „Entschuldigen Sie bitte“, sagt sie gefasst. „Es gibt eine dringende Angelegenheit, derer ich mich offensichtlich selbst annehmen muss.“
Sie wendet sich ab und geht mit großen Schritten in Richtung Eingangsbereich. Auf halber Strecke dreht sie sich noch einmal kurz um:
„Ich schicke jemanden, der Sie in Ihr Zimmer begleitet. Morgen nach dem Frühstück werde ich mir die Zeit nehmen, all Ihre Fragen in Ruhe zu beantworten.“
Damit klackert sie energisch weiter zur Tür und, bevor ich meine Stimme wiedergefunden habe, fällt diese klickend ins Schloss.
Ich sitze da und starre ihr mit offenem Mund hinterher. Mein Zimmer? Mir war nicht bewusst, dass ich bereits in dieser all meine Albträume übertreffenden Version meiner Zukunft eingecheckt hatte. Panisch schieße ich samt Katze aus dem weißen Designermöbel hoch und suche den Raum verzweifelt nach einer Fluchtmöglichkeit ab.
Da springt plötzlich die kleine Tür in der Wand wieder auf. Ich erwarte die zierliche Asiatin, die pflichtbewusst den kaum angerührten Tee abräumen möchte.
Stattdessen steht dort ein großer Mann mit wirren, blonden Locken und stahlblauen Augen, die mich entschlossen anblicken.