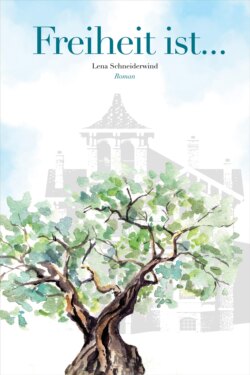Читать книгу Freiheit ist... - Lena Schneiderwind - Страница 6
Kapitel 3
ОглавлениеDieser unerwartete Auftritt löst nun auch die Schockstarre meiner verängstigten Katze, die mit einem Satz von meinem Arm springt und leise fauchend unter dem Sofa in Deckung geht.
„Schönen guten Abend, die Dame, darf ich um diesen Tanz bitten“, fordert mich der Fremde formvollendet auf und streckt mir einladend seine Hand entgegen.
Nach den Ereignissen des heutigen Tages ist mir gar nicht danach, die wiederholten Warnungen meiner Mutter vor fremden Männern außer Acht zu lassen und seiner Bitte zu folgen.
„Ich verspreche, ich werde mich ganz vorbildlich benehmen und, ehrlich gesagt, schlimmer kann es doch eh nicht werden, oder?“, fragt er und zieht spöttisch seine linke Augenbraue nach oben.
Ich weiß nicht, ob es an dem ungewöhnlich offenen Blick liegt, mit dem er mich ansieht oder an seiner lockeren Art, aber irgendetwas sagt mir, dass ich ihm vertrauen kann. Außerdem hat er wahrscheinlich recht: Viel schlimmer kann es wohl tatsächlich nicht mehr kommen. Und so lege ich kurzentschlossen meine Hand in seine, die immer noch ausgestreckt auf mich wartet. Er nickt mir kurz bestätigend zu, dreht uns beide elegant zur Türe und zieht mich hinter sich her durch den kleinen, dunklen Korridor, der sich dahinter verbirgt.
Etwa auf halber Höhe befindet sich eine weitere schmale Tür. Kurz bevor wir daran vorbeilaufen, schwingt sie nach innen auf und im Türrahmen erscheint die kleine Asiatin. Ich zucke zurück, aber der Mann läuft geradewegs auf sie zu und zieht mich mit sich. Er lässt meine Hand los, bleibt direkt vor ihr stehen und sieht sie ernst an.
„Bereit?“, fragt er und greift in die Tasche seiner abgenutzten, schwarzen Lederjacke. Als seine Hand wieder zum Vorschein kommt, liegt darin eine kleine, silberne Pistole, wie man sie wohl für einen gemütlichen russisch Roulette-Abend verwenden würde. Ich schaue entsetzt vom einen zum anderen, aber beide wirken völlig ruhig und abgeklärt.
Die kleine Frau sieht fest in die Augen des Lockenkopfes neben mir und nickt entschlossen. Eine Strähne ihrer tiefschwarzen Haare löst sich aus dem ordentlichen Dutt und fällt ihr ins das perfekte Marmorgesicht. Mein Begleiter macht einen Schritt zurück. Sie bleibt ganz ruhig stehen und sieht weiter in seine Augen. Er hebt den Arm und zielt.
Ich öffne den Mund, um zu protestieren, aber da löst sich schon der Schuss und die junge Frau wird gegen die Wand geworfen. Sie stößt einen kurzen, spitzen Schrei aus und umklammert mit schmerzverzehrtem Gesicht ihren rechten Arm.
Der Fremde lässt sofort die Waffe fallen und stürzt zu ihr. „Es tut mir so leid! Tut es sehr weh? Es tut mir so leid!“, bricht es aus ihm heraus.
Sie hält ihn mit dem unverletzten Arm auf Abstand und sagt gepresst: „Ist schon in Ordnung. Wir hatten das besprochen. Es gab keine andere Möglichkeit. Ihr dürft jetzt keine Zeit verlieren. Los, sie sind bestimmt schon auf dem Weg!“ Mit offensichtlichem Widerwillen löst er sich von ihr und greift wieder nach meiner Hand, um mich weiter den Gang entlang zu ziehen.
Ich blicke noch einmal zurück, doch die junge Frau nickt mir bestätigend zu und scheucht mich mit einer kleinen Bewegung ihrer linken Hand weiter, bevor sie diese wieder auf die Wunde an ihrem Arm presst. Die einzige weitere Tür befindet sich einige Meter weiter am Ende des Ganges. Kurz bevor wir sie erreichen bleibe ich so plötzlich stehen, dass ich den Mann mitten im Lauf unsanft zurück reiße.
„Audrey Hepburn!“, rufe ich entsetzt. Er sieht mir tief in die Augen und nimmt mein Gesicht in seine Hände. „Haben die dir irgendwas gegeben? Eine Spritze, Tabletten oder irgendwas anderes?“, fragt er mit besorgtem Gesichtsausdruck.
„Meine Katze ist noch da drin!“, erkläre ich und zeige panisch auf die Tür am anderen Ende des Ganges. Er sieht mich kurz verständnislos an und schlägt sich dann die Hand vor die Stirn. „Die Katze!“. Er sagt es so als hätte er etwas Wichtiges vergessen und nicht ich. „Du wartest hier!“
Und schon spurtet er den Gang entlang, zurück in die Höhle des Löwen. Als er an der verletzten, jungen Frau vorbeikommt, die sich wieder in den Türrahmen zurückgezogen hat, sehe ich das erste Mal Angst in ihren Augen. Ich werfe ihr einen entschuldigen Blick zu und als sich die geheime Tür zum Büro hinter ihm schließt, sende ich ein kurzes Stoßgebot zum Himmel. Eigentlich nicht meine Art, aber schaden kann es sicher nicht.
Es vergehen einige Sekunden, in denen wir wie angewurzelt auf dem Gang stehen und hoffnungsvoll die Türe anstarren. Gerade als ich denke, dass das schon viel zu lange dauert und losrennen will, um ihm zu helfen, schwingt die Tür auf und in ihr erscheint der furchtlose Retter mit meiner Katze auf dem Arm. Den ansehnlichen Kratzern auf seinen Händen nach zu urteilen, konnte er sie im Gegensatz zu mir wohl nicht dazu bewegen, ihm freiwillig zu folgen.
Er nimmt sich nicht die Zeit, die Türe wieder zu schließen und hechtet erneut den Gang entlang. Nur als er an der jungen Frau vorbeikommt, die ihm besorgt vom Türrahmen aus entgegensieht, hält er kurz inne und drückt ihr schnell einen Kuss auf die Stirn. Dann ist er auch schon wieder bei mir und zieht mich durch die hintere Tür in ein enges Treppenhaus.
Wir stürzen die schmalen Treppen herunter. Als wir die ersten drei Stockwerke hinter uns gelassen haben, hören wir wie sich ganz oben jemand so heftig gegen die Türe schmeißt, dass diese lautstark an die dahinterliegende Wand knallt. Dann folgen eilige Schritte mehrerer, schwerer Stiefel begleitet von gebellten Befehlen, deren genauer Wortlaut vom Rauschen des Blutes in meinen Ohren übertönt wird.
Mein Begleiter lässt sich nicht beirren und rennt nur noch schneller. Wir rasen auf die letzte Treppe zu, mein rechter Fuß verpasst knapp die erste Stufe und ich verliere das Gleichgewicht. Mit beeindruckender Reaktionsgeschwindigkeit fängt der Mann meinen Sturz ab und zieht mich weiter die letzten Stufen herunter bis zum Ende des Treppenhauses. Schlitternd kommen wir vor einer schlichten Glastüre zum Stehen, die den Weg nach draußen versperrt.
„Nein, nein, nein! Das darf doch nicht wahr sein! Wo bist du verdammt?!“, bricht es aus dem Fremden heraus und er wirft sich verzweifelt, aber leider ohne Erfolg, gegen die fest verschlossene Tür.
In diesem Moment wird mir klar, dass wir uns gerade unser eigenes Grab geschaufelt haben.
Die Schritte über uns werden immer lauter. Nur noch zwei Treppen trennen uns von unseren wütenden Verfolgern. Der Fremde postiert sich schützend zwischen mir und dem Treppenabsatz und drückt mich in die hinterste Ecke des kleinen Eingangs. Plötzlich durchdringt das Geräusch heulender Motoren und quietschender Reifen die angespannte Stille.
Über die Schulter meines Helfers hinweg kann ich draußen vor der Türe Scheinwerfer erkennen, die huschend die Dunkelheit durchbrechen. Im Stockwerk über uns geht ein Fenster klirrend zu Bruch und irgendetwas knallt so laut, dass ich befürchte einen dauerhaften Tinnitus davonzutragen. Die trampelnden Schritte verstummen und stattdessen ist nun ein bedauernswerter Chor hustender und um Luft ringender Männer zu hören.
„Aus dem Weg, Brüderchen!“, schallt es durch die Glastüre, vor der nun undeutliche Schatten auszumachen sind. Vom oberen Absatz der letzten Treppe wabern dunkle Rauchschwaden auf uns zu, ich presse mir instinktiv meine Strickjacke vor Mund und Nase und drücke meine Katze eng an meine Brust.
Der Fremde hält sich den Arm vor das Gesicht und drängt mich noch etwas weiter zurück in die Ecke. Wieder heult draußen ein Motor auf, plötzlich wird es taghell in dem kleinen Raum und den Bruchteil einer Sekunde später schießt ein schwarzes Motorrad samt ebenso schwarz gekleidetem Fahrer durch die Glasscheibe und zerschmettert diese in tausend Einzelteile.
„Ein Hoch auf den Erfinder des Sicherheitsglases!“, jubiliert der Fahrer und streicht sich demonstrativ gelassen ein paar der abgerundeten Glasstücke von den Schultern.
„Pünktlich auf die Sekunde“, knurrt mein Retter sarkastisch.
„Kann die Standpauke vielleicht warten? So wie ich das sehe haben wir es gerade etwas eilig.“ Die prompte Antwort wird durch den Motorradhelm gedämpft, aber ich glaube, eine weibliche Stimme zu erkennen. Demnach handelt es sich wohl um die Schwester des Lockenkopfes. „Ihr Chauffeur wartet draußen, meine Dame“, setzt sie an mich gewandt hinzu und schiebt das schwere Motorrad rückwärts durch das klaffende Loch im Türrahmen.
Mein Begleiter wirft ihr noch einen finsteren Blick zu, nimmt dann aber ohne ein weiteres Wort wieder meine Hand und zieht mich hinter ihr her nach draußen. Dort wartet ein zweites Motorrad samt Fahrer mit auffälligem schwarz-roten Helm.
Über dem Hinterrad seiner Maschine ist ein schwarzer Kasten befestigt. Der Fahrer dreht sich zu diesem um, klappt den Deckel hoch und fordert mich auf: „Die Katze müsste zur ihrer und unserer Sicherheit bitte hier Platz nehmen.“ Das wird ihr sicher wenig gefallen, schießt es mir durch den Kopf. Da mir der Sinn aber durchaus bewusst ist und die Zeit drängt, greife ich durch das schwarze Fell in die Nackenhaut des nun wieder zappelnden Tieres und setze sie behutsam in die Box während ich ihr erkläre, dass alles gut wird.
In der Zwischenzeit übernimmt mein Befreier den Fahrersitz der anderen Maschine, setzt ebenfalls einen schwarz-roten Helm auf und streckt mir einen schwarzen entgegen, der dem seiner Schwester gleicht. Diese schwingt elegant ein langes Bein über den Rücksitz der Maschine und nimmt geübt hinter ihm Platz.
Ich setze den Helm auf und folge ihrem Beispiel, wenn auch deutlich weniger behände.
Aus dem Inneren des Treppenhauses ist nun wieder Gepolter zu hören. Erschrocken werfe ich einen Blick über die Schulter und sehe gerade noch wie Boxer-Gesicht um die Ecke strauchelt und am oberen Absatz der letzten Treppe erscheint. Er keucht immer noch ganz schön und seine Augen sehen aus als hätte er einen schlimmen Heulkrampf gehabt. Das würde bei seiner Statur wahrscheinlich echt lustig wirken, wenn da nicht sein vor Schmerz und Wut verzerrter, unheilverheißender Gesichtsausdruck wäre. Die Mordlust glitzert in seinen Augen als sein Blick auf uns fällt und mir rutscht das Herz in die Hose.
„Festhalten!“, erklingt die Stimme meines Chauffeurs von irgendwo in meinem Helm. Offenbar ist dieser mit einem Headset ausgestattet, dass den Fahrern auch während der Fahrt eine einwandfreie Kommunikation erlaub. Ich habe gerade noch Zeit, die Arme fest um seine Taille zu schlingen, da brettern beide Maschinen wie auf ein stummes Kommando hin gleichzeitig los. Selbst durch den Helm hindurch und über das Getöse der Motoren hinweg höre ich den wütenden Schrei hinter uns.
Wir rasen um das Gebäude herum und erreichen innerhalb weniger Sekunden den vorderen Teil mit der imposanten Einfahrt, die ich bei meiner Ankunft bereits bewundern durfte. Das Licht hier ist nun etwas gedämpfter. Schön zu sehen, dass die Regierung sich zumindest in Teilen an die eigenen Regeln hält und Strom spart. Mein sarkastischer Gedankengang wird vom Knallen diverser, schwerer Türen unterbrochen. Über mein Headset meine ich auch ein leises Rauschen und abhackte Befehle zu hören. Scheinbar nutzen unsere Verfolger eine ähnliche Funkfrequenz wie wir.
Auf der Maschine neben mir dreht sich der Sozius mitten in der Fahrt mit einem beeindruckenden Kunststück auf dem Sitz um.
„Ha! Es geht ja schon los!“, dringt ihre aufgekratzte Stimme durch das Rauschen hindurch. Sie reibt sich die Hände und zückt einen kleinen schwarzen Gegenstand, dessen Nutzen mir sich erst nicht ganz erschließen will. Sie hantiert kurz daran herum und die Geräusche der fremden Funkgeräte verstummen abrupt. Dann hebt sie das rätselhafte Objekt zum Mund und sagt: „Schlafenszeit!“
In der gleichen Sekunde gehen auf dem gesamten Gelände die Lichter aus. Es ist stockdunkel. Nur die Scheinwerfer der Motorräder erhellen mit ihren schmalen Lichtkegeln circa 20 Meter der vor uns liegenden Straße. Aus der Richtung, aus der zuvor die knallenden Autotüren zu hören waren, ist jetzt ein leichter Tumult zu vernehmen.
Die Aufregung hält allerdings nur kurz an. Dann erhellen weitere Lichtpunkte die Dunkelheit hinter uns und mehrere Autos nehmen in rasantem Tempo unsere Verfolgung auf.
Ein netter, kleiner Trick also, der uns aber leider keinen besonders großen Vorsprung verschafft hat. Den beiden Fahrern unserer Fluchtfahrzeuge scheint das im selben Moment auch klar zu werden und sie geben ihren motorisierten Pferden noch einmal ordentlich die Sporen. Beide Maschinen machen einen Satz nach vorne und preschen noch schneller über den makellos geteerten Untergrund.
Hintereinander passieren wir ein großes, eisernes Schiebetor, das gerade so weit aufsteht, dass ein einzelnes Motorrad oder ein Fußgänger hindurch passt. Auch hier scheint die gesamte Elektronik lahmgelegt. Ich wage einen kurzen Blick über die Schulter und muss entsetzt feststellen, dass die rasende Autokolonne nur noch wenige Meter entfernt ist.
„Lumos!“, ertönt es vergnügt neben mir. Die Scheinwerfer, die rundherum am Tor befestigt sind, erstrahlen und bilden eine gleißende Lichtbarriere zwischen uns und den Verfolgern. Der Wagen an der Spitze schlingert gefährlich. Dann verliert der geblendete Fahrer vollends die Kontrolle über den schweren SUV, sodass dieser in das angrenzende Feld schleudert und nach circa fünf Metern unsanft vom eingrenzenden Zaun gestoppt wird. Das andauernde Dröhnen der Hupe lässt darauf schließen, dass es mindestens einen der Insassen ziemlich schwer erwischt hat.
Die drei weiteren Fahrzeuge werden ebenfalls Opfer der rasanten Schlitterpartie ihres Kollegen. Zwei landen stark lädiert im Feld und das dritte schafft es zwar auf der Straße zu bleiben, endet hier allerdings Funken sprühend auf dem Dach.
„Das nennt man natürliche Auslese, ihr Sackgesichter!“, triumphiert die Beifahrerin neben mir begeistert. Ich muss zugeben, dass uns diese Aktion nun tatsächlich einen etwas komfortableren Vorsprung verschafft hat. Doch leider scheint die Forschungseinrichtung über ein ungewöhnlich hohes Aufgebot an Sicherheitskräften zu verfügen. In der Ferne nähern sich bereits weitere Scheinwerferpaare und auch ein paar einzelne Lichtkegel, die darauf schließen lassen, dass die Flotte auch Motorräder umfasst.
Je weiter wir uns von dem eingezäunten Areal entfernen, desto schlechter wird der Zustand der Straße. Ein Schlagloch erinnert mich etwas ruppig aber wirkungsvoll daran, dass ich wohl besser nach vorne schauen und mich ordentlich festhalten sollte.
Ich denke an die arme Audrey Hepburn in der Kiste hinter mir und hoffe mehr für sie als für mich, dass dieser Höllenritt bald ein Ende hat. Soweit ich das auf die Schnelle sehen konnte ist die Box zwar sehr gut gepolstert und mit ausreichend Luftschlitzen versehen, angenehm ist es aber sicher nicht, im Dunkeln durchgerüttelt zu werden und so gar nicht zu wissen, was los ist.
Mittlerweile ist die geteerte, breite Straße einem holprigen Feldweg gewichen und bis auf ein paar vereinzelte Häuschen gibt es keine Anzeichen von Zivilisation. Auch für die schweren Motorräder ist der unebene, teilweise matschige Untergrund nicht ideal, sodass wir das Tempo deutlich drosseln müssen. Unsere Verfolger lassen sich ausgestattet mit Vierradantrieb und Motocross-Maschinen leider nicht so sehr beirren und schließen immer weiter zu uns auf. Erst als in einiger Entfernung die Lichter einer Kleinstadt erscheinen, wird der Bodenbelag wieder etwas vertrauenswürdiger und wir können den Abstand erneut vergrößern.
Genau in dem Moment, in dem wir das Ortsschild passieren, heulen in dem kleinen Städtchen die Sirenen auf. „Keiner die Nachtigall stört“, ruft meine Nachbarin dem kleinen schwarzen Gegenstand zu, den sie nun wieder vor das Visier ihres Helmes hält. Sie scheint wenig beeindruckt von der für mich absolut nervenaufreibenden Verfolgungsjagd und kichert wie ein kleines Mädchen über ihren Wortwitz. Augenblicklich verstummt das Geheule und ich male mir optimistisch aus, wie die pflichtbewussten Polizisten und Feuerwehrleute auf Abruf mitten in den hektischen Einsatzvorbereitungen innehalten, sich ratlos umschauen und dann schulterzuckend wieder zurück ins Bett gehen. Das wäre zumindest meine Idealvorstellung. Ich fürchte aber, dass der Lärm, den wir mit unserer filmreifen Flucht verursachen, jeden Gedanken an Schlaf im Keim erstickt.
Wir rasen im Zick Zack durch die Straßen. Vorbei an beschaulichen Level 1 Wohngebieten mit modernen Einfamilienhäusern, mitten durch die dazugehörige, verlassene Schaupassage mit ihren dunklen Ladenfenstern und weiter in Richtung der eintönigen Wohnblöcke für die weniger privilegierten Level 2 und 3 Bürger versuchen wir die beharrlichen Verfolger abzuschütteln.
Es folgen einige Straßenzüge voller großer, grauer Betoneinheiten mit schweren Rolltoren. Vermutlich Lagerhäuser für den boomenden Versandhandel. Beim Anblick der vorbeifliegenden grauen Wände und Tore wird mir ganz schwindlig.
Eine kurze Bewegung zu meiner Linken erweckt meine Aufmerksamkeit. Als ich den Kopf drehe, sehe ich gerade noch wie die Schwester meines Befreiers neben mir ihre kleine, schwarze Fernbedienung an die Stirn hebt und diese in einer Art militärischem Gruß mit einer knappen Handbewegung in meine Richtung kippt. Mir ist nicht ganz klar, was sie mir damit sagen will und während ich noch überlege, welche Reaktion sie wohl von mir erwartet, reißt mein Chauffeur das Lenkrad herum und wir rasen geradewegs auf die Betonmauer zu, die sich am rechten Straßenrand auftürmt.
Panisch klammere ich mich am Rücken des Fahrer fest und bohre meine Fingernägel in das weiche Leder seiner Motorradkombi. Offensichtlich bin ich in der verzweifelten Hoffnung, der lieben Frau Doktor zu entkommen, vom Regen in die Traufe geraten und werde jetzt Opfer einer Bande wahnsinniger Geschwindigkeits-Junkies, die versucht, die Gesetze der Physik zu überlisten.
Die Wand kommt näher und näher und zu spät kommt mir der Gedanke, mich durch einen Sprung vom Motorrad vor dem sicheren Aufprall zu retten. Mir bleibt nur noch Zeit, mich noch fester an meinen Vordermann zu pressen und hinter seinem Rücken in Deckung zu gehen, da trifft die Maschine schon mit voller Wucht auf den Beton und... rast einfach hindurch.
Im gleichen Moment schießt ein Motorrad, das unserem inklusive Besetzung zum Verwechseln ähnlich sieht von der anderen Seite der Mauer an uns vorbei auf die Straße.
Kein Knall, kein Rückstoß, keine splitternden Plastikteile oder berstendes Gestein. Nichts lässt darauf schließen, dass gerade zwei Motorräder mit Höchstgeschwindigkeit durch eine massive Wand gebrettert sind. Auch kein Schmerz, wie ich erleichtert feststelle.
Für den Bruchteil einer Sekunde ist die Welt um mich herum in einen eigenartigen Schleier aus Licht gehüllt und dann, als hätte jemand gelangweilt den Kanal gewechselt, befinden wir uns plötzlich in einer riesigen, leerstehenden Lagerhalle. Der Fahrer nutzt den Platz, bremst langsam ab und lässt die Maschine sanft ausrollen, bevor wir zum Stehen kommen. Dann klappt er den Ständer aus, steigt ab und hält mir seine Hand entgegen, um mir ebenfalls herunter zu helfen.
Dankbar ergreife ich sie und klettere unsicher wie ein frisch geborenes Rehkitz mit zitternden Beinen vom Rücksitz des überraschend hohen Fahrzeugs. Hinter mir höre ich eilige Schritte, die sich uns nähern, aber ich bin noch zu benommen, um mich nach der Quelle umzusehen. Mich mit der einen Hand immer noch stützend öffnet der Mann vor mir mit der anderen meinen Kinnriemen, zieht mir vorsichtig den Helm vom Kopf und reicht ihn weiter an die zweite Person, die nun direkt hinter mir steht.
Dann zieht er den eigenen Helm aus. Vor mir steht ein leicht untersetzter Mann Ende 50 mit kurzen, grau-braunen Haaren, passendem, dichten Bart und hellbraunen Augen, der mich besorgt mustert. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich nach der rasanten Fahrt einen deutlich jüngeren und wahrscheinlich auch verwegeneren Zeitgenossen erwartet hatte. Der unerwartete Eindruck wird noch verstärkt als er ein dunkelgrünes Etui aus der Hosentasche zieht und diesem eine dezente Brille mit runden Gläsern entnimmt, die er gewohnheitsmäßig aufsetzt.
„So jetzt kann ich dich auch sehen“, erklärt er. „Kein Kratzer, keine Beule. Das ist doch schon mal was. Wie fühlst du dich?“ Noch etwas mitgenommen öffne und schließe ich hilflos den Mund, scheine aber kurzzeitig vergessen zu haben, wie man damit sinnvoll Buchstaben aneinander reiht. Ich bringe nur unverständliches Gestammel heraus.
„Alles klar, kein Problem. Komm erst einmal in Ruhe an. Ich bin übrigens Günter. Du darfst mich aber auch gerne Brockhaus nennen. Das macht der Rest des Teams auch und mittlerweile habe ich mich irgendwie daran gewöhnt.“
Sein Lächeln ist so offen und ehrlich, dass ich langsam die Fassung wiedererlange und zumindest einen freundlicheren Gesichtsausdruck zu Stande bringe.
„Und dieser junge Mann hier ist unser Genie Tristan.“ Er weist hinter mich und ich vertraue meinen Beinen nun soweit, dass ich seine Hand loslasse und mich nach dem erwähnten Genie umdrehe. Ich erinnere mich nun auch wieder an meine gute Erziehung und strecke meinem Gegenüber höflich die Hand entgegen. „Hallo,“ meine Stimme ist immer noch ziemlich brüchig, aber zumindest sind schon wieder sinnvolle Worte zu erkennen. „Ich bin Emilia. Schön, Sie kennenzulernen.“
Anstatt meine Hand zu ergreifen, tritt der mit seinen circa 1,65m recht kleine Mann einen Schritt zurück und sieht schüchtern zu Boden. „Ich weiß,“ sagt er zu seinen Füßen. „Du kannst mich duzen, wenn du magst. Ich bin einfach nur Tristan. Das Genie kannst du ruhig weglassen.“ Ganz kurz hebt er den Kopf und ich sehe das schelmische Lächeln, das ihm bei seinem kleinen Scherz über die Lippen huscht.
„Tristan hat es nicht so mit Körperkontakt“, erklärt Günter. „Das darfst du nicht persönlich nehmen.“
„Alles gut“, antworte ich und strecke meinem Chauffeur nun ebenfalls die Hand entgegen. „Vielen Dank für die angenehme Fahrt. Ich bin Emilia“, sage ich leicht spöttisch.
„Aah! Du hast deine Stimme und deinen Humor wiedergefunden. Das ist ein sehr gutes Zeichen!“. Er grinst mich fröhlich an.
Nun bringe ich auch endlich die Fragen heraus, die mir unter den Nägeln brennen seit der fremde Lockenkopf plötzlich so unverhofft in Dr. Dorschs Büro aufgetaucht ist: „Ich will nicht unhöflich sein und ich bin euch echt dankbar, dass ihr mich da rausgeholt habt und so, aber: Was ist hier eigentlich los? Wer seid ihr und warum habt ihr mir geholfen?“
„Ich kann verstehen, dass du gerne eine Erklärung für die ganze Aktion hier hättest.“
Günter macht eine umfassende Handbewegung. Dann hebt er die Hände entschuldigend in die Höhe und fährt mit ruhiger Stimme fort:
„Jetzt müssen wir aber erst einmal schauen, dass wir hier weg kommen. Unser kleines Manöver kann sie sicher eine Zeit lang von uns ablenken, aber wir sind noch nicht in Sicherheit.“
Widerwillig gebe ich mich damit zufrieden. Für den Moment. Eine Sache muss ich aber unbedingt gleich wissen: „Darf ich nach meiner Katze schauen? Sie ist bestimmt ziemlich verängstigt und ich würde sie gerne da raus holen.“ Ich zeige auf den schwarzen Kasten über dem Hinterreifen der Höllenmaschine, die uns hierher gebracht hat.
„Natürlich!“, ruft Günter. „Ich bin sicher, es geht ihr gut. Die Box wurde von den Besten der Besten entworfen und eigens für den Transport deiner Katze konstruiert. Sie ist wahrscheinlich nicht besonders glücklich, aber auf jeden Fall unversehrt.“
Vorsichtig öffnet er den Deckel der Kiste und tritt respektvoll einen Schritt zurück. Vielleicht hat er aber auch nur Angst, dass ihm das verängstigte Tier ins Gesicht springt. Ganz langsam, um sie nicht noch zusätzlich zu stressen, beuge ich mich über den Rand und schaue in das dunkle Viereck. Audrey Hepburn kauert in einer Ecke und schaut mich aus vor Schreck geweiteten Augen an. Die Arme zittert und schnurrt wie verrückt. Ich nehme sie behutsam auf den Arm und rede beruhigend auf sie ein während ich ihr samtweiches, glattes Fell streichle.
„Ist ja alles gut. Nichts passiert, meine Kleine. Alles ist gut“, flüstere ich ihr zu und fühle, wie sich ihr rasender Herzschlag etwas verlangsamt. „Wir sind in Sicherheit“, versichere ich ihr und drücke sie noch fester an mich. „Sind wir doch, oder?“, setze ich lauter und schärfer als beabsichtigt an die beiden Männer gewandt hinzu.
Der kleinere der beiden nickt nur eifrig und sieht mich aus großen Augen an, als wäre er erschrocken darüber, dass ihm jemand böse Absichten unterstellen könnte. Seine kurzen schwarzen Haare wippen dabei ganz aufgeregt und lassen ihn eher wie einen kleinen Jungen als wie ein ausgewachsenes Genie wirken. „Wie gesagt: Noch nicht ganz“, folgt die ernüchternde Antwort von Günter. „Aber wir bringen dich jetzt an den wohl sichersten Ort, den du in dieser gottverlassenen Zeit finden kannst.“
Das klingt schon besser, auch wenn mir der Gedanke, mich wieder auf das Motorrad setzen zu müssen, so gar nicht gefällt.
Günter folgt meinem skeptischen Blick zu der neben uns parkenden Maschine und lacht schallend. „Keine Sorge! Für den restlichen Weg nehmen wir den Wagen. Ist komfortabler. Und weniger auffällig.“
Immer noch lachend geht er am Motorrad vorbei, zu einem alten, weißen Lieferwagen, der ganz hinten in einer Ecke steht und mir bisher gar nicht aufgefallen ist.
„Tristan“, spricht er den anderen über die Schulter hinweg an. „Du kannst Dein Spielzeug jetzt einsammeln, denke ich.“
Der andere trottet davon in Richtung der Wand, durch die wir hereingekommen sind und murmelt dabei beleidigt vor sich hin. „…kein Spielzeug, du ignoranter…“, schnappe ich auf und unterdrücke ein Grinsen. Günter wirft mit einen belustigten Blick zu und marschiert weiter zur Heckklappe des Vans. Er öffnet die Flügeltüren und zieht eine schmale Rampe aus dem Kofferraum. Dann kommt er zurück, schiebt das Motorrad samt Helmen in den Wagen und wirft die Türen zu.
Geschäftig reibt er die Hände aneinander. „So, das hätten wir. Dann machen wir uns mal besser auf den Weg“, sagt er mit einem auffordernden Nicken in Richtung Beifahrertür. Er selbst geht zur anderen Seite des Autos und schwingt sich auf den Fahrersitz.
Mit meiner Katze auf dem Arm erklimme ich etwas umständlich den Beifahrersitz und lasse mich erschöpft darauf plumpsen. Günter wendet den Wagen und ich sehe gerade noch wie Tristan einige Meter vor der Betonmauer in die Hocke geht und sich an einem rechteckigen Kasten zu schaffen macht, der dort auf dem Boden steht.
Plötzlich verschwindet die komplette Wand wie von Zauberhand und gibt den Blick frei auf die von Laternen erhellte Straße und den dunklen Nachthimmel darüber.
Mir fällt die Kinnlade herunter.
„Ich sag doch: Genie!“, bemerkt Günter neben mir und schüttelt anerkennend den Kopf.
Tristan hebt den Kasten hoch und wir fahren ihm entgegen. Als wir auf seiner Höhe anhalten, öffne ich einladend die Beifahrertüre und rutsche rüber auf den mittleren Sitz, um ihm Platz zu machen. Er kann sein Unbehagen kaum verbergen, klettert aber schicksalsergeben zu mir auf die Bank.
Viel bekomme ich von der Fahrt nicht mit. Noch bevor wir die Lagerhäuser hinter uns lassen, schlafe ich völlig erschöpft, aber mit dem instinktiven Gefühl, jetzt endlich in Sicherheit zu sein, ein.